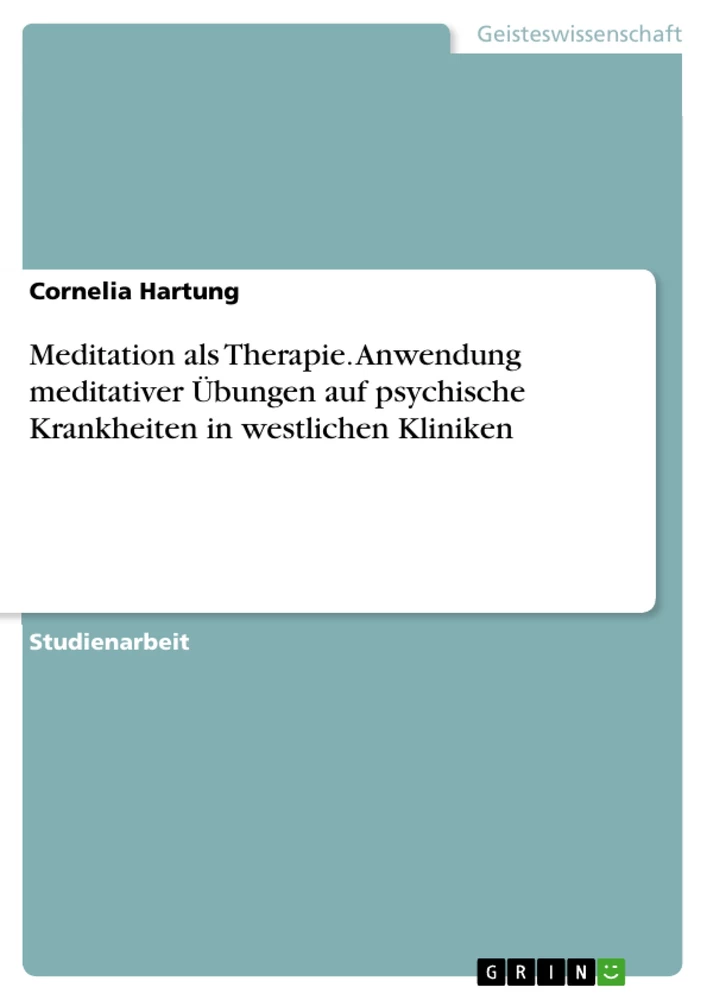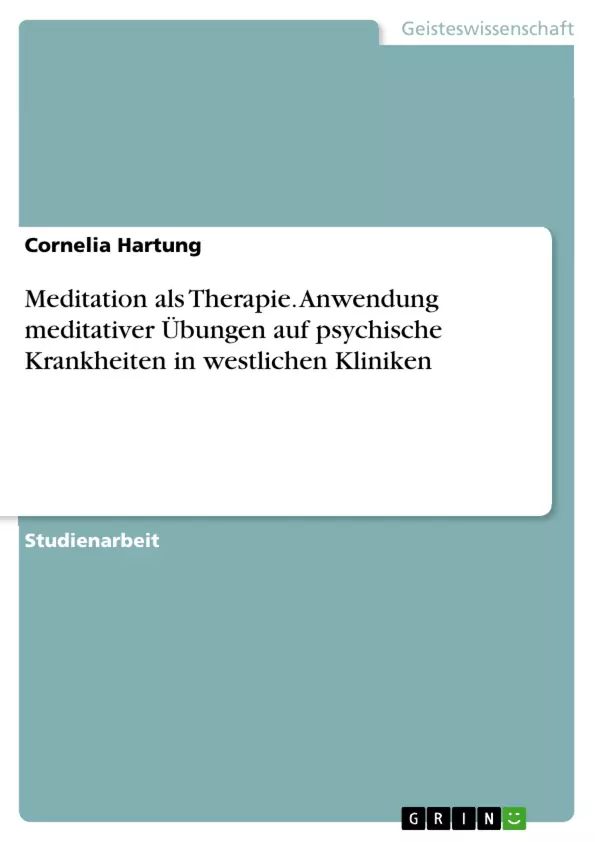Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Meditation als Therapie. Dabei soll die Anwendung meditativer Übungen auf psychische Krankheiten in westlichen Kliniken näher betrachtet werden. Doch wo liegen die eigentlichen Übergänge, Gemeinsamkeiten, sowie fundamentale Unterschiede zwischen den alt-buddhistischen Meditationslehren beziehungsweise deren Lebensphilosophien und deren Anwendung als neu entwickelten Methoden der modernen Psychotherapie in westlichen Kliniken?
Um diese Fragestellung soll es in dieser Hausarbeit gehen. Therapieansätzen in westlichen Kliniken sowie Selbst-Konzepte in der Ich-Psychologie werden untersucht. Es wird des weiteren geschaut wie Meditationspraktiken in westlichen Kontexten umgesetzt werden.
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich über die letzten Jahre immer mehr eine Art Trend entwickelt hat, alt-asiatische Weisheitsphilosophien als umgewandelte und neu entwickelte spirituelle sowie physische Therapiemethoden in die westliche Gesellschaft aufzunehmen und in den Alltag zu integrieren. So werden auch buddhistische Meditations- und Atemübungen angewandt und sollen unter anderen Menschen die an alltäglichem Stress oder mentalen Krankheiten leiden, helfen, zurück zu
ihrer Gesundheit und ihrem "Selbst" zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept des Theravada-Buddhismus
- 2.1 Das Selbst-Konzept
- 2.2 Meditation im Ursprung
- 3. Therapieansätze in westlichen Kliniken
- 3.1 Das Selbstkonzept in der Ich-Psychologie
- 3.2 Meditation als Therapiemethode
- 4. Gelingen der Anwendung von buddhistischen Praktiken im westlichen Klinikkontext
- 4.1 Vergleich der Selbstkonzept
- 4.2 Vergleich der Meditationsanwendungen
- 5. Schluss
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Anwendung meditativer Übungen aus dem Theravada-Buddhismus als Therapiemethode in westlichen Kliniken. Ziel ist es, die Brücke zwischen buddhistischen Praktiken und modernen psychotherapeutischen Ansätzen zu erforschen, insbesondere im Kontext des Selbstkonzepts und der Meditationsanwendungen.
- Das Selbst-Konzept im Theravada-Buddhismus und in der Ich-Psychologie
- Meditation als Therapiemethode im buddhistischen Kontext und in westlichen Kliniken
- Vergleich der Meditationsanwendungen und deren Gelingen in beiden Kontexten
- Die Bedeutung des Selbstbewusstseins im Kontext psychischer Erkrankungen
- Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung buddhistischer Praktiken in der westlichen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik heraus, indem sie auf die steigende Bedeutung psychischer Erkrankungen und deren Behandlung in westlichen Gesellschaften hinweist. Kapitel 2 widmet sich dem Theravada-Buddhismus, erläutert dessen Grundprinzipien und das Selbstkonzept, welches auf der Lehre vom „Nicht-Selbst“ (anattā) basiert. Kapitel 3 beleuchtet Therapieansätze in westlichen Kliniken und fokussiert auf die Bedeutung des Selbstkonzepts in der Ich-Psychologie sowie den Einsatz von Meditation als Therapiemethode.
Schlüsselwörter
Theravada-Buddhismus, Meditation, Therapie, Selbst-Konzept, anattā, Ich-Psychologie, psychische Erkrankungen, westliche Kliniken, buddhistische Praktiken, Transzendenzfragen, Selbstbewusstsein, Reinkarnation, Nirvana.
- Quote paper
- Cornelia Hartung (Author), 2022, Meditation als Therapie. Anwendung meditativer Übungen auf psychische Krankheiten in westlichen Kliniken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1420938