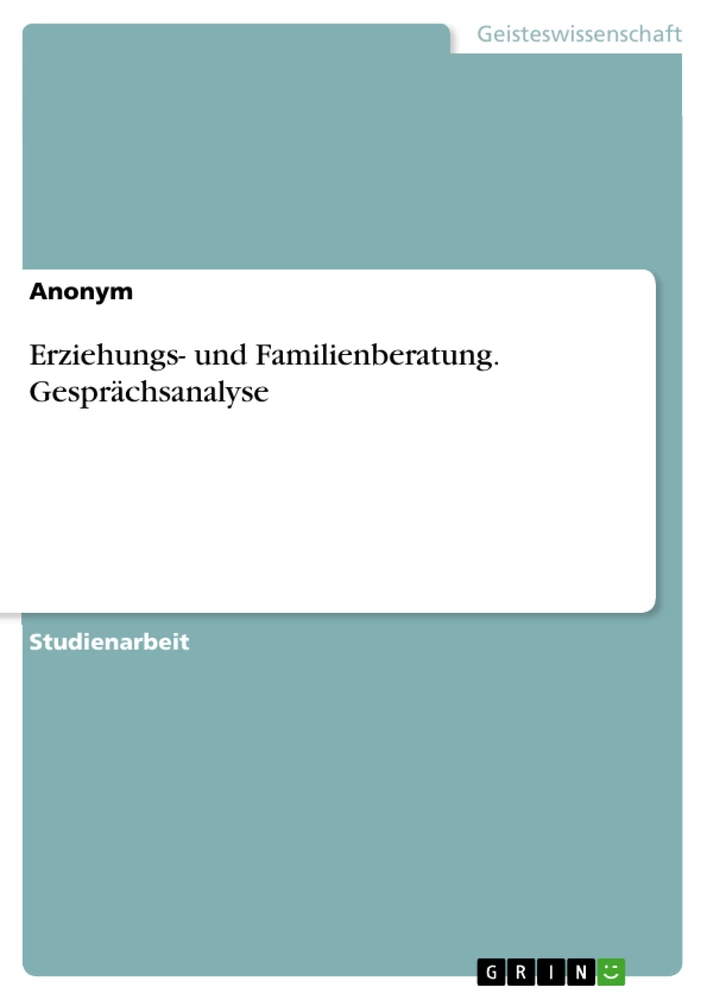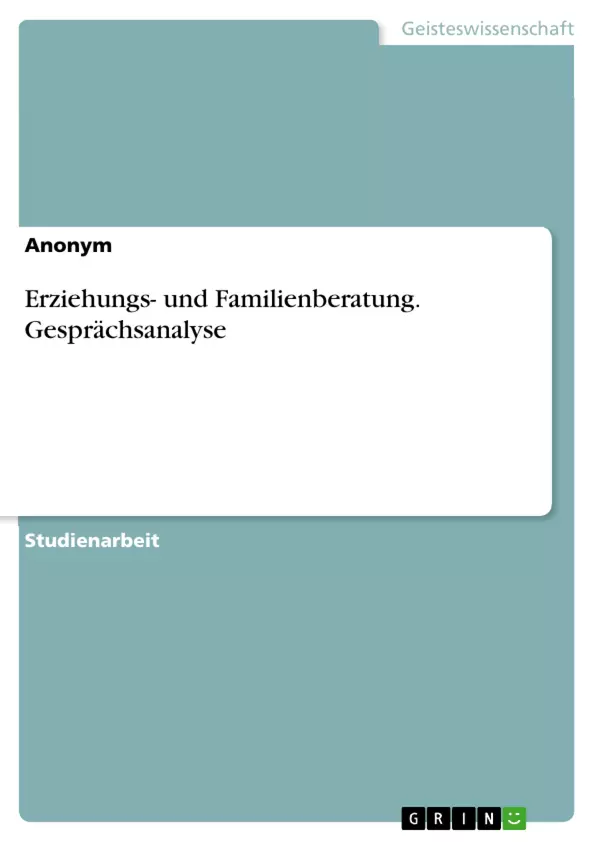Es gibt eine Vielzahl an Beratungssettings (Drogen-, Erziehungs-, Familien-, Schulden-, Studienberatung), in denen alle möglichen Menschen, Fachpersonen und Personen mit Expertise tätig sind. Ebenso vielfältig sind auch die Beratungstechniken, die angewendet werden. Generell können diese aber auf zwei fundamentale Grundmuster der Beratung komprimiert werden. Bei dem Ersten versteht sich die beratende Person als Person vom Fach, die nach einer Lösung für die*den Klient*in sucht. Dabei wird erst eine Diagnose und anschließend eine Anamnese erstellt, woraufhin eine Lösung dargeboten wird. Folglich wird der*dem Klient*in die Verantwortung abgenommen. Diese Methode ist immer dann sinnvoll, wenn die beratende Person über Fachwissen verfügt, dass die hilfesuchende Person nicht besitzt. Ein anderes Grundmuster ist vor allem bei psychosozialen Themen zu finden. Hierbei wird die*der Klient*in als Person vom Fach angesehen, da diese den Konflikt oder die Thematik selbst erfahren hat. Die Klient*innen werden dementsprechend in ihrer Lebenswirklichkeit abgeholt. So übernimmt die beratende Person lediglich die Moderation, die Verantwortung hingegen bleibt bei der*dem Klient*in. Somit bleibt die Entscheidung, worüber gesprochen oder auch nicht gesprochen wird, immer bei der*dem Klient*in. Die zentrale Tätigkeit der beratenden Person ist es lediglich „durch die Art seiner Fragen bei den Klienten neue oder andere Sichtweisen, Ideen und Bewertungen zu erzeugen“ (Palmowski, 2014). Grundlage dieser Sichtweise ist der amerikanische Psychologe Carl Rogers, der mit seinem Modell der Beratung für einen Paradigmenwechsel in der Beratungssituation sorgte. So fand Rogers heraus, dass Klient*innen bei psychosozialen Anliegen häufig dem Rat der Personen mit Expertise wenig Beachtung schenkten und dieser somit auch nicht zu Verbesserungen oder Veränderungen im Leben der Menschen führte. Karl Rogers sah Beratung auf Augenhöhe als zentralen Bestandteil an. Dabei stehen die vorhandenen Ressourcen der*des Klient*in im Mittelpunkt und werden dazu genutzt, mögliche Lösungs- und Zielansätze zu generieren und somit die Wirklichkeitskonstruktionen zu verbessern (Palmowski, 2014).
Inhaltsverzeichnis
- Theoretische Grundlagen für die Beratung
- Einführung in die Fallanalyse
- Gesprächsanalyse
- Angesprochene Probleme, Themen und Fakten:
- Gefühls- und Erlebensebene/Selbstexploration der zu beratenden Person:
- Eigene Gefühls- und Erlebensebene/Selbstexploration und Selbstkongruenz:
- Beziehungsebene:
- Handlungsebene - Ziele, Problemlösungsschritte, direkte Hilfen und Maßnahmen:
- Selbstreflexion der Berater*in und Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert ein Beratungsgespräch, in dem ein Gesprächspartner über einen erlebten Motorradunfall berichtet. Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen der Beratungskommunikation zu beleuchten und das Gespräch im Kontext theoretischer Modelle der Beratung zu betrachten.
- Die Anwendung systemischer Beratungsprinzipien
- Die Bedeutung von Empathie und bedingungsloser Wertschätzung
- Die Auswirkungen eines traumatischen Ereignisses auf den Betroffenen
- Die Rolle von Emotionen und Gefühlen im Beratungsprozess
- Die Bedeutung der Selbstexploration des Klienten im Beratungskontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Beratung und stellt verschiedene Grundmuster der Beratung vor, wobei der Fokus auf der systemischen Beratung liegt.
Das zweite Kapitel erläutert die Rahmenbedingungen und den Kontext der Fallanalyse. Hierbei werden die beteiligten Personen und das Setting des Gesprächs vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert den Gesprächsverlauf und betrachtet die Inhalte und die Kommunikation des Beratungsgesprächs im Detail. Dabei werden die Emotionen, Gedanken und Bedürfnisse des Ratsuchenden und die Reaktion der Beraterin im Kontext der systemischen Beratungsprinzipien untersucht.
Das vierte Kapitel beinhaltet die Selbstreflexion der Beraterin und ein abschließendes Fazit zu den Ergebnissen der Analyse. Die Stärken und Schwächen des Beratungsgesprächs werden diskutiert und mögliche alternative Handlungsmöglichkeiten werden reflektiert.
Schlüsselwörter
Systemische Beratung, Empathie, bedingungslose Wertschätzung, Trauma, Motorradunfall, Gesprächsanalyse, Emotionen, Selbstexploration, Selbstkongruenz, Beziehungsebene, Handlungsebene, Hilflosigkeit, Angst, Schutz, Sicherheit, Gesundheit, Identität, Autonomie, Unabhängigkeit, Selbstfindung
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Erziehungs- und Familienberatung. Gesprächsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1422862