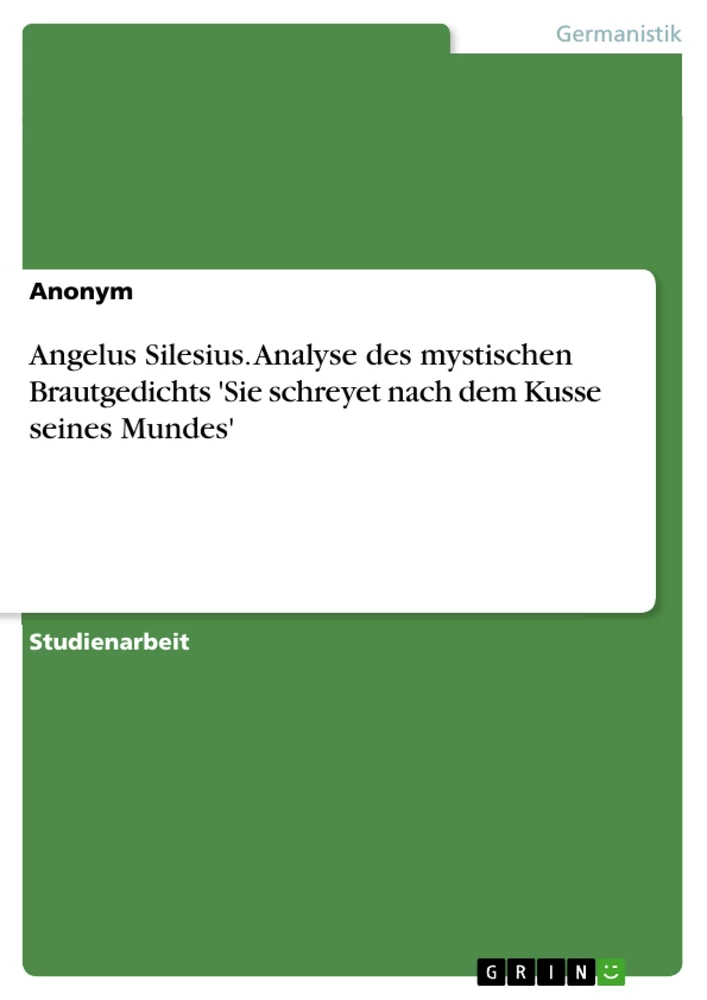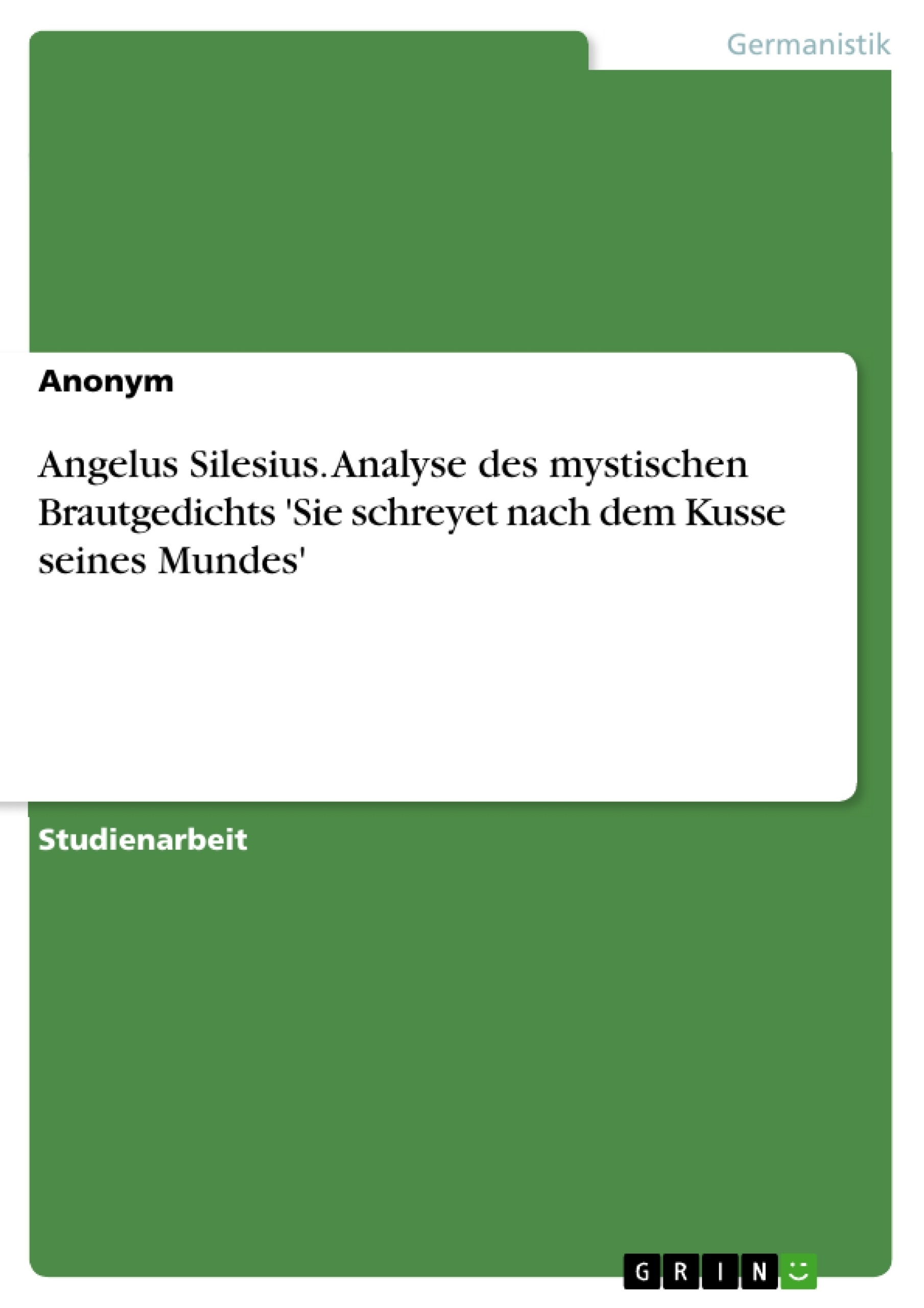Das 17. Jahrhundert war geprägt insbesondere durch den dreißigjährigen Krieg und den damit verbundenen Erlebnissen von Pest, Mord, Hunger und Plünderei aber auch von Glaubensspaltungen und Gegenreformation. Viele Autoren dieser Zeit verarbeiteten in ihren Texten daher tiefsinnige, antithetische Inhalte: Tod und Leben, Ewigkeit und Vergänglichkeit, Freuden des Diesseits und Sehnsucht nach dem Jenseits, Genuss der Welt und Askese, das Sein und der Schein.
Von der Literaturgeschichte der Germanistik werden diese Werke oft der Epochengattung des Barocks zugewiesen. Einige wichtige und die Epoche prägende Hauptvertreter waren unter anderem Andreas Gryphius, Martin Optiz, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Caspar von Lohenstein, aber auch Johann Scheffler (1624 – 1677), ferner bekannt als Schlesischer Bote, Christianus Conscientiosus oder auch Angelus Silesius.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Zeit der Barockmystik.
- II. Begriffsdefinition: Barockmystik
- III Klangliche und formale Aspekte unter Berücksichtigung stilistischer Mittel
- IV. Embleme
- V. Geistlicher Petrarkismus
- VI. Kontrafaktur
- VII. Geistliche Osculologie.
- VIII. Brautmystik.
- IX. Schluss.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Angelus Silesius' Liedgedicht „Sie schreyet nach dem Kusse seines Mundes“ hinsichtlich gattungsspezifischer Merkmale und beleuchtet die in diesem Zusammenhang angewandten religiösen Motive sowie die verwendeten Embleme in Bezug auf die Barockmystik. Ziel ist es, eine Interpretation des Gedichts vorzulegen, die die spezifischen Elemente der Barockmystik und ihre Bedeutung für die Gesamtdeutung des Werks herausarbeitet.
- Gattungsspezifische Merkmale des Liedgedichts
- Religiöse Motive in der Barockmystik
- Embleme als Ausdruck der Brautmystik
- Interpretation des Gedichts im Kontext der Barockmystik
- Bedeutung des Gedichts für die Zeit des Barocks
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Zeit der Barockmystik
Dieses Kapitel beleuchtet die historische und kulturelle Situation des 17. Jahrhunderts, die durch den Dreißigjährigen Krieg und seine Folgen geprägt war. Es werden die wichtigsten Vertreter der Barockliteratur vorgestellt, darunter Andreas Gryphius, Martin Optiz, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen und Johann Scheffler (Angelus Silesius). Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der Barockmystik als Untergattung des Barocks und ihrer prominenten Vertreter, darunter Angelus Silesius und Jakob Böhme. Das Kapitel erläutert die Entstehung und Verwendung der Liedersammlung „Heilige Seelen-Lust. Oder Geistliche Hirten-Lieder der in ihren Jesum verliebten Psyche" und präsentiert das Lied „Sie schreyet nach dem Kusse seines Mundes" als Gegenstand der Untersuchung.
II. Begriffsdefinition: Barockmystik
In diesem Kapitel wird der Begriff der Mystik aus einer historischen und theologischen Perspektive betrachtet. Die Definitionen von Mystik und Unio mystica werden erörtert, wobei die Wege zur Gnosis durch Enthaltsamkeit, Meditation und Kontemplation hervorgehoben werden. Das Kapitel beschreibt die Verbindung zwischen der christlichen Religionsmystik und der Unio mystica, die durch die tiefgründige Ausübung von Gebeten, geistlichen Gesängen und der Meditation erbauender Epigramme erlangt werden kann. Es wird auch der Begriff Cognitio Dei experimentalis als Erkenntnis von Gott durch Erfahren und Praktizieren christlicher Dogmen vorgestellt.
III Klangliche und formale Aspekte unter Berücksichtigung stilistischer Mittel
Dieses Kapitel analysiert die formalen und klanglichen Aspekte des Liedgedichts. Es werden die Abweichungen vom formalen Stil von Martin Opitz, die Verwendung von Schweifreimstrophen und der Verzicht auf die Sonettform erläutert. Der Fokus liegt auf der bewussten Konstruktion des Klangs durch den Einsatz gleich klingender Kadenzen und die Verwendung von sprachlich schwer artikulierbaren Wörtern. Der Rhythmuswechsel von Jambus zu Trochäus und die Anwendung der Katalexe werden als wichtige Stilmittel betrachtet, die zur Betonung und Intensivierung der Klangwirkung beitragen. Das Kapitel untersucht außerdem den Wechsel der Anrede von indirekt und unpersönlich zu direkt und persönlich in der letzten Strophe und dessen Bedeutung für den Aufbau des Monologs.
IV. Embleme
Das Kapitel beschäftigt sich mit den verwendeten Emblemen im Liedgedicht, die allegorische und symbolische Bedeutung haben. Es wird die Vorstellung von Jesus als Vereinigung von weiblichen und männlichen Merkmalen im Kreis von Jakob Böhme beleuchtet und das Emblem der Brust Jesus' als Feminisierung und Mutterfigur gedeutet. Das Kapitel erläutert die Bedeutung der Embleme für die Hervorhebung und Intensivierung der Brautmystik.
Schlüsselwörter
Angelus Silesius, Barockmystik, Liedgedicht, „Sie schreyet nach dem Kusse seines Mundes“, Brautmystik, Embleme, Jakob Böhme, Unio mystica, Cognitio Dei experimentalis, Geistliche Osculologie, Stilistische Mittel, Klangliche Aspekte, Formale Struktur.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Angelus Silesius?
Angelus Silesius (geboren als Johann Scheffler) war ein bedeutender Lyriker und Mystiker des Barocks, bekannt für seine tiefgründigen religiösen Epigramme und Lieder.
Worum geht es in dem Gedicht "Sie schreyet nach dem Kusse seines Mundes"?
Es ist ein mystisches Brautgedicht, das die Sehnsucht der menschlichen Seele (Psyche) nach der Vereinigung mit Gott (Jesus) in erotisch-religiöser Metaphorik beschreibt.
Was versteht man unter "Brautmystik"?
Brautmystik ist ein religiöses Motiv, bei dem das Verhältnis zwischen Gott und der Seele als Liebesbeziehung zwischen Bräutigam und Braut dargestellt wird, basierend auf dem Hohenlied der Bibel.
Welche Rolle spielen Embleme in der Barockmystik?
Embleme sind allegorische Bilder, die komplexe theologische Wahrheiten visualisieren. Silesius nutzt sie, um die Unio mystica (die Vereinigung mit Gott) zu verdeutlichen.
Was bedeutet der Begriff "Unio mystica"?
Es bezeichnet den angestrebten Zustand der vollkommenen geistigen Vereinigung der menschlichen Seele mit dem Göttlichen durch Meditation und Gebet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2009, Angelus Silesius. Analyse des mystischen Brautgedichts 'Sie schreyet nach dem Kusse seines Mundes', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142372