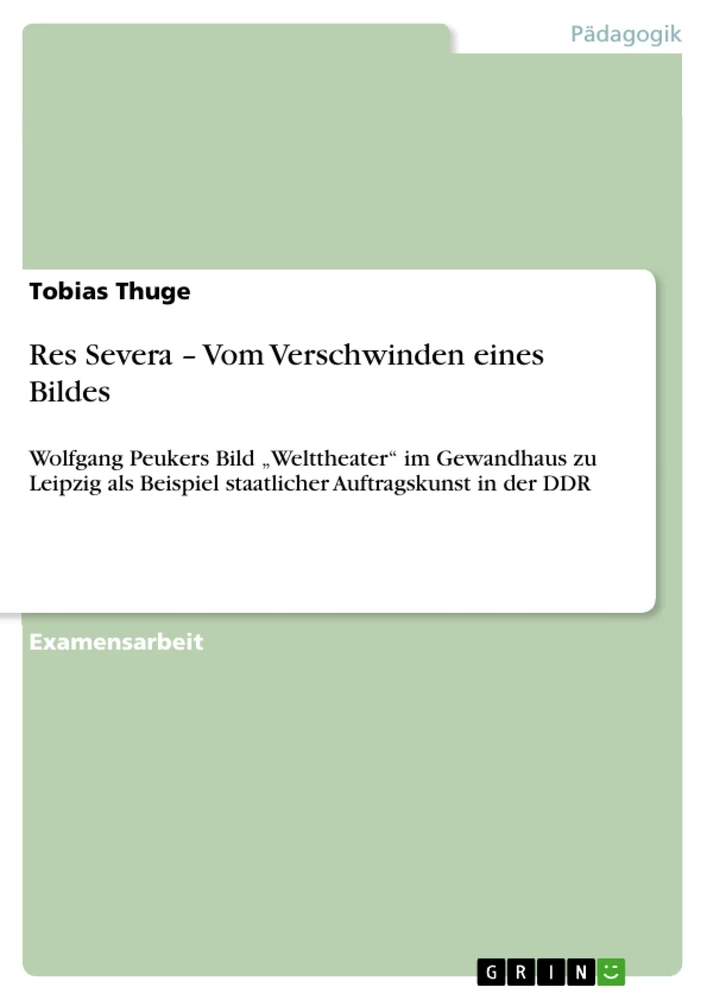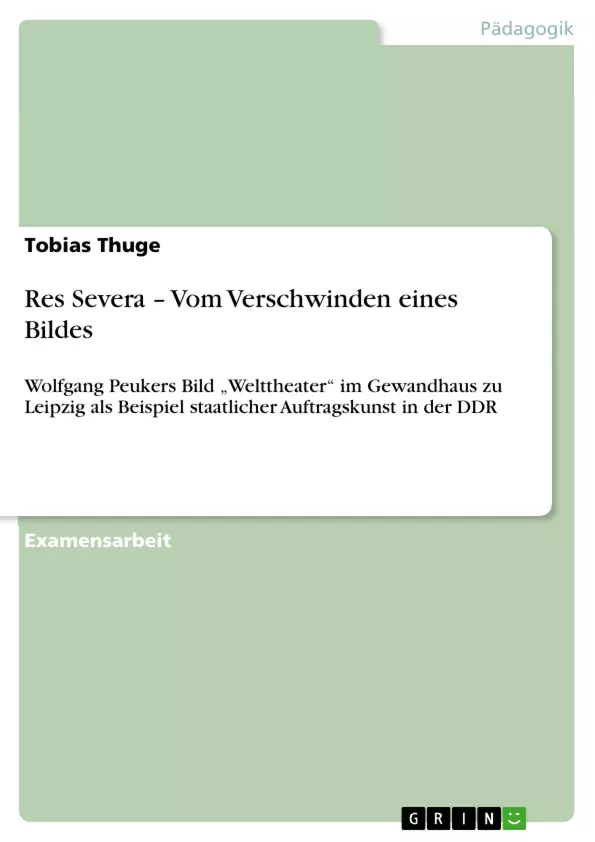Die Errichtung des Neuen Gewandhauses zu Leipzig war der erste und einzige Kulturneubau in der DDR, der in seiner architektonischen Gestaltung allein den Ansprüchen der zeitgemäßen Aufführungspraxis klassischer Musik unterworfen war. Mit diesem Anspruch wurde das Unternehmen zu einem Prestigeobjekt, in dem auch der bildenden Kunst ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde. In der Galerie des Hauses sind Werke eines Großteiles aller bedeutenden Künstler der ehemaligen DDR vertreten.
Den Mittelpunkt der hiermit vorgelegte Arbeit stellt ein Wandbild des Leipziger Malers Wolfgang Peuker dar, welches im Konzertneubau zwar begonnen, aber nicht vollendet wurde. An prominenter Stelle des Konzerthauses und unter dem monumentalen Deckenbild von Sighard Gille sollte Peuker ein mehr als 60 Quadratmeter großes, dreiteiliges Werk schaffen, welches jedoch vor der Fertigstellung übermalt und verkleidet wurde. Das Anliegen dieses Textes ist es, unter Einbezug von Archivmaterialien und Auskünften beteiligter Zeitzeugen Vorgänge und Gründe für die Zerstörung dieses Bildes zu untersuchen. Aufbauend auf den so rekonstruierten und bisher nur lückenhaft dokumentierten Ereignissen wird des Weiteren versucht, eine objektive Bewertung der Bildzerstörung vorzunehmen und diese im Kontext des Kunstauftragswesens in der ehemaligen DDR zu betrachten.
Ergänzt wird die Arbeit durch einen umfangreichen Anhang, in welchem die im Rahmen der Recherche geführten Interviews mit beteiligten Zeitzeugen nahezu ungekürzt wiedergegeben sind und somit einen ergänzenden, interessanten Einblick in die Errichtung des Gewandhauses ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- „Welttheater“
- Vorwort
- Forschungsstand und aktuelle Literatur
- Werke der bildenden Kunst in den historischen Gewandhausbauten
- Vorbemerkungen
- Der erste Gewandhaussaal (1781–1895)
- Neues Concerthaus (1882-1944)
- Das Neue Gewandhaus zu Leipzig
- Vorbemerkungen
- Bildende Kunst im Neuen Gewandhaus
- Die „Bildkünstlerische Direktive“
- Der Fall Peuker
- Vorbemerkungen
- Chronologische Rekonstruktion der Ereignisse
- Fazit, Richtigstellungen und offene Fragen
- Die Frage nach Verantwortung und Ursache
- Vorbemerkungen
- Der politisch-ideologische Aspekt
- Der Aspekt der (fehlenden) künstlerischen Leitung
- Der Aspekt der räumlichen und stilistischen Wirkung
- Der inhaltliche Aspekt
- Das „Welttheater“ als Auftragswerk
- Kontext Auftragswesen
- Die Zerstörung eines Auftragswerkes in der medialen Wahrnehmung
- Fazit
- Abschließende Betrachtungen
- Ausblick - die Zukunft eines zerstörten Bildes
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Anlagen
- Die Interviews
- Vorbemerkungen
- Interview mit Prof. Dr. Rudolf Skoda, Chefarchitekt des Neuen Gewandhauses zu Leipzig
- Interview mit Prof. Sighard Gille, Maler des Bildes „Gesang vom Leben“ im Neuen Gewandhaus
- Interview mit Gudrun Brüne zur Rolle Bernhard Heisigs bei der bildkünstlerischen Ausgestaltung des Neuen Gewandhauses
- Abbildungen
- Die Interviews
- Nachwort zur Druckfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Zerstörung des Wandbildes „Welttheater“ von Wolfgang Peuker im Hauptfoyer des Neuen Gewandhauses zu Leipzig. Ziel ist es, die Ereignisse detailliert zu rekonstruieren, die Hintergründe und Ursachen der Zerstörung aufzudecken und eine objektive Beurteilung zu ermöglichen. Dabei wird auch die Frage geklärt, inwiefern der Kontext einer staatlichen Auftragsarbeit für die Entscheidungen verantwortlich war.
- Die Zerstörung von Peukers „Welttheater“
- Der Kontext der staatlichen Auftragskunst in der DDR
- Die Rolle der „Bildkünstlerischen Direktive“
- Die Bedeutung der bildenden Kunst im Gewandhaus
- Die Frage nach Verantwortung und Ursache der Zerstörung
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt die Arbeit und ihren Gegenstand vor, indem es die Worte des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur zitiert und die Bedeutung von Kunst im Neuen Gewandhaus betont. Kapitel 2 befasst sich mit dem Forschungsstand und der verfügbaren Literatur. Es zeigt den Mangel an umfassenden und detaillierten Arbeiten zum Fall Peuker auf und beleuchtet die wenigen vorhandenen Quellen. Kapitel 3 bietet einen kurzen Abriss über die bildende Kunst in den historischen Gewandhausbauten und ermöglicht so einen Einblick in die Verbindung zwischen Tonkunst und bildender Kunst in der Geschichte des Gewandhauses.
Kapitel 4 beleuchtet die bildkünstlerische Ausgestaltung des Neuen Gewandhauses und beschreibt die „Bildkünstlerische Direktive“ als programmatisches Dokument, das das Rahmenthema aller künstlerischen Arbeiten im Haus diktierte. In Kapitel 5 wird der Fall Peuker im Detail dargestellt. Hier werden die Ereignisse chronologisch rekonstruiert und die Frage nach Verantwortung und Ursache der Zerstörung von Peukers „Welttheater“ beleuchtet. Kapitel 6 beleuchtet die Rolle des Auftragswesens im Kontext der staatlichen Auftragskunst in der DDR und geht auf die mediale Wahrnehmung der Zerstörung von Peukers Werk ein. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf die Zukunft des zerstörten Bildes gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen staatliche Auftragskunst, DDR, „Bildkünstlerische Direktive“, Gewandhaus zu Leipzig, Wolfgang Peuker, „Welttheater“, Zerstörung von Kunst, Verantwortung, Ursache, Kontext, Auftragswesen, mediale Wahrnehmung. Die Arbeit beleuchtet den Fall Peuker als Beispiel für die Verflechtung von Kunst und Politik in der DDR, analysiert die „Bildkünstlerische Direktive“ als maßgebliches Dokument für die staatliche Kunstpolitik und untersucht die Gründe für die Zerstörung eines Auftragswerkes.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Fall Peuker“ im Leipziger Gewandhaus?
Es handelt sich um die Zerstörung des Wandbildes „Welttheater“ von Wolfgang Peuker, das im Foyer des Neuen Gewandhauses begonnen, aber vor der Fertigstellung übermalt wurde.
Warum wurde das Kunstwerk „Welttheater“ zerstört?
Die Gründe liegen in einer Mischung aus politisch-ideologischen Aspekten, fehlender künstlerischer Leitung und ästhetischen Konflikten innerhalb der DDR-Kulturpolitik.
Was ist die „Bildkünstlerische Direktive“?
Dies war ein programmatisches Dokument der DDR, das die Themen und Inhalte aller künstlerischen Arbeiten im Neuen Gewandhaus vorschrieb.
Welche Rolle spielte Kurt Masur beim Bau des Gewandhauses?
Gewandhauskapellmeister Kurt Masur war eine treibende Kraft hinter dem Neubau und legte großen Wert auf die Verbindung von Musik und bildender Kunst im Haus.
Gibt es Zeitzeugenberichte zu diesen Vorgängen?
Ja, die Arbeit enthält Interviews mit dem Chefarchitekten Rudolf Skoda, dem Maler Sighard Gille und anderen Beteiligten, die Einblicke in die damaligen Entscheidungen geben.
- Quote paper
- M.A. Tobias Thuge (Author), 2005, Res Severa – Vom Verschwinden eines Bildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142391