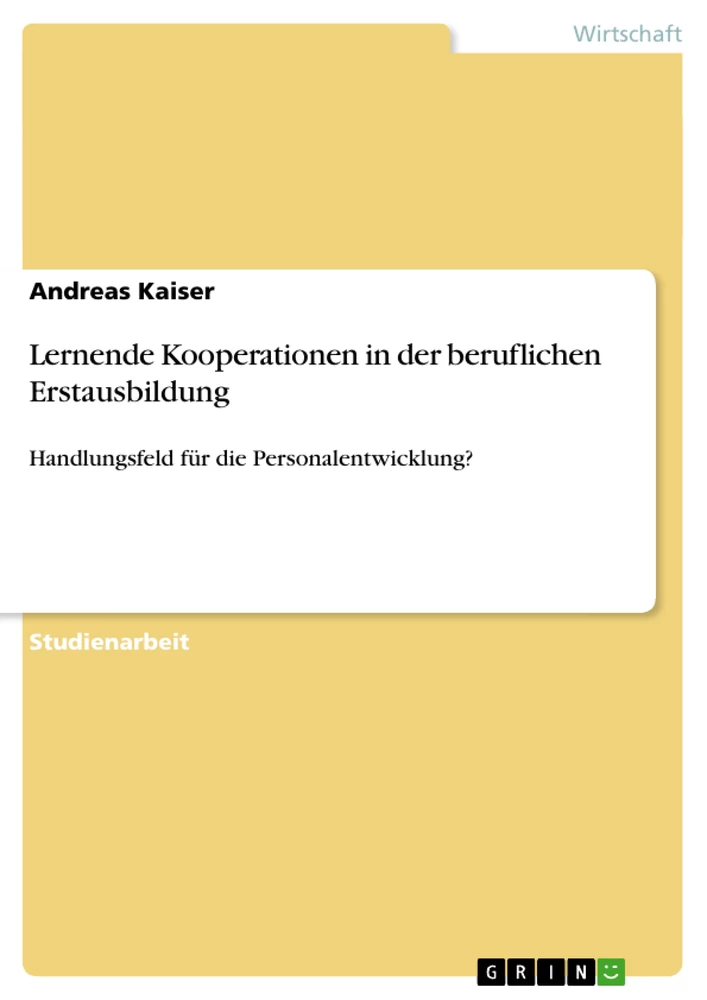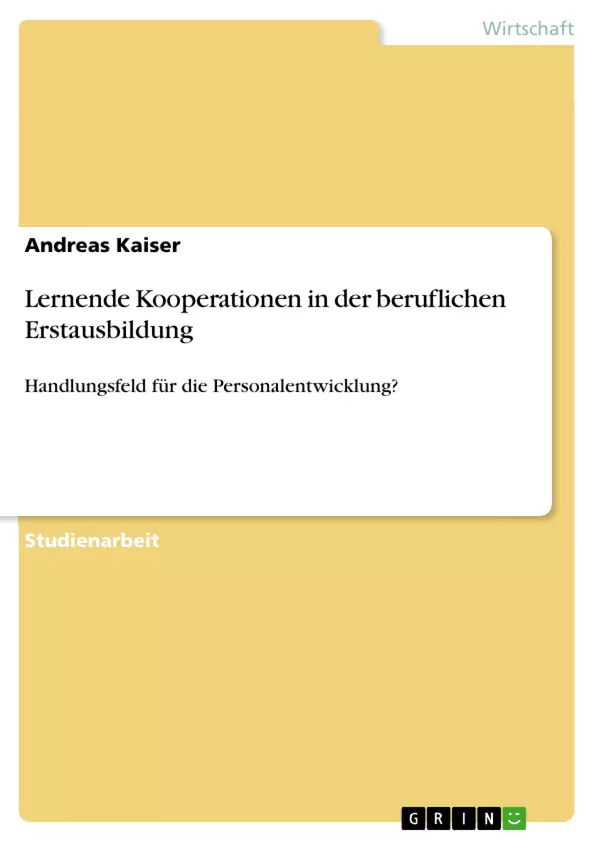Schon seit einigen Jahren befindet sich die berufliche Erstausbildung im
Brennpunkt verschiedener Diskussionen. Die Zahl der Jugendlichen ohne
Ausbildungsplatzstelle und die Zahl der Arbeitslosen ohne
Berufsausbildung werden regelmäßig von den Medien präsentiert. Aus
betrieblicher Sicht wird der aktuelle und zukünftige Facharbeitermangel
beklagt. Die Gewerkschaften hingegen kritisieren die zu geringe
Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Dabei wird der deutschen
Berufsbildung mit ihrem Dualen System oft der Pauschalvorwurf gemacht,
zu unflexibel, zu teuer und überhaupt ungeeignet zu sein, sich den
permanenten gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Es stellt sich
die Frage, ob das Duale System dem erheblichen Modernisierungsdruck
überhaupt gerecht werden kann.
Dabei hat sich in den letzten Jahren einiges im Dualen System getan.
Zum Beispiel hat das Bundesinstitut für Berufsbildung Modellversuchs-
programme initiiert, um die Forschung und Entwicklung von Lernort-
kooperationen und Berufsbildungsnetzwerken voranzubringen. Es wurde
nicht nur erkannt, dass sich die gesetzlichen und pädagogischen
Rahmenbedingungen an die Veränderungen anpassen müssen. Auch die
Ausbildungspartner und die Regionen selbst benötigen dringend größere
Handlungsspielräume. Einem zukunftsweisenden Gestaltungselement der
Berufsbildung wurde dabei erhöhte Aufmerksamkeit zuteil: Lernende
Kooperationen. Als Personalentwickler interessiert mich im Folgenden, welche Chancen
und Impulse von solchen Kooperationen in der beruflichen Bildung für die Personalentwicklung ausgehen können. Wie sehen die Handlungsfelder aus, die sich aus einer engeren Zusammenarbeit von Betrieben,
berufsbildenden Schulen und anderen Partnern des Dualen Systems für
die Personalentwicklung ergeben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das Duale System der Berufsausbildung
- Beispiele für lernende Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung
- Verbundausbildung
- „Klassische“ Lernortkooperation
- Berufsbildungsnetzwerke
- Handlungsfelder der Personalentwicklung im Bezug auf lernende Kooperationen
- Personenbezogene Handlungsfelder
- Organisationsbezogene Handlungsfelder
- Interorganisationsbezogene Handlungsfelder
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Chancen und Impulse, die lernende Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung für die Personalentwicklung bieten. Sie analysiert die Handlungsfelder, die sich aus einer engeren Zusammenarbeit von Betrieben, berufsbildenden Schulen und anderen Partnern des Dualen Systems für die Personalentwicklung ergeben.
- Das Duale System der Berufsausbildung
- Beispiele für lernende Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung
- Handlungsfelder der Personalentwicklung
- Chancen und Impulse für die Personalentwicklung durch lernende Kooperationen
- Bedeutung von lernenden Kooperationen für die Zukunft der Berufsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der beruflichen Erstausbildung in Deutschland dar und beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch den Fachkräftemangel und den Wandel der Arbeitswelt ergeben. Sie führt den Begriff der lernenden Kooperationen ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit dar.
Hauptteil
Das Duale System der Berufsausbildung
Dieser Abschnitt erläutert die Struktur und die Ziele des Dualen Systems der Berufsausbildung in Deutschland. Er beleuchtet die Rolle von Betrieben und Berufsschulen und die rechtlichen Grundlagen der Berufsbildung.
Beispiele für lernende Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Formen der lernenden Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung vor, darunter Verbundausbildung, „klassische“ Lernortkooperation und Berufsbildungsnetzwerke. Er erklärt die verschiedenen Kooperationsformen und ihre Ziele.
Handlungsfelder der Personalentwicklung im Bezug auf lernende Kooperationen
Dieser Abschnitt zeigt auf, welche Handlungsfelder sich für die Personalentwicklung aus lernenden Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung ergeben. Er unterscheidet zwischen personen-, organisations- und interorganisationsbezogenen Handlungsfeldern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Duale Berufsausbildung, Lernende Kooperationen, Verbundausbildung, Lernortkooperation, Berufsbildungsnetzwerke, Personalentwicklung, Handlungsfelder, Chancen, Impulse, Zukunft der Berufsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "lernende Kooperationen" in der Berufsbildung?
Es handelt sich um engere Zusammenarbeiten zwischen Betrieben, Berufsschulen und anderen Partnern zur Modernisierung der Ausbildung.
Was ist eine Verbundausbildung?
Ein Modell, bei dem mehrere Betriebe gemeinsam ausbilden, um spezialisierte Inhalte abzudecken, die ein einzelner Betrieb nicht leisten kann.
Welche Chancen bieten Kooperationen für die Personalentwicklung?
Sie ermöglichen einen besseren Wissenstransfer, die Förderung von Schlüsselkompetenzen und eine flexiblere Anpassung an den technologischen Wandel.
Steht das Duale System unter Modernisierungsdruck?
Ja, gesellschaftlicher Wandel und Fachkräftemangel zwingen das System zu mehr Flexibilität und pädagogischen Innovationen.
Was sind interorganisationsbezogene Handlungsfelder?
Diese betreffen die Gestaltung der Schnittstellen und Netzwerke zwischen den verschiedenen Lernorten der Berufsausbildung.
- Citar trabajo
- Andreas Kaiser (Autor), 2009, Lernende Kooperationen in der beruflichen Erstausbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142397