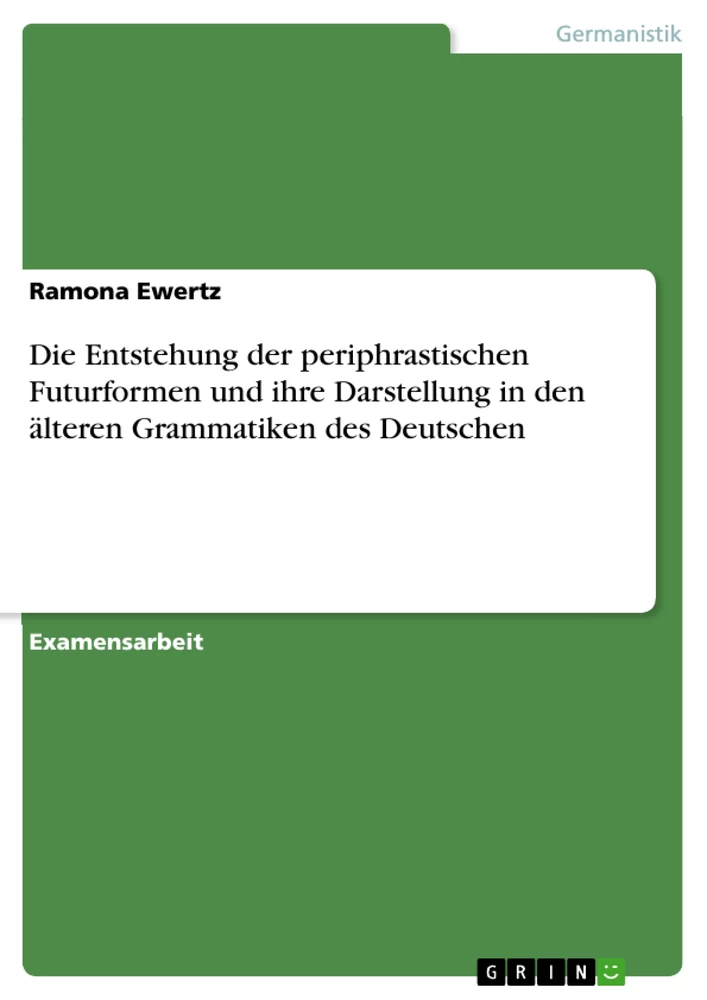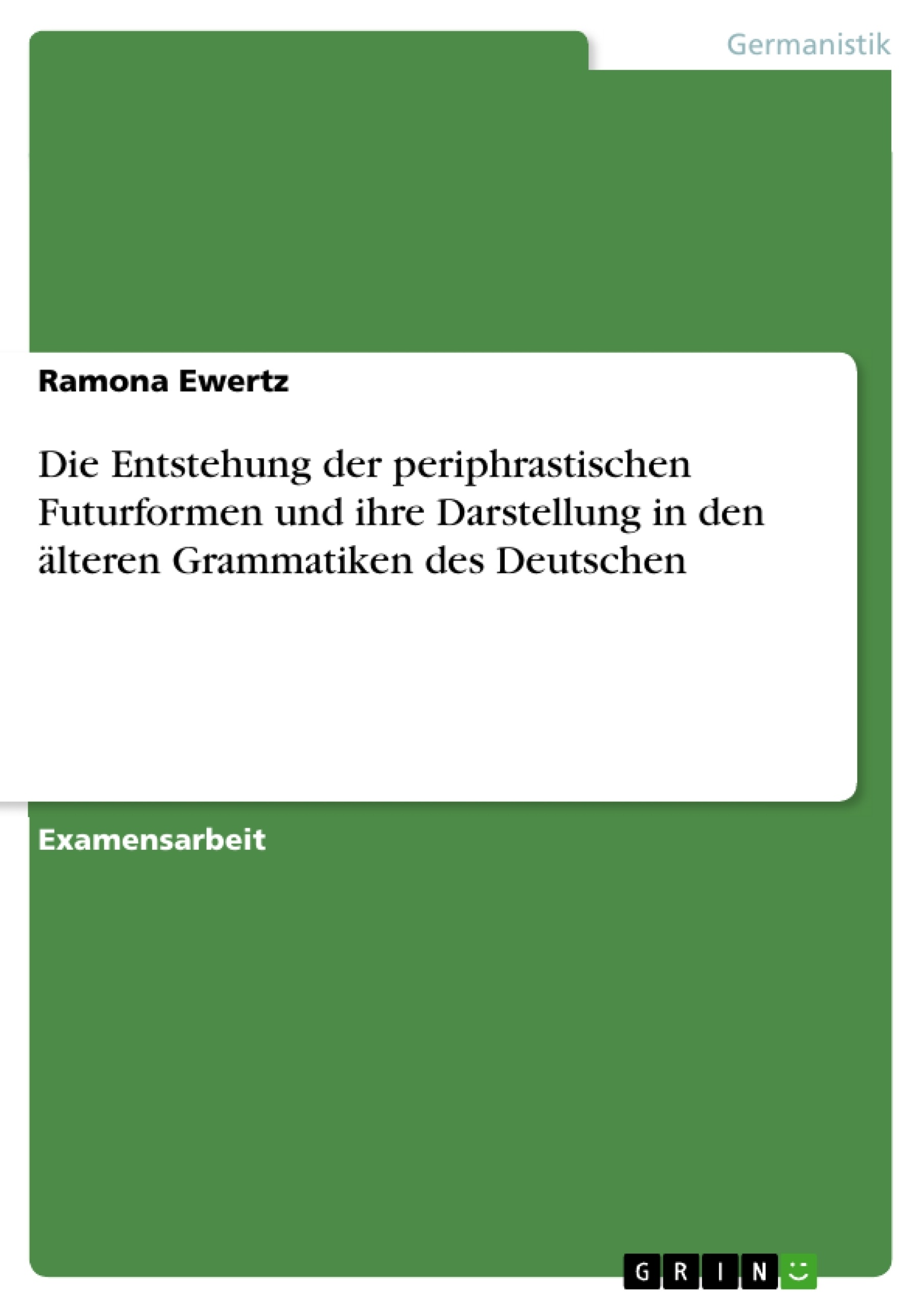Die Entwicklung des periphrastischen werden – Futurs ist eines der jüngsten und interessantesten Sprachwandelphänomene des Deutschen. Sie beginnt in mittelhochdeutscher Zeit und setzt sich im Frühneuhochdeutschen kontinuierlich fort.
Wie die Konstruktion aus werden und dem Infinitiv jedoch entstanden ist, und warum sich das Verb werden letztlich gegenüber den Modalverbkonstruktionen mit wollen und sollen durchsetzten konnte, ist bis heute nicht geklärt.
Zieht man einen Vergleich zu den Futurformen anderer germanischer Sprachen, so ist dies umso verwunderlicher, da sowohl das Englische als auch das Niederländische, das Dänische und das Schwedische sollen als Mittel zur Futurbildung nutzen .
Im Französischen, einer romanischen Sprache, wird das periphrastische Futur mit aller gebildet, sodass ein Einfluss von dieser Seite von vorneherein ausgeschlossen werden kann.
Eine weitere in der Forschung diskutierte Frage ist die nach der Temporalität bzw. der Modalität der Konstruktion werden + Inf., die Saltveit 1960 auslöste .
Genau mit dieser Frage befasst sich die Arbeit nach einer kurzen Einleitung, einem Überblick über die Quellen und einer Formulierung der Zielsetzung der Arbeit, um dann auf die Entstehung von werden + Inf. einzugehen.
Zahlreiche Theorien wurden dazu aufgestellt, kritisiert oder wieder verworfen. In dieser Arbeit sollen die wichtigsten Gedanken zu diesem Thema zunächst zusammengestellt und durch eigene Ansichten ergänzt werden.
Im Anschluss daran stellt sich die Frage, wieso sich die weniger genutzte Konstruktion werden + Inf. gegenüber den bis dahin bestehenden Möglichkeiten zur Futurumschreibung durchsetzen konnte.
Bevor ein Zwischenfazit zum ersten Teil der Arbeit gezogen werden soll, möchte ich noch kurz untersuchen, inwiefern werden + Inf. den Grammatikalisierungsprozess durchlaufen hat und die entsprechenden Gründe dafür finden.
Der zweite Teil der Arbeit beginnt mit einem kleinen Überblick über die Geschichte der frühen deutschen Grammatikschreibung und geht dann dazu über, die Darstellung des Futurs in den einzelnen Grammatiken zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in einem Zwischenfazit zusammengefasst werden.
Im letzten Kapitel soll abschließend versucht werden, die Ergebnisse der beiden Arbeitsteile miteinander abzugleichen. Dabei steht die Frage, ob und inwiefern die Untersuchung der grammatischen Darstellungen auf die Theorien zur Entstehung des werden – Futurs Einfluss nehmen kann, im Mittelpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Vorwort
- 2. Die Quellen
- 3. Ziel dieser Arbeit
- II. Werden + Inf. – Tempus oder Modus?
- III. Theorien zur Entstehung von werden + Inf.
- 1. Ältere Theorien zur Entstehung von werden + Inf.
- a. Abschleifungstheorie
- b. Synkretismushypothese
- 2. Elisabeth Leiss: Sprachkontakt mit dem Tschechischen
- a. Röslers Theorie
- b. Umkehrung von Röslers Theorie
- c. Kritik
- 3. Hans Ulrich Schmid: Entstehung durch Kontamination
- a. Schmids Theorie
- b. Kritik
- 4. Gabriele Diewald/Mechthild Habermann: Analogiethese
- a. Theorie Diewalds und Habermanns
- b. Kritik
- IV. Die Durchsetzung des werden-Futurs
- 1. Volker Harm
- a. Harms Theorie
- a.a. werden + Inf. vs. werden + Part. Präs.
- a.b. werden + Inf. vs. Modalverbkonstruktionen
- b. Kritik
- a. Harms Theorie
- 2. Gabriele Diewald/Mechthild Habermann: Die Rolle des Lateinischen
- a. Theorie
- b. Kritik
- 1. Volker Harm
- V. Die Grammatikalisierung von werden + Inf.
- VI. Die Entstehung von werden + Inf. im Zwischenfazit
- VII. Die Geschichte der frühen deutschen Grammatikschreibung
- 1. Der mittelhochdeutsche Lateinunterricht
- 2. Die deutschen Grammatiken
- VIII. Die Darstellung der periphrastischen Futurformen in den einzelnen Grammatiken
- 1. Lateinische Grammatiken
- a. Aus dem Quadrinium Grammatices Joannis Coclaei Norici Artium (1511)
- b. Joannis Aventinus: Grammatica omnium vtilissima et breuissima (1512)
- 2. Deutsche Grammatiken
- a. Valentin Ickelsamer: Ein Teutsche Grammatica (1534)
- b. Johann Elias Meichszner: Handtbuechlein grundtlichs berichts Recht vnd wolschrybens der Orthographie vnd Grammatic (1538)
- c. Laurentius Albertus: Teutsch Grammatick oder Sprach-Kunst (1573)
- d. Albert Ölinger: Vnderricht der Hoch Teutschen Spraach (1574)
- e. Johannes Clajus: Grammatica Germanicae Linguae (1578)
- f. Johannes Kromayer: Deutsche Grammatica. Zum newen Methodo der Jugend zum besten zugerichtet (1618)
- g. Wolfgang Ratke: Allgemeine Sprachlehr: Nach der Lehrart Ratichii (1619)
- h. Christoph Achatius Hager: Teu(e über u)tsche Orthographia
- i. Christian Gueintz: Deutscher Sprachlehre Entwurf (1641)
- j. Justus Georg Schottelius: Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache (1663)
- k. Christian Pudor: Der Teutschen Sprache Grundrichtigkeit und Zierlichkeit (1672)
- l. Johann Bödiker: Grundsäze der Teutschen Sprache (1690)
- m. Kaspar Stieler: Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder Teutscher Sprachschatz (1691)
- n. Carl Friedrich Aichinger: Versuch einer teutschen Sprachlehre (1753)
- o. Verschiedene Autoren
- o.a. Hans Fabritius: Das Büchlein gleichstimmender Wörter, aber ungleichs Verstandes (1532)
- o.b. Peter Jordan: Leyenschul (1533)
- o.c. Jacob Grüssbeutel: Ein besonder fast nützlich Stymmen büchlein (1534)
- 1. Lateinische Grammatiken
- IX. Untersuchungsergebnisse
- X. Die Bedeutung der Ergebnisse für die Frage nach der Entstehung von werden + Inf.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung der periphrastischen Futurformen im Deutschen. Ziel ist es, die Entwicklung dieser Konstruktion aus werden und Infinitiv nachzuvollziehen und die verschiedenen Theorien zur Entstehung sowie zur Durchsetzung von werden + Inf. gegenüber anderen Futurformen zu beleuchten. Dabei soll auch die Darstellung des Futurs in frühen deutschen Grammatiken untersucht werden.
- Die Entstehung der periphrastischen Futurformen im Deutschen
- Die verschiedenen Theorien zur Entstehung von werden + Inf.
- Die Durchsetzung von werden + Inf. gegenüber anderen Futurformen
- Die Darstellung des Futurs in frühen deutschen Grammatiken
- Die Grammatikalisierung von werden + Inf.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Entstehung der periphrastischen Futurformen ein. Sie gibt einen Überblick über die Quellen und die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel II beleuchtet die Frage nach der Temporalität oder Modalität der Konstruktion werden + Inf.
Kapitel III beschäftigt sich mit verschiedenen Theorien zur Entstehung von werden + Inf., beginnend mit älteren Theorien wie der Abschleifungstheorie und der Synkretismushypothese. Es werden auch Theorien von Elisabeth Leiss, Hans Ulrich Schmid und Gabriele Diewald/Mechthild Habermann besprochen.
Kapitel IV untersucht die Durchsetzung des werden-Futurs und analysiert die Theorien von Volker Harm und Gabriele Diewald/Mechthild Habermann zur Rolle des Lateinischen.
Kapitel V befasst sich mit der Grammatikalisierung von werden + Inf.
Kapitel VI fasst die Ergebnisse des ersten Teils der Arbeit zusammen.
Kapitel VII gibt einen Überblick über die Geschichte der frühen deutschen Grammatikschreibung.
Kapitel VIII untersucht die Darstellung der periphrastischen Futurformen in verschiedenen Grammatiken, sowohl lateinischen als auch deutschen.
Schlüsselwörter
Periphrastische Futurformen, Sprachwandel, werden + Inf., Modalverbkonstruktionen, Grammatikalisierung, deutsche Grammatiken, Geschichte der deutschen Grammatikschreibung, Lateinische Grammatiken.
- Quote paper
- Ramona Ewertz (Author), 2009, Die Entstehung der periphrastischen Futurformen und ihre Darstellung in den älteren Grammatiken des Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142501