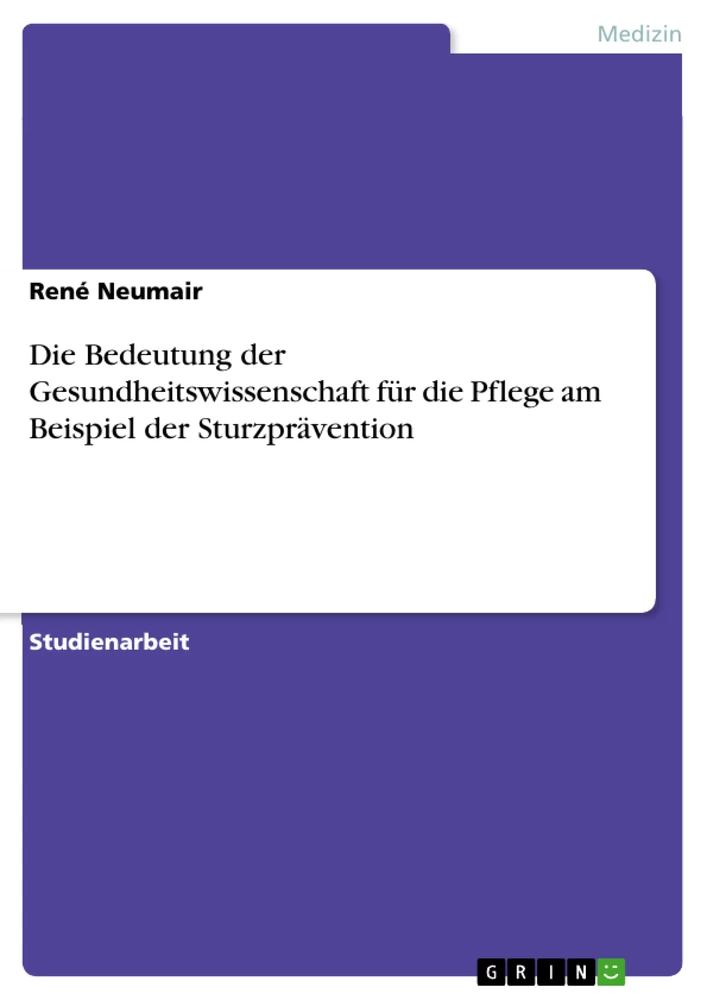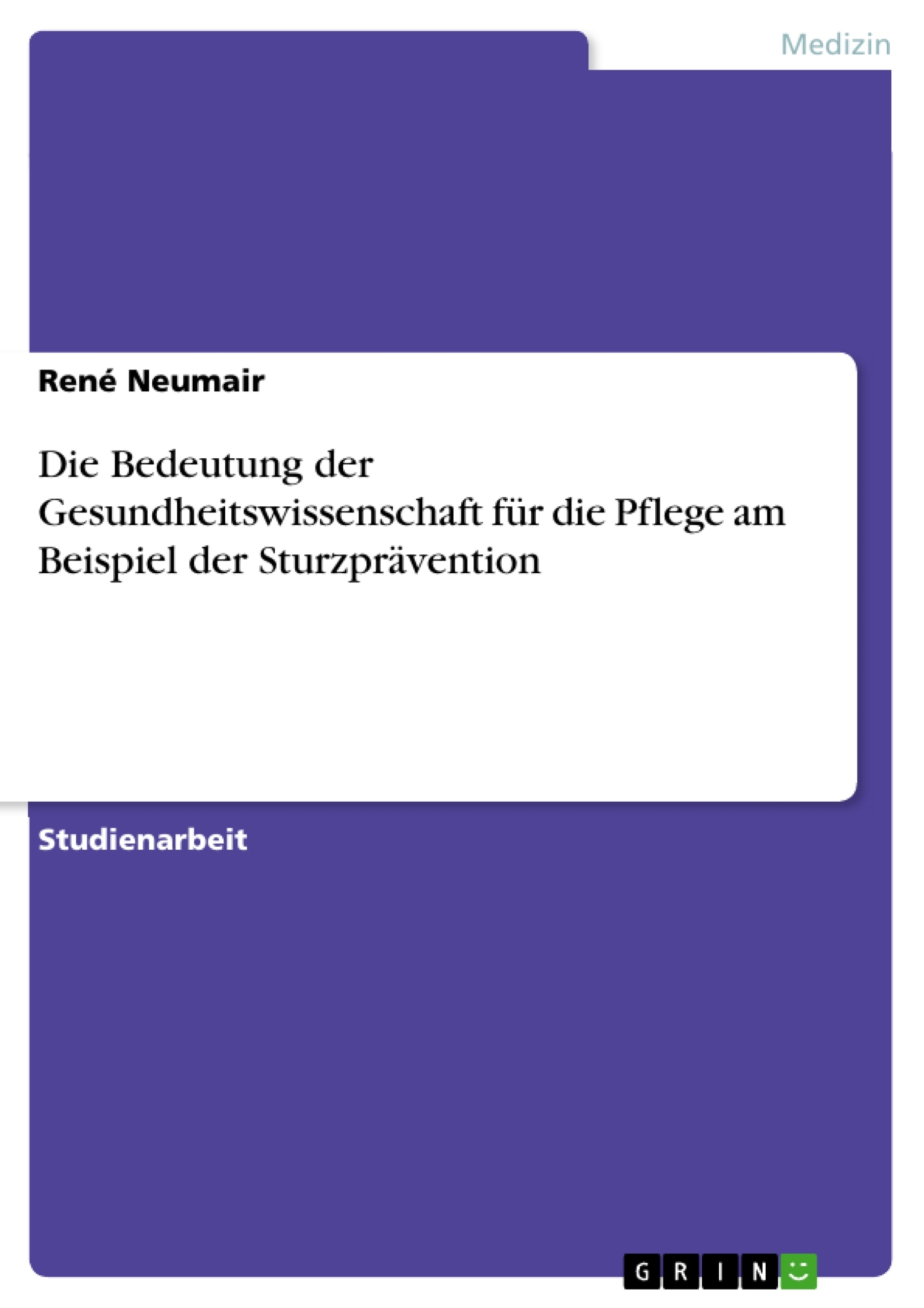Stürze älterer Menschen stellen aufgrund ihrer Häufigkeit und der zum Teil schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen ein bedeutsames Phänomen für die Praxis der Pflege dar.
Ein Sturz kann einen gravierenden Einschnitt in die bisherige Lebensführung darstellen. Neben Prellungen, Frakturen oder Wunden können Stürze auch psychologische und soziale Konsequenzen mit sich bringen, die zu einer erheblichen Einschränkung der Selbständigkeit der gestürzten Person führen können.
Im Angesicht der demographischen Entwicklung, die eine Zunahme der älteren und pflegebedürftigen Bevölkerung erwarten lässt, kann davon ausgegangen werden, dass auch die Problematik der Stürze und Sturzfolgen weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass Stürze aber keineswegs als unabänderliches Schicksal oder unvermeidbares Unfallgeschehen anzusehen sind. Vielmehr wird heute davon ausgegangen, dass ein Sturz ein komplexes, durch das Zusammenwirken und die Verkettung von verschiedenen Faktoren bedingtes Ereignis darstellt, dem mit geeigneten Interventionen begegnet werden kann.
Die vorliegende Arbeit kann nur einen ersten Einblick in die vielschichtige Thematik gewähren und als Ausgangspunkt für weiterführende Fragestellungen dienen.
Zunächst werden dazu die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Phänomen des Sturzes beschäftigen, kurz vorgestellt. Dies sind die Gesundheitswissenschaft(en)/Public Health und die Pflegewissenschaft.
Anschließend werden die beiden großen gesundheitswissenschaftlichen Handlungsmethoden – Gesundheitsförderung und Prävention – beschrieben und voneinander abgegrenzt. Ihre Relevanz für die Praxis der Pflege wird auch anhand ihres Stellenwerts in der Gesetzgebung dargelegt.
Im Anschluss daran wird der Versuch einer Definition des Begriffes „Sturz“ unternommen. In den darauf folgenden Abschnitten werden die Sturzhäufigkeit (Epidemiologie), Sturzfolgen und die häufigsten Sturzrisikofaktoren aufgezeigt. Ergänzend dazu werden sodann die Möglichkeiten zur Einschätzung des individuellen Sturzrisikos diskutiert.
Abschließend soll auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit mit geeigneten Interventionsprogrammen in stationären Einrichtungen der Altenhilfe der Sturzproblematik begegnet werden kann.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Wissenschaftlicher Bezugsrahmen
- Gesundheitswissenschaft
- Public Health
- Pflegewissenschaft
- Verhältnis von Pflegewissenschaft und Public Health
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsförderung
- Prinzipien, Handlungsqualifikationen und Handlungsstrategien
- Ebenen der Gesundheitsförderung
- Prävention
- Einteilung der Präventionsmaßnahmen nach dem Zeitpunkt
- Einteilung der Präventionsmaßnahmen nach der Zielgröße
- Einteilung der Präventionsmaßnahmen nach der Methode
- Forderungen des Gesetzgebers
- Gesundheitsförderung
- Sturzhäufigkeit (Epidemiologie)
- Folgen von Sturzereignissen
- Physische Folgen von Sturzereignissen
- Psychologische und soziale Folgen von Sturzereignissen
- Gesundheitsförderung in Abgrenzung zur Prävention
- Die Sturzproblematik in der Pflege
- Der „Sturz\" - Versuch einer Begriffsbestimmung
- Sturzrisikofaktoren
- Einschätzung des individuellen Sturzrisikos
- Möglichkeiten und Grenzen von Interventionsprogrammen in stationären Einrichtungen der Altenhilfe
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege am Beispiel der Sturzprävention. Sie untersucht den wissenschaftlichen Bezugsrahmen, die gesundheitswissenschaftlichen Handlungsmethoden und die Sturzproblematik in der Pflege.
- Die Rolle der Gesundheitswissenschaft (Public Health und Pflegewissenschaft) in der Sturzprävention
- Die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention in der Pflege
- Die Analyse von Sturzrisikofaktoren und ihren Auswirkungen
- Die Evaluation von Möglichkeiten und Grenzen von Interventionsprogrammen zur Sturzprävention
- Die Relevanz der Sturzproblematik für die Praxis der Pflege angesichts der demografischen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den wissenschaftlichen Bezugsrahmen, indem es die Gesundheitswissenschaft, Public Health und die Pflegewissenschaft in ihrer Relevanz für die Sturzproblematik vorstellt. Dabei werden die jeweiligen Disziplinen definiert und ihre Schwerpunkte im Kontext der Sturzprävention herausgearbeitet.
Das zweite Kapitel widmet sich den gesundheitswissenschaftlichen Handlungsmethoden Gesundheitsförderung und Prävention. Es erläutert die Prinzipien, Handlungsqualifikationen und -strategien der Gesundheitsförderung sowie die verschiedenen Ebenen der Gesundheitsförderung. Die Prävention wird im Kontext der Sturzproblematik betrachtet, wobei unterschiedliche Einteilungen der Präventionsmaßnahmen nach Zeitpunkt, Zielgröße und Methode vorgestellt werden.
Kapitel drei widmet sich der Sturzproblematik in der Pflege. Es wird versucht, den Begriff "Sturz" zu definieren und die Häufigkeit von Sturzereignissen (Epidemiologie) sowie die physischen, psychologischen und sozialen Folgen von Stürzen darzustellen. Zudem werden die wichtigsten Sturzrisikofaktoren und Möglichkeiten zur Einschätzung des individuellen Sturzrisikos beleuchtet. Abschließend werden Interventionsprogramme in stationären Einrichtungen der Altenhilfe im Hinblick auf die Sturzprävention diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege, insbesondere im Bereich der Sturzprävention. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Public Health, Pflegewissenschaft und Sturzrisikofaktoren. Weitere wichtige Themen sind Gesundheitsförderung, Prävention und Interventionsprogramme in stationären Einrichtungen der Altenhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Sturzprävention in der Pflege so wichtig?
Stürze im Alter haben oft schwerwiegende physische, psychische und soziale Folgen, die die Selbstständigkeit der Betroffenen massiv einschränken können.
Was ist der Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention?
Prävention zielt darauf ab, spezifische Krankheiten oder Unfälle zu verhindern, während Gesundheitsförderung allgemeine Ressourcen und die Lebensqualität stärken will.
Welche Risikofaktoren führen zu Stürzen?
Es wird zwischen intrinsischen Faktoren (z. B. Muskelschwäche, Sehstörungen) und extrinsischen Faktoren (z. B. Stolperfallen, schlechte Beleuchtung) unterschieden.
Welche Rolle spielt Public Health bei der Sturzprävention?
Public Health betrachtet das Phänomen auf Bevölkerungsebene und entwickelt Strategien zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit und Gesundheitsversorgung für Senioren.
Wie kann das individuelle Sturzrisiko eingeschätzt werden?
Durch standardisierte Assessments und Beobachtungen der Mobilität können Pflegekräfte gefährdete Personen identifizieren und gezielte Maßnahmen einleiten.
- Arbeit zitieren
- René Neumair (Autor:in), 2009, Die Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege am Beispiel der Sturzprävention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142657