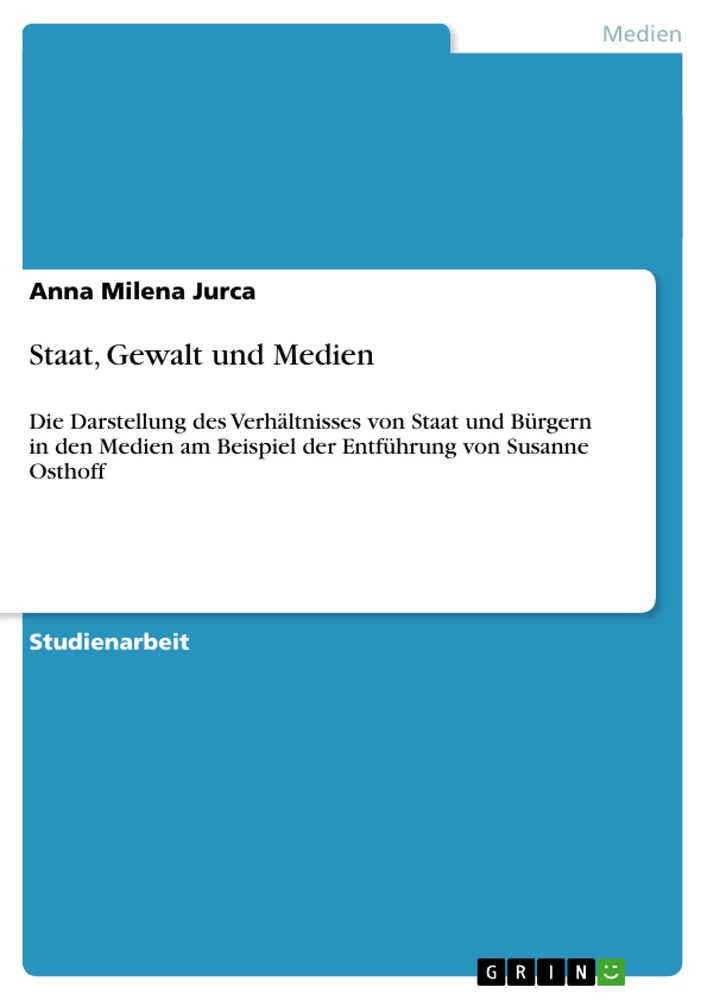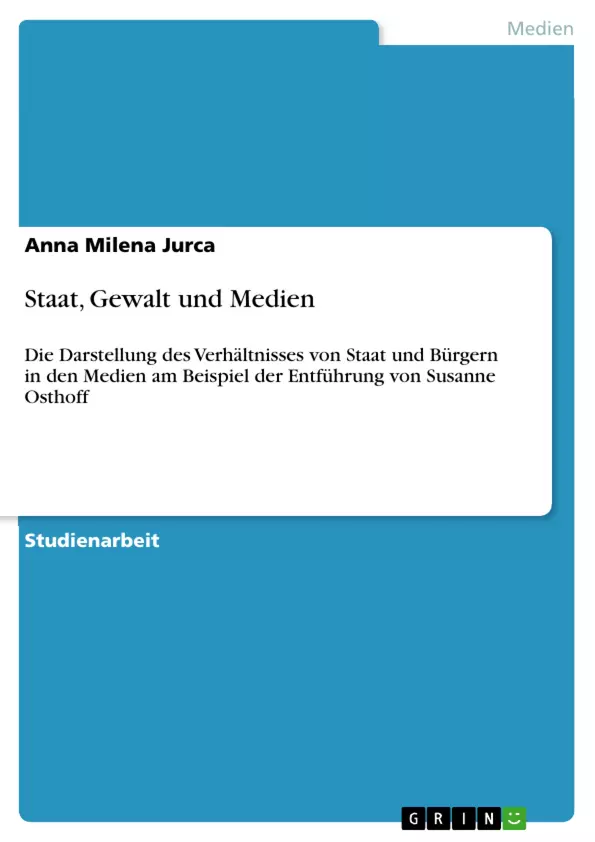Die Hausarbeit untersucht diese Fragen am Beispiel der Entführung von Susanne Osthoff in der öffentlichen Meinung in Deutschland anhand der überregionalen Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Online-Ausgabe der Zeit im Untersuchungszeitraum vom 25. November bis zum 20. Dezember 2005. Die Medien werden hinsichtlich ihrer Aufbereitung des Themas, der inhaltlichen Darstellung der einzelnen Themenaspekte und der Rolle im Kommunikationsprozess zwischen Staat und Bürgern verglichen. Die Hypothese ist: Medien nehmen eine aktive Rolle bei der Kommunikation zwischen Staat und Gewalt ein und sind nicht nur unbeteiligte Beobachter eines sie nicht tangierenden Geschehens. Sie reflektieren das Geschehen und ihr eigenes Verhalten auch in Krisensituationen.
Da im Rahmen dieser Arbeit nicht entschieden werden kann, welche Auswirkungen die Berichterstattung der Medien auf die Entscheidungen der Bundesregierung hat, werden Darstellungsweise und Selbstreflexion der Medien als Indikatoren dafür genommen, welche Funktion und Rolle Medien sich zuschreiben und wie sie die Ausübung der Funktion selbst wahrnehmen und bewerten. Davon kann ausgegangen werden, da es sich bei Medienkommunikation um einen bewussten Vorgang handelt.
Ausgelassen werden in der Hausarbeit die Ereignisse und die Medienberichterstattung nach der Freilassung Susanne Osthoffs, insofern sie sich auf aktuelle Ereignisse beziehen. Zwei spätere Hintergrundberichte werden jedoch miteinbezogen, da sie das Thema noch einmal rückwirkend unter zwei wichtigen Aspekten beleuchten. Der weitere Fortgang der Ereignisse wäre insofern interessant, wollte man den Schwerpunkt auf den Wechsel in der Berichterstattung bezüglich der Person Susanne Osthoff legen. Für die Fragestellung der Arbeit ist dies aber von sekundärer Bedeutung.
Zunächst grenzt die Arbeit anhand der Konkretisierung der wichtigsten Begriffe deren Bedeutungsspielraum ein und stellt Forschungsgegenstand und Methode dar. Darauf folgt eine qualitative Inhaltsanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Thematisierung des Verhältnisses von Staat und Bürger. Hier werden Akteure und Interessen, die Chronologie der Ereignisse, die Tendenzen der Berichterstattung, das in den Medien kommunizierte Verhältnis von Staat und Bürgern und die Frage nach einer möglichen Interaktion von Öffentlichkeit und Gewalt untersucht. Das Resümee fasst die Ergebnis der Analyse zusammen, bewertet dieses und gibt einen Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen, Forschungsüberblick und Methode
- Definition Staat, Bürger und öffentliche Meinung
- Forschungsstand
- Analysemethode
- Inhaltsanalyse
- Chronologie der Ereignisse
- Akteure, Positionen und Interessen
- Tendenzen der Berichterstattung
- Das Verhältnis von Bürgern und Staat in den Medien
- Das Wechselspiel von öffentlicher Meinung und Gewalt
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung des Verhältnisses von Staat und Bürgern in den Medien, insbesondere in einer Krisensituation. Sie untersucht, wie Medien dieses Verhältnis in der Entführung von Susanne Osthoff behandeln, ihre Macht zur Meinungsbildung nutzen und ihre eigene Rolle im Kommunikationsprozess reflektieren. Zudem beleuchtet die Arbeit die potenziellen Auswirkungen von Medien und ihrer Funktion in einer Demokratie auf (terroristische) Gewalt.
- Die Rolle der Medien in der Kommunikation zwischen Staat und Bürgern
- Die Darstellung des Verhältnisses von Staat und Bürgern in Krisensituationen
- Die Einflussnahme von Medien auf die öffentliche Meinung
- Die Selbstreflexion der Medien in Krisensituationen
- Der Zusammenhang zwischen Medien, Demokratie und (terroristischer) Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellungen der Arbeit vor und erläutert den Untersuchungsgegenstand am Beispiel der Entführung von Susanne Osthoff. Sie untersucht die Medien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und die Online-Ausgabe der Zeit (ZEIT) im Zeitraum vom 25. November bis zum 20. Dezember 2005. Die Hypothese ist, dass Medien eine aktive Rolle in der Kommunikation zwischen Staat und Bürgern spielen und das Geschehen und ihr eigenes Verhalten reflektieren.
Das zweite Kapitel definiert die Schlüsselbegriffe Staat, Bürger und öffentliche Meinung. Es bietet einen Forschungsüberblick über die Darstellung des Verhältnisses von Bürger und Staat in den Medien und stellt die Analysemethode vor.
Das dritte Kapitel widmet sich der Inhaltsanalyse. Es behandelt die Chronologie der Ereignisse, die beteiligten Akteure und deren Interessen, die Tendenzen der Berichterstattung sowie das in den Medien kommunizierte Verhältnis von Staat und Bürgern. Darüber hinaus untersucht es die mögliche Interaktion von Öffentlichkeit und Gewalt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Staat, Gewalt und Medien, wobei das Verhältnis von Staat und Bürgern im Zentrum steht. Die Entführung von Susanne Osthoff dient als Fallbeispiel, um die Rolle der Medien in der öffentlichen Meinungsbildung und ihre Einflussnahme auf die Kommunikation zwischen Staat und Bürgern zu untersuchen. Weitere wichtige Themen sind die Analyse von Medieninhalten, die Untersuchung von Akteuren und Interessen sowie die Reflexion des Verhältnisses von Medien und Gewalt in einer Demokratie.
Häufig gestellte Fragen zu Staat, Gewalt und Medien
Welche Rolle spielen Medien in der Kommunikation zwischen Staat und Bürgern?
Medien fungieren als aktive Akteure, die Informationen filtern, Themen aufbereiten und somit das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern maßgeblich mitgestalten.
Wie wurde der Fall Susanne Osthoff in den Medien analysiert?
Die Arbeit untersucht die Berichterstattung der FAZ und der ZEIT Online während der Entführung, um Tendenzen der Meinungsbildung und die Selbstreflexion der Medien aufzuzeigen.
Können Medien Gewalt oder Terrorismus beeinflussen?
Ja, es besteht die Hypothese eines Wechselspiels zwischen öffentlicher Meinung und Gewalt, wobei die mediale Darstellung Auswirkungen auf politische Entscheidungen und die Wahrnehmung von Gewalt haben kann.
Was bedeutet mediale Selbstreflexion in Krisensituationen?
Damit ist gemeint, dass Medien ihr eigenes Verhalten und ihre Verantwortung im Kommunikationsprozess hinterfragen und bewerten, wie sie über Krisen berichten.
Warum ist die öffentliche Meinung für den Staat in Entführungsfällen wichtig?
Die öffentliche Meinung erzeugt Druck auf staatliche Akteure und kann den Handlungsspielraum der Regierung bei Verhandlungen oder sicherheitspolitischen Maßnahmen beeinflussen.
- Quote paper
- Anna Milena Jurca (Author), 2005, Staat, Gewalt und Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142753