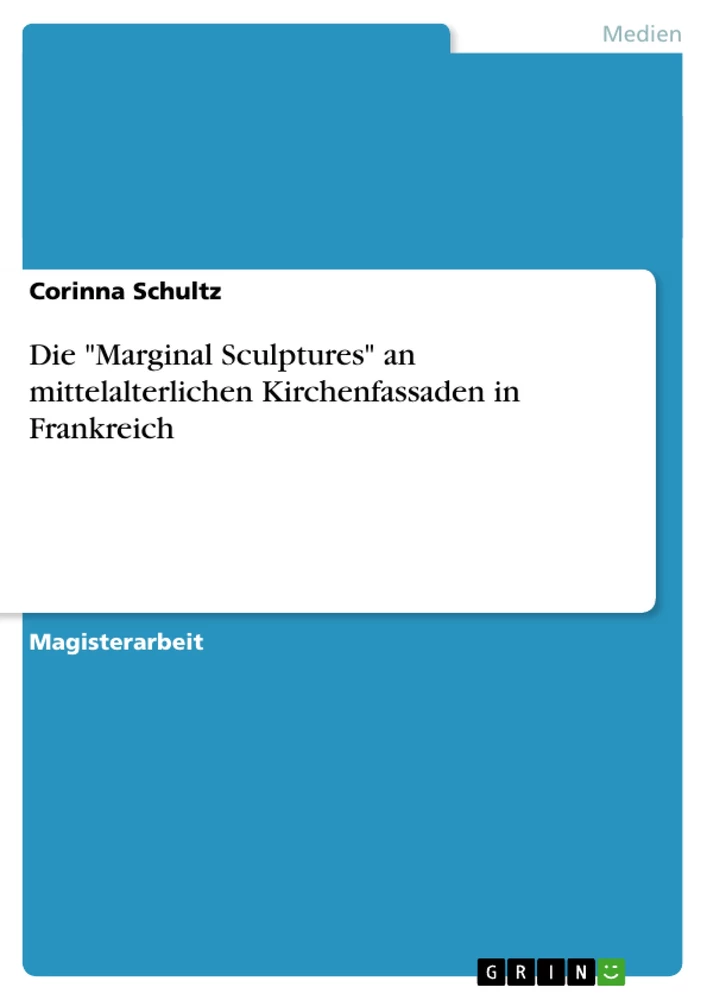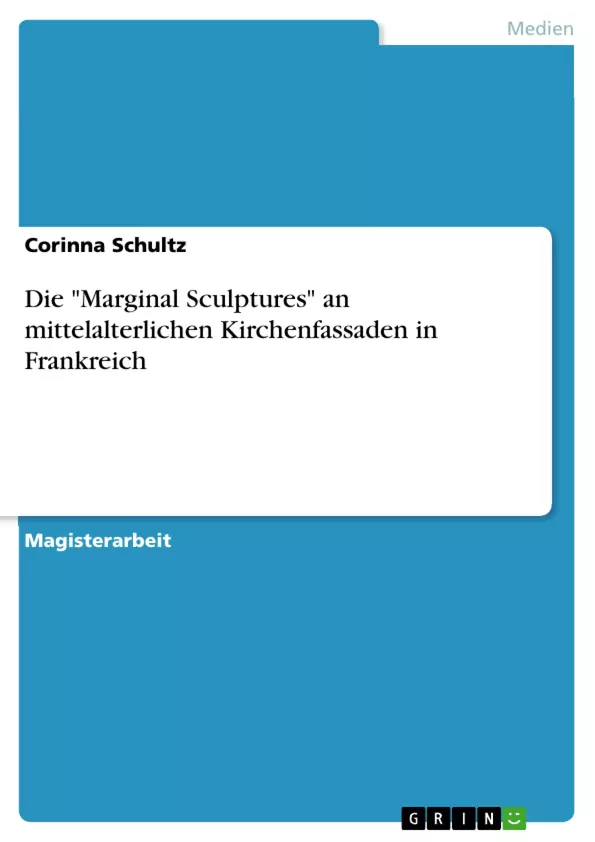Gewöhnlich spielen skulptierte Konsolsteine unter Kirchendächern eine Nebenrolle innerhalb der Forschungsliteratur, wenn sie sich mit der Ikonographie von mittelalterlichen Fassadenprogrammen auseinandersetzt. Die von fantasievollen Steinmetzen gestalteten Kragsteine treten zwar lediglich in einer kunsthistorisch gesehenen kurzen Zeitspanne auf, sind allerdings zahlreich in mehreren Ländern zu finden. Anhand ihrer Komposition und Themen, ihrer Ausdrucksmittel und Affinität zum volkstümlich-zeitgenössischen Gedankengut ermöglichen es die aus der Mauer hervortretenden, bebilderten Tragsteine auf die vorherrschenden, mittelalterlichen Glaubensvorstellungen zu schließen und ihre eigene Bedeutung zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Themen
- 2.1. Tiere
- 2.2. Fabelwesen und Teufel
- 2.3. Sonderform: Gargoyle
- 2.4. Spielleute und Artisten
- 2.5. Natürliche und künstliche Narren
- 2.6. Exhibitionisten
- 2.7. Emotionen wie Schmerz, Angst und Verzweiflung
- 2.8. Die körperlich Liebenden
- 2.9. Selbstporträts der Steinmetzen
- 3. Als Teil des Heilsplans
- 3.1. Die Spiegeltheorie
- 3.2. Ex negativo
- 3.3. Das Zwei-Staaten-Modell des Augustinus
- 3.4. Die Fastnacht als Gegenfest
- 4. Exkurs über Komik und das Lachen
- 5. Hässlichkeit als Ausdrucksmittel
- 6. Die Autorenfrage
- 7. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die „Marginal Sculptures“ an mittelalterlichen Kirchenfassaden in Frankreich. Ziel ist es, die Bedeutung dieser oft übersehenen Skulpturen im Kontext der mittelalterlichen Glaubensvorstellungen zu beleuchten und ihre ikonographische Vielfalt zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die romanischen Konsolfiguren.
- Ikonographie der „Marginal Sculptures“
- Bedeutung der Skulpturen im Kontext mittelalterlicher Glaubensvorstellungen
- Die Rolle von Komik und Hässlichkeit in der Darstellung
- Die Frage nach den Schöpfern der Skulpturen
- Die „Marginal Sculptures“ als visuelle Kommunikation für ungebildete Gläubige
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Marginal Sculptures“ ein, definiert den Begriff und beschreibt die geographische und zeitliche Verbreitung dieser Skulpturen. Sie hebt die Bedeutung der Arbeit hervor, die darin liegt, die ikonographische Vielfalt und die Bedeutung dieser oft vernachlässigten Elemente mittelalterlicher Architektur im Kontext der vorherrschenden Glaubensvorstellungen zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die romanischen Konsolfiguren, da ihre Bedeutung im gotischen Kontext anders zu sein scheint.
2. Die Themen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der verschiedenen ikonographischen Themen, die in den „Marginal Sculptures“ dargestellt sind. Von Tieren und Fabelwesen über groteske Gestalten und menschliche Figuren bis hin zu Darstellungen von Emotionen wird die breite Palette der dargestellten Motive systematisch untersucht und in ihren Kontext eingeordnet. Die Kapitel behandeln dabei nicht nur die einzelnen Motive isoliert, sondern analysieren auch ihre Komposition und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Darstellungen.
3. Als Teil des Heilsplans: Dieses Kapitel untersucht die möglichen Deutungen der „Marginal Sculptures“ im Kontext des mittelalterlichen Heilsplans. Verschiedene interpretative Ansätze werden diskutiert, darunter die Spiegeltheorie, die Betrachtung der Skulpturen als „ex negativo“ Darstellung des Bösen und die Einordnung in das Zwei-Staaten-Modell des Augustinus. Die Bedeutung der Fastnacht als Gegenfest wird ebenfalls im Zusammenhang mit den dargestellten Motiven erörtert. Das Kapitel verbindet die ikonographischen Elemente mit theologischen und gesellschaftlichen Konzepten des Mittelalters.
4. Exkurs über Komik und das Lachen: Dieser Exkurs beleuchtet die Rolle der Komik in den „Marginal Sculptures“ und deren Bedeutung für die Rezeption der Skulpturen durch die Bevölkerung. Die Verwendung von grotesken und humorvollen Elementen wird in Zusammenhang mit der religiösen und gesellschaftlichen Funktion dieser Bildwerke gesetzt. Das Kapitel thematisiert, wie Komik verwendet wurde, um religiöse Botschaften zu vermitteln oder soziale Kommentare abzugeben.
5. Hässlichkeit als Ausdrucksmittel: Das Kapitel untersucht die Verwendung von Hässlichkeit als stilistisches Mittel in den „Marginal Sculptures“. Es wird erörtert, welche Bedeutung die Darstellung von Hässlichkeit im mittelalterlichen Kontext hatte und wie sie zur Vermittlung religiöser oder gesellschaftlicher Botschaften beigetragen hat. Der Bezug zu Konzepten des Bösen und der Versuchung wird hier genauer beleuchtet.
6. Die Autorenfrage: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Identität und dem künstlerischen Hintergrund der Schöpfer der „Marginal Sculptures“. Es werden verschiedene Hypothesen und Ansätze zur Klärung dieser Frage diskutiert. Das Kapitel geht auf die Frage ein, ob die Schöpfer der Skulpturen professionelle Steinmetze oder Laien waren und welche Rolle dies für die Stilistik und die Bedeutung der Werke gespielt hat.
Schlüsselwörter
Marginal Sculptures, mittelalterliche Skulptur, Frankreich, romanische Architektur, Ikonographie, Glaubensvorstellungen, Komik, Hässlichkeit, Steinmetze, Heilsplan, ex negativo, Spiegeltheorie, volkstümliches Gedankengut.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: „Marginal Sculptures“ an mittelalterlichen Kirchenfassaden in Frankreich
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die „Marginal Sculptures“, also die oft übersehenen Skulpturen an mittelalterlichen Kirchenfassaden in Frankreich, insbesondere die romanischen Konsolfiguren. Sie untersucht deren Bedeutung im Kontext mittelalterlicher Glaubensvorstellungen und analysiert die ikonographische Vielfalt dieser Skulpturen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Palette an Themen, darunter die Ikonographie der Skulpturen (Tiere, Fabelwesen, Teufel, Gargoyles, Spielleute, Artisten, Narren, Exhibitionisten, Liebende, Selbstporträts der Steinmetze etc.), deren Bedeutung im Kontext des mittelalterlichen Heilsplans (Spiegeltheorie, Ex negativo, Augustinus’ Zwei-Staaten-Modell, Fastnacht als Gegenfest), die Rolle von Komik und Hässlichkeit in der Darstellung, die Frage nach den Schöpfern der Skulpturen und die „Marginal Sculptures“ als visuelle Kommunikation für ungebildete Gläubige.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, detaillierte Analyse der ikonographischen Themen, Deutung der Skulpturen im Kontext des mittelalterlichen Heilsplans, Exkurs über Komik und Lachen, Hässlichkeit als Ausdrucksmittel, die Autorenfrage und Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Jedes Kapitel bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem spezifischen Aspekt der „Marginal Sculptures“.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der „Marginal Sculptures“ aufzuzeigen, die oft vernachlässigt werden. Sie möchte ihre ikonographische Vielfalt analysieren und ihre Rolle im Kontext der mittelalterlichen Glaubensvorstellungen beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Interpretation der Komik und Hässlichkeit in den Darstellungen und der Klärung der Frage nach den Schöpfern der Skulpturen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Marginal Sculptures, mittelalterliche Skulptur, Frankreich, romanische Architektur, Ikonographie, Glaubensvorstellungen, Komik, Hässlichkeit, Steinmetze, Heilsplan, ex negativo, Spiegeltheorie, volkstümliches Gedankengut.
Wie wird die Bedeutung der Skulpturen im Kontext des mittelalterlichen Heilsplans untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene interpretative Ansätze, wie die Spiegeltheorie, die Darstellung des Bösen „ex negativo“, das Zwei-Staaten-Modell des Augustinus und die Fastnacht als Gegenfest, um die Bedeutung der „Marginal Sculptures“ im Kontext des mittelalterlichen Heilsplans zu beleuchten.
Welche Rolle spielen Komik und Hässlichkeit in den Skulpturen?
Die Arbeit analysiert die Verwendung von Komik und Hässlichkeit als stilistische Mittel. Sie untersucht, wie diese Elemente zur Vermittlung religiöser Botschaften oder sozialer Kommentare beigetragen haben und welche Bedeutung sie im mittelalterlichen Kontext hatten.
Wer waren die Schöpfer der Skulpturen?
Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Identität der Schöpfer. Sie diskutiert verschiedene Hypothesen und untersucht, ob es sich um professionelle Steinmetze oder Laien handelte und welchen Einfluss dies auf die Stilistik und Bedeutung der Werke hatte.
- Quote paper
- M.A. Corinna Schultz (Author), 2009, Die "Marginal Sculptures" an mittelalterlichen Kirchenfassaden in Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142833