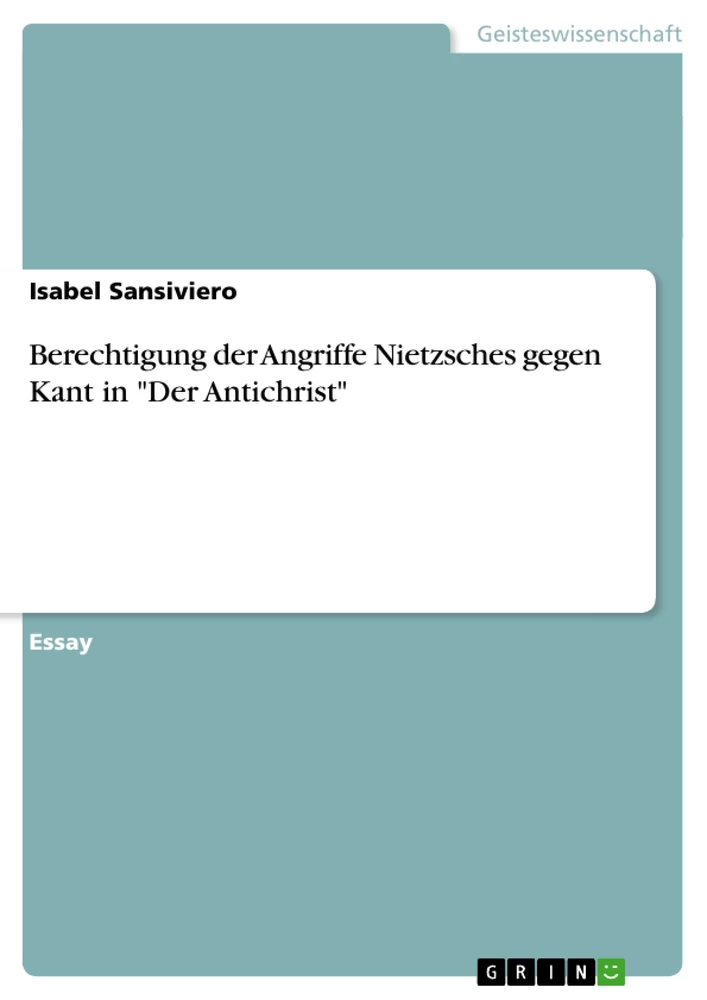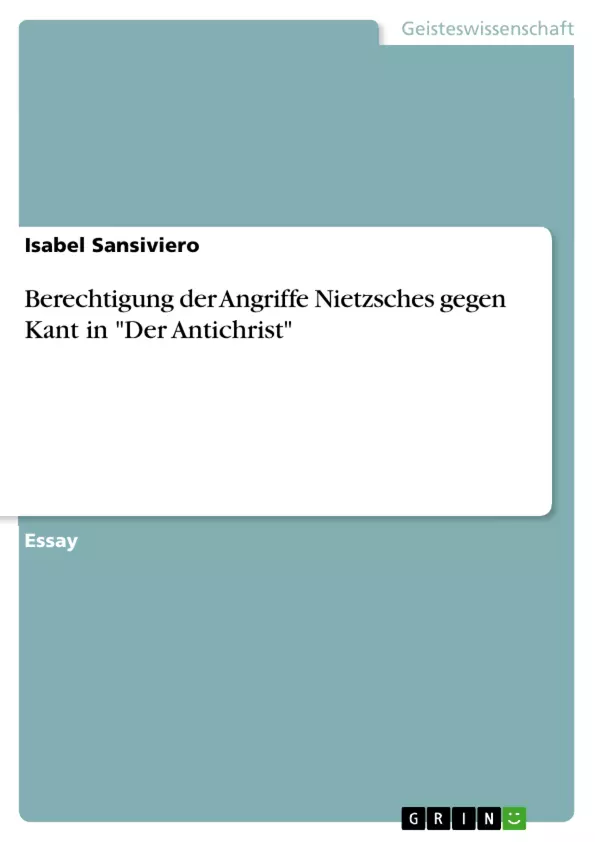Das für Nietzsche Verwerfliche ist aber der nächste Schritt, den Kant vollzieht. Kant beginnt nämlich damit, seine ganze Moralkonzeption unter anderem auf der Vernunft zu begründen. Eine Vernunft, die er weder irgendwann einmal definiert, noch näher für sie argumentiert hat. Er setzt sie einfach als eine gegebene Tatsache voraus. Und hier muss ich Nietzsche zustimmen, wenn er über Kants neue Moral sagt: „ (...) wenn nicht beweisbar, so doch nicht mehr widerlegbar...“ Kants Moral ist, so wie Nietzsche ganz richtig erkennt, nicht beweisbar. Jedoch ist sie genauso wenig widerlegbar, denn um diese Moral widerlegen zu können...
Inhaltsverzeichnis
- Berechtigung der Angriffe Nietzsches gegen Kant in Der Antichrist
- Einleitung
- Kants Moralkonzeption: Eine Gefahr für das deutsche Volk?
- Nietzsches Kritik an Kants Vernunftbegriff
- Die Unmöglichkeit der Widerlegung von Kants Moral
- Die „vollkommen erlogne Welt“ der konstruierten Moral
- Die Kritik an Kants Tugendbegriff
- Individuelle Moral vs. allgemeine Moral
- Die Schädlichkeit der Verallgemeinerung
- Der kategorische Imperativ als Fremdbestimmung
- Unpersönlichkeit und die Gefahr der Verallgemeinerung
- Kants Moral: Schädlich für den Einzelnen und die Rasse
- Der Stärkere und der Schwächere
- Das Gesetz des Stärkeren
- Die Folgen der Unterdrückung der eigenen Instinkte
- Der Untergang der Rasse durch die Moral Kants
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die Berechtigung der Angriffe Friedrich Nietzsches gegen Immanuel Kants Moralkonzeption in seinem Werk „Der Antichrist“. Der Fokus liegt dabei auf den Abschnitten 10 und 11 des „Antichristen“ im Vergleich zur Kantschen Moralphilosophie in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“.
- Kritik an Kants Vernunftbegriff und der Unmöglichkeit, seine Moral zu widerlegen
- Analyse der Schädlichkeit von Kants Moral für den Einzelnen und die Rasse
- Die Bedeutung des Instinkts gegenüber der Vernunft in Nietzsches Philosophie
- Diskussion der Unpersönlichkeit von Kants Moral und die Gefahr der Verallgemeinerung
- Das Verhältnis von individueller und allgemeiner Moral in der Kritik Nietzsches
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus auf Nietzsches Kritik an Kant in „Der Antichrist“ legt und die Relevanz der Analyse von §10 und §11 des Werks für die Argumentation hervorhebt. Im nächsten Kapitel werden die Vorwürfe Nietzsches gegen Kants Moralkonzeption im Detail betrachtet. Es wird insbesondere auf die Kritik am Vernunftbegriff und die Unmöglichkeit der Widerlegung von Kants Moral eingegangen. Des Weiteren wird erläutert, warum Nietzsche Kants Moral als eine „vollkommen erlogne Welt“ ansieht, die auf einer konstruierten Realität basiert.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit Nietzsches Kritik an Kants Tugendbegriff. Es werden die Unterschiede zwischen individueller und allgemeiner Moral herausgearbeitet und die Schädlichkeit der Verallgemeinerung in Kants Moralkonzeption aufgezeigt. Besonderes Augenmerk wird auf den kategorischen Imperativ als einen Mechanismus der Fremdbestimmung gelegt. Schließlich wird die Unpersönlichkeit von Kants Moral im Kontext der Gefahr der Verallgemeinerung beleuchtet.
Der Essay endet mit einem Kapitel, das sich mit den Folgen von Kants Moral für den Einzelnen und die Rasse auseinandersetzt. Hier wird die Kritik Nietzsches am Gesetz des Stärkeren und die Auswirkungen der Unterdrückung der eigenen Instinkte diskutiert. Es wird argumentiert, dass Kants Moral den Untergang der Rasse befördert, da sie den Einzelnen dazu zwingt, seine Stärke aufzugeben und die Schwäche zu fördern.
Schlüsselwörter
Der Essay beschäftigt sich mit den Kernpunkten der Moralphilosophie von Immanuel Kant und Friedrich Nietzsche. Die Analyse konzentriert sich auf zentrale Begriffe wie Vernunft, Tugend, Instinkt, Verallgemeinerung, Fremdbestimmung, Unpersönlichkeit, Stärkerer und Schwacher. Die Kritik Nietzsches an Kant steht im Mittelpunkt, wobei Themen wie die Gefahr der Unterdrückung der eigenen Instinkte und die Folgen der Verallgemeinerung für den Einzelnen und die Rasse beleuchtet werden.
- Quote paper
- Isabel Sansiviero (Author), 2008, Berechtigung der Angriffe Nietzsches gegen Kant in "Der Antichrist", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142883