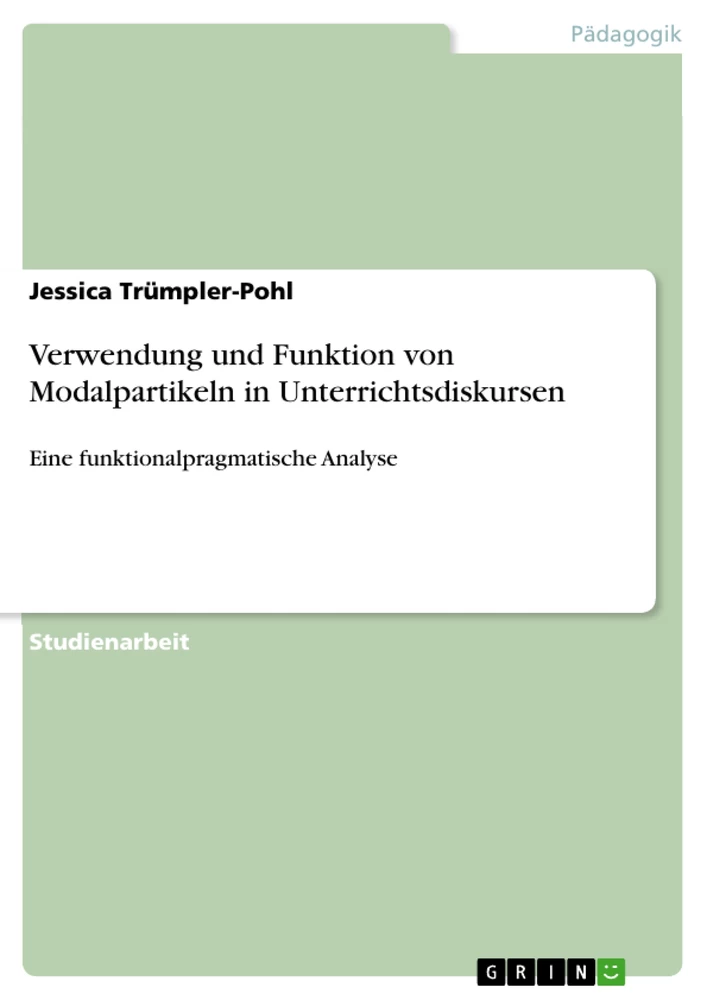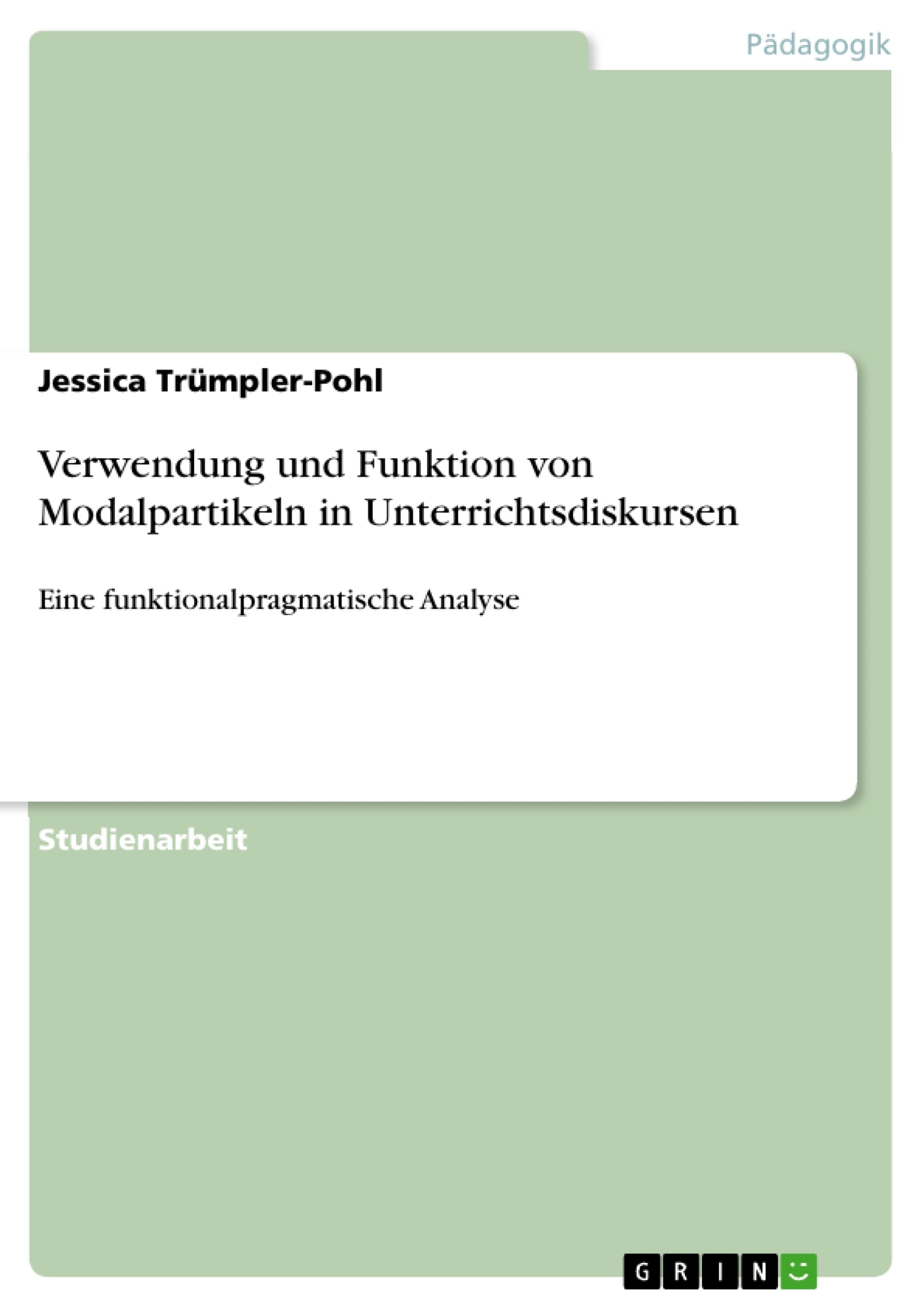In der vorliegenden Arbeit wird die Frage erörtert, inwiefern die sprecherseitige Verwendung von Partikeln den Hörer steuert und welches Verhalten dadurch beim Hörer erzielt werden kann. Es werden die einzelnen Funktionen der Partikeln herausgearbeitet und untersucht, in welchen Zusammenhängen sie auftreten. Grundlage dieser Fragestellung ist ein Lehr-Lern-Diskurs mit einem 7-jährigen Jungen aus der ersten Klasse, der während dieser privaten Förderstunde in Form von Audioaufnahmen aufgezeichnet wurde. In einem weiteren Schritt wurde von dieser Tonaufnahme ein schriftliches Transkript erstellt. Die Relevanz der Fragestellung ergibt sich aus der Reflexion des Lehr-Lern-Diskurses insbesondere aus der Sicht der Lehrenden, indem die Fragestellung von der anderen Seite betrachtet, untersucht und beantwortet werden kann: Mit welchen sprachlichen Mitteln schafft es die Lehrperson, den Lernenden zur Mitarbeit zu motivieren? Weiterhin soll in diesem Zusammenhang untersucht werden, ob der Gebrauch der Partikeln Auswirkungen auf das Verständnis hat oder ob sie auch weggelassen werden könnten.
Die methodische Vorgehensweise ist funktional-pragmatisch, da der Fokus auf den gesellschaftlichen Funktionen, dem Zweck des sprachlichen Handelns liegt und während der Analyse illokutive Indikatoren in der Tiefenstruktur herausgearbeitet werden.9 Im folgenden Abschnitt werden zunächst einige theoretische Begriffe eingeführt und erläutert, bevor im anschließenden Teil einzelne Transkriptausschnitte in Bezug auf die Fragestellung analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Funktionale Pragmatik
- Begriffe der Konversationsanalyse
- Die Hörersteuerung in Vor- und Nachschaltungen
- Die Modalpartikeln
- Analyse einzelner Ausschnitte des Transkripts
- Datengrundlage, Unterrichtskontext und methodisches Vorgehen
- Analyse des Lehr-Lern-Diskurses
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung und Funktion von Modalpartikeln in Unterrichtsdiskursen aus funktional-pragmatischer Perspektive. Sie erörtert, wie die sprecherseitige Verwendung von Partikeln den Hörer steuert und welches Verhalten dadurch beim Hörer erzielt werden kann.
- Funktional-pragmatische Analyse von Modalpartikeln in Unterrichtsdiskursen
- Untersuchung der Hörersteuerung durch Modalpartikeln
- Herausschälung der einzelnen Funktionen von Modalpartikeln
- Analyse von Modalpartikeln in einem konkreten Lehr-Lern-Diskurs
- Reflexion der Rolle der Lehrperson in der sprachlichen Steuerung des Lernenden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Analyse von Unterrichtsdiskursen. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die funktionale Pragmatik, die Konversationsanalyse, die Hörersteuerung und die Modalpartikeln näher beleuchtet. Kapitel 3 analysiert einzelne Ausschnitte des Transkripts eines Lehr-Lern-Diskurses und untersucht die Funktion der Modalpartikeln im Kontext der Interaktion zwischen Lehrer und Schüler. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Modalpartikeln, Unterrichtsdiskurs, funktionale Pragmatik, Hörersteuerung, Lehr-Lern-Diskurs, Gesprächsforschung, Transkription, HIAT, Sprachvermittlung, sprachliches Handeln, illokutive Indikatoren.
- Quote paper
- Jessica Trümpler-Pohl (Author), 2023, Verwendung und Funktion von Modalpartikeln in Unterrichtsdiskursen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1430718