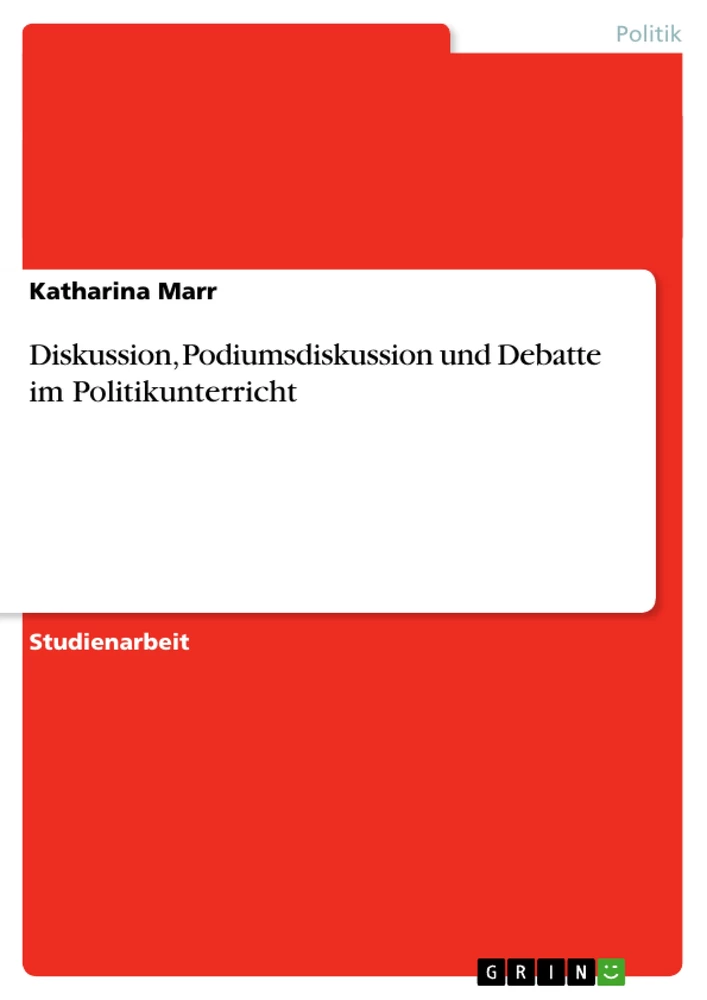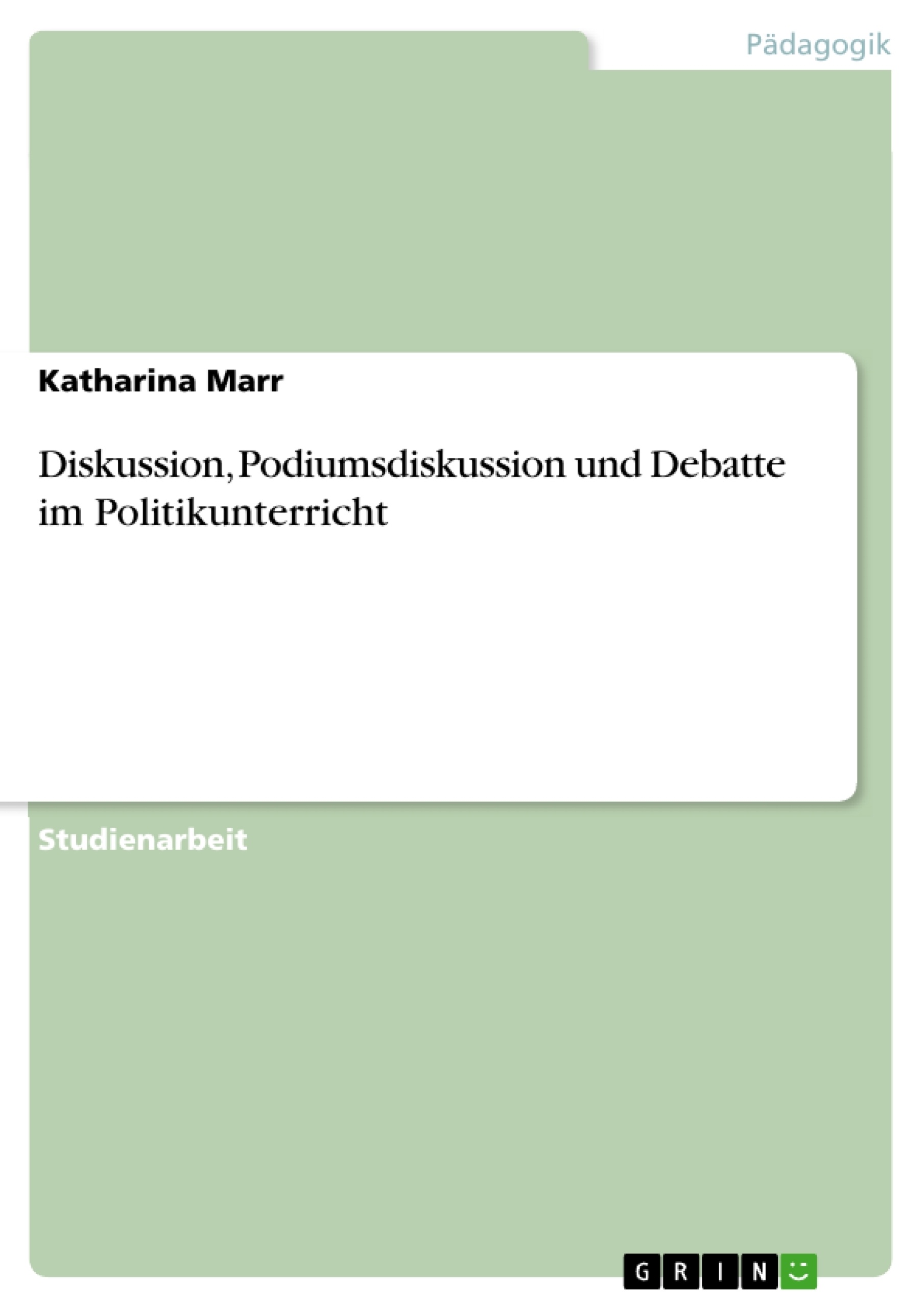Seit jeher übernimmt die Schule als eine der wichtigsten Sozialisationsinstanzen die Aufgabe, den Heranwachsenden mittels Bildung und Vermittlung von kulturell- spezifischen Fertig- und Fähigkeiten in die Gesellschaft vollends zu integrieren. In einer westlichen demokratisch organisierten Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland beinhaltet jene gesellschaftliche Integration die Erziehung zum Kulturbürger, welcher alle Rollen wie Familien-, Konsum- und Politikbürger in sich vereint. Die Grundlage des demokratischen Staates bildet der mündige, partizipationsfähige, politisch aktive Bürger. So kann der Bestand der Gesellschaft nur durch die Teilnahme am öffentlichen Leben gesichert werden. Deshalb fördert und bildet die Schule beim Schüler Kompetenzen der politischen Urteils-, Handlungs- und Methodenfähigkeit aus. Jene Kompetenzen ermöglichen es dem Heranwachsenden, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden und sich mit dieser kritisch- produktiv auseinander zu setzen und somit den Bestand der Demokratie zu sichern. Kernauftrag politischer Bildung ist demnach die Förderung und Ausbildung der politischen Partizipationsfähigkeit.
Der Politik- oder auch Sozialkundeunterricht macht es sich im Speziellen zur Aufgabe, oben genannte Fähigkeiten als Kennzeichen der politischen Mündigkeit auszubilden. Der Lehrer soll den Schüler im Fach Sozialkunde ‚erstmals’ mit Politik bekannt machen, beim Lernenden Neugier und Sympathie für politische Prozesse und Geschehnisse wecken. Hierbei stehen drei relevante Lernziele zum Erreichen politischer Mündigkeit im Vordergrund, die als Grundfähigkeiten der politischen Mündigkeit gelten: Im Politikunterricht lernt der Schüler, sich selbstständig über Politik zu informieren und über politische Sachverhalte kritisch zu urteilen sowie eigenständig zu einer begründeten Meinung über diese zu gelangen.
Grundlage jener Arbeit soll deshalb die Erörterung der Mikromethode des Unterrichtsgesprächs hinsichtlich der oben genannten Lernziele sein. Insbesondere sind die Diskussion, die Podiumsdiskussion sowie die Debatte Gegenstand der Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 0.1 Exposition
- 0.2 Methodische und inhaltliche Vorgehensweise
- 1 Kommunikation im Unterricht
- 1.1 Axiome der Kommunikation
- 1.1.1 Beziehungs- und Sachebene
- 1.1.2 Unterrichtsgespräch und Fachdidaktik
- 1.2 Kommunikation im Politikunterricht
- 1.2.1 Relevanz des Unterrichtsgesprächs im Sozialkundeunterricht
- 1.2.2 Politische Urteilsbildung in der Schule
- 1.3 Typisierung von Gesprächsformen in der Politikdidaktik
- 1.3.1 Offenes Unterrichtsgespräch
- 1.3.2 Gelenkte Schulkommunikation
- 1.3.3 Geregeltes Gespräch im Unterricht
- 2 Diskursive und dialogische Verständigungsformen im Fach Sozialkunde
- 2.1 Diskussion
- 2.1.1 Begriffsklärung
- 2.1.2 Ziele und Aufgaben
- 2.1.3 Vorbereitung- Verlauf- Nachbereitung
- 2.1.4 Probleme
- 2.1.5 Praxisbeispiel
- 2.2 Podiumsdiskussion
- 2.2.1 Begriffsklärung
- 2.2.2 Die Podiumsdiskussion im Unterricht
- 2.2.3 Themenwahl und Durchführung
- 2.2.4 Beispiel aus dem Schulalltag
- 2.3 Debatte
- 2.3.1 Begriffsklärung
- 2.3.1.1 Pro- und Kontra- Debatte
- 2.3.1.2 Debatte
- 2.3.2 Fachdidaktische Aufgaben und Intentionen
- 2.3.3 Planung und Ablauf
- 2.3.3.1 Pro- und Kontra- Debatte
- 2.3.3.2 Debatte
- 2.3.4 Schwierigkeiten und Nachteile
- 2.3.5 Beispiele aus dem Politikunterricht
- 2.3.5.1 Pro- und Kontra- Debatte
- 2.3.5.2 Debatte
- 3 Zusammenfassendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden der politischen Bildung im Unterricht, insbesondere Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte. Ziel ist es, geeignete Methoden aufzuzeigen, die Schüler zu politischer Urteils- und Entscheidungsfähigkeit befähigen und alle drei Kompetenzbereiche (Sozial-, Sach- und Methodenkompetenz) fördern.
- Kommunikation im Politikunterricht und ihre Axiome
- Diskussion als Methode der politischen Bildung
- Podiumsdiskussion im Unterricht: Planung, Durchführung und Beispiele
- Debatte als Unterrichtsmethode: Pro- und Kontra-Debatten
- Förderung politischer Mündigkeit durch geeignete Unterrichtsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung politischer Bildung für die Integration in eine demokratische Gesellschaft. Sie betont die Notwendigkeit, Schülern Kompetenzen in politischer Urteilsbildung, Handlungsfähigkeit und Methodenkompetenz zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der Suche nach geeigneten Unterrichtsmethoden, die diese Kompetenzen fördern und gleichzeitig ein positives Lernerlebnis gewährleisten.
1 Kommunikation im Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Kommunikation im Unterricht, insbesondere im Kontext des Politikunterrichts. Es analysiert die Axiome der Kommunikation, die Relevanz des Unterrichtsgesprächs für die politische Urteilsbildung und typische Gesprächsformen im Unterricht (offenes Unterrichtsgespräch, gelenkte Schulkommunikation, geregeltes Gespräch). Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Kommunikationskompetenz als Grundlage für politische Teilhabe.
2 Diskursive und dialogische Verständigungsformen im Fach Sozialkunde: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Methoden der politischen Diskussion im Unterricht: Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte. Für jede Methode werden Begriffsklärungen, Ziele, Planung, Durchführung und mögliche Probleme detailliert beschrieben und an Praxisbeispielen veranschaulicht. Es wird die Bedeutung dieser Methoden für die Entwicklung von Argumentationsfähigkeit, perspektivischem Denken und Kommunikationsfähigkeit im politischen Kontext hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Politische Bildung, Politikunterricht, Sozialkundeunterricht, Kommunikation, Diskussion, Podiumsdiskussion, Debatte, Methodenkompetenz, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Politische Urteilsbildung, Partizipation, Demokratie, Mündigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Methoden der politischen Bildung im Unterricht
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert verschiedene Methoden der politischen Bildung im Unterricht, insbesondere Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte. Es untersucht, wie diese Methoden Schüler*innen zu politischer Urteils- und Entscheidungsfähigkeit befähigen und alle drei Kompetenzbereiche (Sozial-, Sach- und Methodenkompetenz) fördern.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: Einleitung, Kommunikation im Unterricht und Diskursive und dialogische Verständigungsformen im Fach Sozialkunde. Die Einleitung beschreibt den Kontext und die Zielsetzung. Kapitel 1 behandelt die Grundlagen der Kommunikation im Politikunterricht. Kapitel 2 analysiert Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte als Unterrichtsmethoden detailliert. Ein abschließendes Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Kommunikationsformen im Unterricht werden behandelt?
Das Dokument analysiert verschiedene Kommunikationsformen, darunter offene Unterrichtsgespräche, gelenkte Schulkommunikation, geregelte Gespräche sowie spezifische Methoden wie Diskussionen, Podiumsdiskussionen und Debatten (inklusive Pro- und Kontra-Debatten). Die Axiome der Kommunikation und ihre Relevanz für die politische Urteilsbildung werden ebenfalls beleuchtet.
Wie werden Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte im Detail beschrieben?
Für jede Methode (Diskussion, Podiumsdiskussion, Debatte) werden Begriffsklärungen, Ziele, Planung, Durchführung und mögliche Probleme detailliert dargestellt und an Praxisbeispielen veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Methoden für die Entwicklung von Argumentationsfähigkeit, perspektivischem Denken und Kommunikationsfähigkeit im politischen Kontext.
Welche Kompetenzen sollen durch die beschriebenen Methoden gefördert werden?
Die beschriebenen Methoden zielen auf die Förderung von Methodenkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz ab. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der politischen Urteilsbildung und die Befähigung der Schüler*innen zu politischer Handlungsfähigkeit und Partizipation in einer demokratischen Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Politische Bildung, Politikunterricht, Sozialkundeunterricht, Kommunikation, Diskussion, Podiumsdiskussion, Debatte, Methodenkompetenz, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Politische Urteilsbildung, Partizipation, Demokratie, Mündigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, geeignete Methoden der politischen Bildung aufzuzeigen, die Schüler*innen zu politischer Urteils- und Entscheidungsfähigkeit befähigen. Es soll Lehrkräften Hilfestellungen geben, wie sie durch den Einsatz verschiedener Methoden die politische Mündigkeit ihrer Schüler*innen fördern können.
- Quote paper
- Katharina Marr (Author), 2008, Diskussion, Podiumsdiskussion und Debatte im Politikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143091