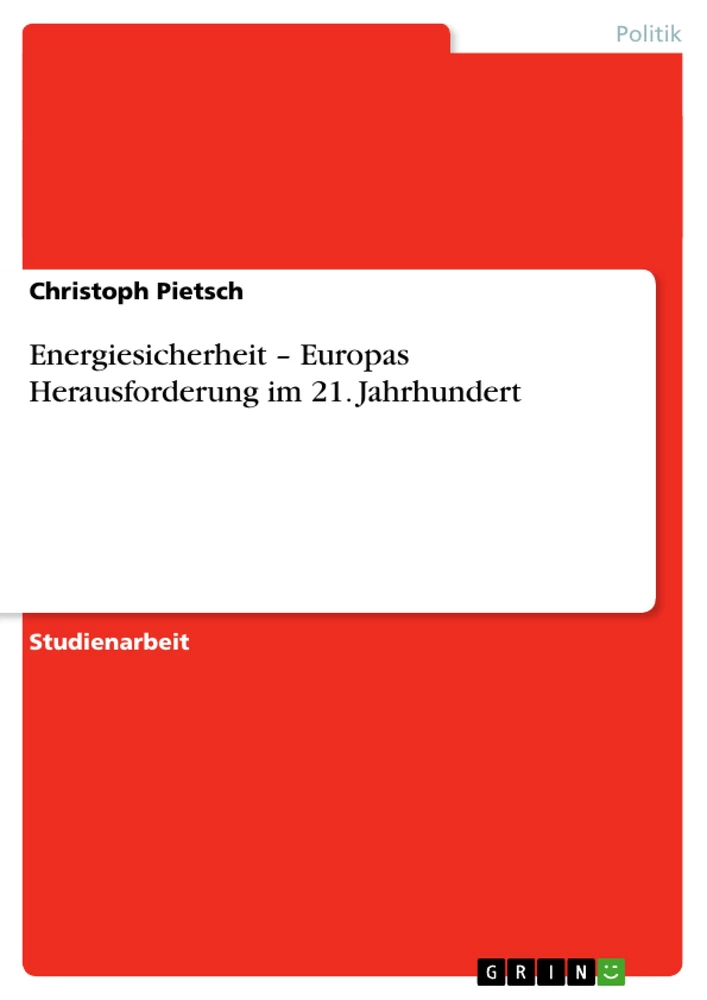Das Thema Energieversorgungssicherheit ist spätestens seit dem Gaskonflikt zwischen Russland und der Ukraine im Winter 2005/2006 wieder auf der europäischen Agenda. Erst im Januar 2009 wurde der alten Welt erneut vorgeführt, wie groß die Abhängigkeit von Energieimporten ist. Energieversorgungssicherheit ist eng mit dem Thema Energieimportabhängigkeit verknüpft. Für die Europäische Union (EU) wird die Abhängigkeit von Importen von derzeit 50 Prozent des Primärenergieverbrauchs auf bis zu 70 Prozent bis 2030 anwachsen. Insgesamt werden aktuell 45 Prozent der Einfuhren von Erdöl aus der Region Naher und Mittlerer Osten und 40 Prozent des gesamten Ergasbedarfs aus Russland bezogen. Die gesamte Wirtschaftskraft und der Einfluss in der internationalen Politik der „alten Welt“ sind von der kontinuierlichen Versorgung mit Energie abhängig. Die europäischen Lagerstätten (z. B. in Norwegen) reichen schon lange nicht mehr aus, um dem Bedarf nachzukommen. Seit einiger Zeit konzentriert sich die EU deshalb auf eine strategische Ellipse im asiatisch-arabischen Raum. Dabei haben soziale Unruhen, Regimewechsel und Bürgerkriege, aber auch zwischenstaatliche Militärkonflikte Auswirkungen auf eine sichere Versorgung. Es kommt zu einer Verschiebung der Kräfte in der Welt. Durch die Verknappung des Angebots wird die Position der Förder- und Lieferländer deutlich gestärkt, da sie ihre Energielieferungen in die attraktivsten Märkte lenken können. Europäische Abnehmer müssen sich mittelfristig wieder auf Rohölpreise jenseits der 150 US-Dollar pro Barrel einstellen. Insofern ist die Sicherstellung einer kontinuierlichen und ausreichenden Energieversorgung eine der zentralen Herausforderungen im 21. Jahrhunderts für die EU und Deutschland. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage nach den Möglichkeiten, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. Dabei sind die außenpolitischen Entwicklungen und die Marktverschiebungen nicht die einzigen Faktoren mit Brisanz für die Versorgung. Auch der technologische Fortschritt erhebliche Bedeutung. Durch ihn wird eine effizientere Nutzung von Energie ermöglicht und eventuell werden neue Perspektiven der Energieerzeugung aufgezeigt. Fragen der Klimapolitik und des technischen Fortschritts wurden bei dieser Arbeit außer Acht gelassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - außen- und sicherheitspolitische Dimension des Themas Energiesicherheit
- Anlage der Arbeit
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Energiesicherheit
- Steigende Energienachfrage
- Konflikttypen
- Knappheitskonflikte
- Konflikte durch Verfügbarkeit, Verteilung und Gerechtigkeit
- Konflikte durch das Risiko der Ressourcennutzung
- Ziel-Mittel-Konflikte
- Energiesicherheit im 21. Jahrhundert
- Schrumpfende Vorräte - steigender Bedarf. Wie weit reichen die Ressourcen?
- Die Bedeutung fossiler Energieträger
- Steigende Importabhängigkeit und die Folgen
- Risiken der zukünftigen Energieversorgungssicherheit
- Hohe Energiepreise
- Gefahr terroristischer Anschläge
- Bundesinnenministerium (BMI) – nationale Scherung kritischer Energieinfrastrukturen
- Kritische Infrastrukturen - Definition und Zuständigkeit
- Energieversorgungssektor als Schlüsselinfrastruktur
- Elektrizität, Mineralöl & Gas als Aspekte der Inneren Sicherheit
- Prävention und Schutz kritischer Infrastrukturen
- Kollektive Zukunftsaufgaben für Staat und Wirtschaft
- Ausgewählte Aspekte supra- und transnationaler Koordination von Energie auf der EU-Ebene
- Russland – ein zuverlässiger Partner?
- Eine gemeinsame europäische Energieaußenpolitik
- Südosteuropa als wichtige Transitregion
- Die Rolle der NATO in der Energiesicherheit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der außen- und sicherheitspolitischen Dimension des Themas Energiesicherheit und analysiert die Herausforderungen, die sich aus der steigenden Energienachfrage und den schrumpfenden Ressourcenvorräten ergeben. Dabei werden die wichtigsten Konflikttypen im Zusammenhang mit Energiesicherheit untersucht und die Rolle des Bundesinnenministeriums bei der Absicherung kritischer Energieinfrastrukturen in Deutschland beleuchtet.
- Die Bedeutung von Energiesicherheit für die internationale Politik
- Konflikte um Ressourcen und deren Nutzung
- Die Bedeutung fossiler Energieträger
- Die Herausforderungen der Energieversorgungssicherheit im 21. Jahrhundert
- Die Rolle des Bundesinnenministeriums im Bereich der Energieinfrastruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Energiesicherheit ein und erläutert die Relevanz dieser Thematik für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Im theoretischen Bezugsrahmen werden die grundlegenden Begriffe und Konzepte der Energiesicherheit definiert, die verschiedenen Konflikttypen im Zusammenhang mit Energiesicherheit untersucht und der steigende Bedarf an Energie in Verbindung mit schrumpfenden Ressourcenvorräten analysiert.
Die Kapitel 3 und 4 widmen sich den Herausforderungen der Energieversorgungssicherheit im 21. Jahrhundert. Kapitel 3 behandelt die Bedeutung fossiler Energieträger, die steigende Importabhängigkeit und die damit verbundenen Risiken. Kapitel 4 fokussiert auf die Rolle des Bundesinnenministeriums bei der Absicherung kritischer Energieinfrastrukturen in Deutschland.
Kapitel 5 behandelt ausgewählte Aspekte der supranationalen Koordination von Energie auf der EU-Ebene, darunter die Rolle Russlands als Energielieferant, die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik und die Bedeutung Südosteuropas als Transitregion.
Schlüsselwörter
Energiesicherheit, Ressourcenkonflikte, fossile Energieträger, Importabhängigkeit, Energieversorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen, Bundesinnenministerium, EU-Energiepolitik, Russland, Südosteuropa, NATO.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Energieimportabhängigkeit der EU?
Die Abhängigkeit liegt aktuell bei etwa 50 Prozent und wird laut Prognosen bis zum Jahr 2030 auf bis zu 70 Prozent des Primärenergieverbrauchs anwachsen.
Welche Regionen sind die Hauptlieferanten für Öl und Gas der EU?
Etwa 45 Prozent der Rohölimporte stammen aus dem Nahen und Mittleren Osten, während Russland rund 40 Prozent des gesamten Erdgasbedarfs deckt.
Was versteht man unter "kritischen Energieinfrastrukturen"?
Das sind Anlagen und Systeme (z. B. Stromnetze, Gasleitungen), deren Ausfall erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit und Wirtschaftskraft zur Folge hätte.
Welche Konflikttypen gefährden die Energiesicherheit?
Es wird unterschieden zwischen Knappheitskonflikten, Verteilungskonflikten, Risikokonflikten bei der Ressourcennutzung und Ziel-Mittel-Konflikten.
Welche Rolle spielt Russland in der europäischen Energiepolitik?
Russland ist ein zentraler, aber aufgrund politischer Spannungen (z. B. Gaskonflikt mit der Ukraine) auch kritisch betrachteter Partner für die Versorgungssicherheit.
Was ist die Aufgabe des Bundesinnenministeriums (BMI) in diesem Kontext?
Das BMI ist für den nationalen Schutz und die Sicherung kritischer Infrastrukturen zuständig, um die innere Sicherheit bei Energieengpässen zu gewährleisten.
- Quote paper
- Christoph Pietsch (Author), 2009, Energiesicherheit – Europas Herausforderung im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143558