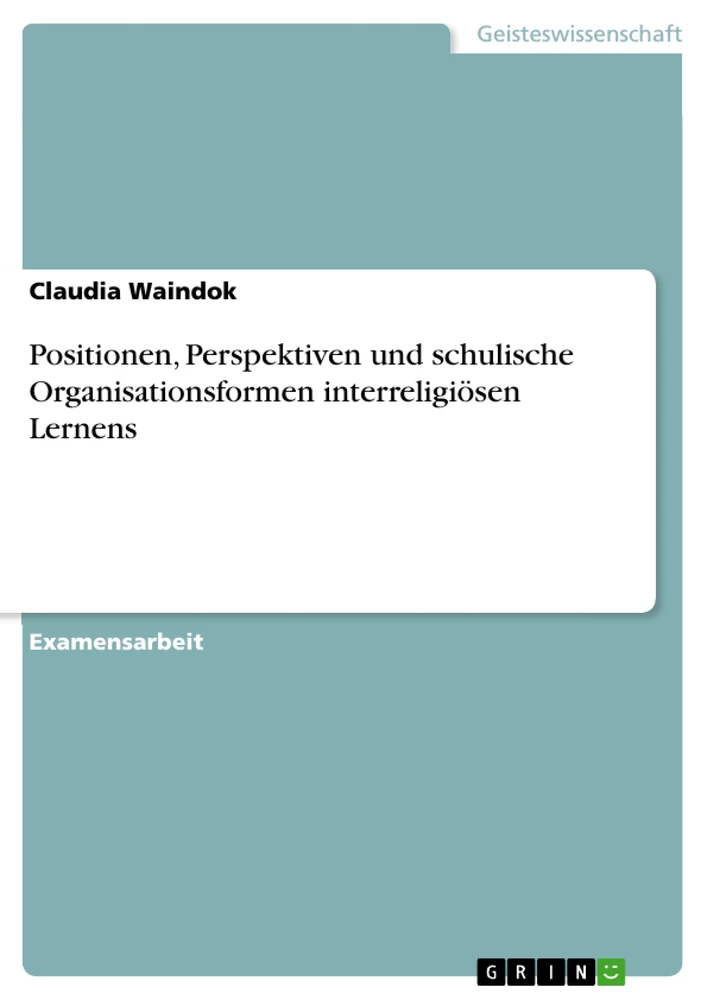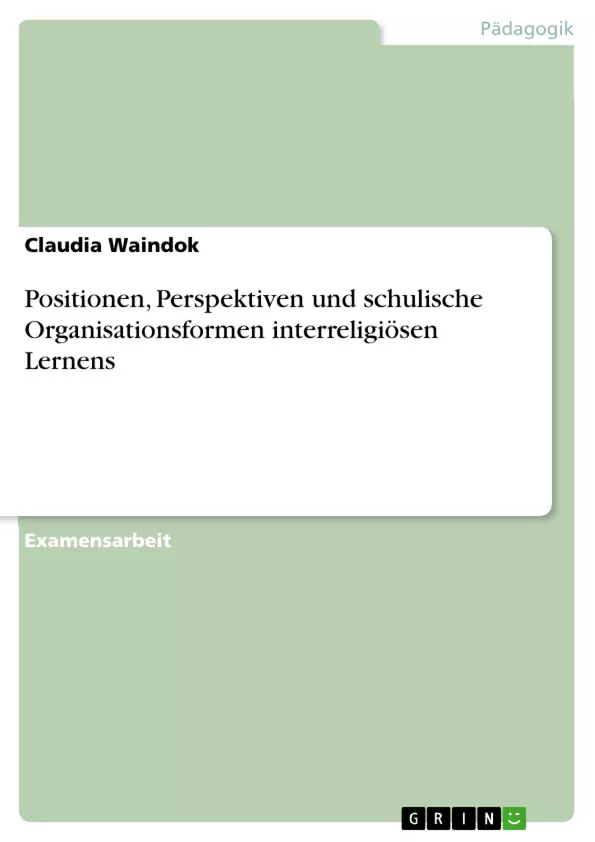Im Rahmen des ersten Staatsexamens beschäftigt sich diese schriftliche Arbeit mit dem Thema „Positionen, Perspektiven und schulische Organisations-formen des interreligiösen Lernens“.
Betrachtet man die heutige Gesellschaft, dann wird deutlich, dass sich diese in kultureller und religiöser Hinsicht seit geraumer Zeit verändert hat. Kinder, Jugendliche und Erwachsene leben in einer Welt, in der die Anwesenheit pluraler Kulturen und Religionen das Alltagsbild prägt und demnach nicht mehr auszublenden ist. Die veränderte Situation hat insbesondere Einfluss auf die heranwachsende Generation. Demzufolge ist es von herausragender Notwendigkeit, in Bildungseinrichtungen auf die religiös plurale Gesellschaft zu reagieren und interkulturelles sowie interreligiöses Lernen zu etablieren. Nur durch Aufklärung, Begegnung und gemeinsames Lernen können Missverständnissen und Unwissenheit über die fremden Kulturen und Religionen un-serer Mitbürger vorgebeugt werden, so dass die Gefahr der Verunsicherung und Intoleranz gegenüber Andersgläubigen gemindert wird. Interkulturelles und interreligiöses Lernen sowie die Fähigkeit zum interreligiösen Dialog gilt als Fundament, um auf ein Leben in einer dauerhaft kulturell und religiös pluralen Gesellschaft vorzubereiten.
Ziel der Arbeit ist es, vier der in Deutschland bereits praktizierten interreligiösen Religionsunterrichtsmodelle hinsichtlich ihrer Eignung zum interreligiösen Lernen sowie ihrer Zukunftsträchtigkeit zu analysieren. Überdies soll untersucht werden, ob sich aus den dargestellten Positionen Perspektiven für einen zukünftig bundesweit verbreiteten interreligiösen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ergeben.
Fragen, welche durch die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen aufgeworfen werden sowie Chancen und Grenzen in der schulischen Umsetzung werden zudem bearbeitet.
Aufgrund der besseren Lesbarkeit und Übersicht werden in dieser Arbeit ausschließlich männliche Termini verwendet. Gemeint sind natürlich stets beide Geschlechter. Ferner sind Zitate der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherung an die Begriffswelt des interreligiösen Lernens
- Interkulturelles Lernen
- Interreligiöses Lernen
- Interreligiöser Dialog
- Gegenwärtige Entwicklungen
- Globalisierung und Migration
- Säkularisierung und Individualisierung
- Gesellschaftlicher Wandel: Konfessionelles Milieu vs. Plurale Gesellschaft
- Religiosität von Kindern und Jugendlichen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
- Notwendigkeit eines interreligiösen Religionsunterrichts
- Das Christentum im Verhältnis zu außerchristlichen Religionen
- Religionstheologische Modelle des 20. Jahrhunderts
- Das Modell des Exklusivismus
- Das Modell des Inklusivismus
- Das Modell des Pluralismus
- Der Anspruch auf Absolutheit und Wahrheit der Religionen
- Absolutheitsanspruch
- Wahrheitsbegriff
- Die kirchliche Einstellung zu den nichtchristlichen Religionen
- Das Zweite Vatikanische Konzil und neuere Stellungnahmen
- Die Stimme der evangelischen Kirche
- Der Ökumenische Rat gegenüber dem interreligiösen Dialog
- Religionstheologische Modelle des 20. Jahrhunderts
- Interreligiöses Lernen in der gegenwärtigen Schule
- Interreligiöses Lernen in den Lehrplänen
- Kriterien für interreligiöses Lernen
- Ziele des interreligiösen Lernens
- Religionspädagogische Reaktionen auf eine multireligiöse Schülerschaft
- Das Modell der Würzburger Synode: Der konfessionelle Religionsunterricht
- Das Brandenburger Modell: LER - (Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde)
- Das Hamburger Modell: „Religionsunterricht für alle“
- Das Tübinger Modell: Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
- Exkurs: Die Fächergruppe
- Bilanz: Welches der vorgestellten Religionsunterrichtsmodelle eignet sich am besten für interreligiöses Lernen?
- Chancen und Grenzen des interreligiösen Lernens in der schulischen Umsetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Positionen, Perspektiven und Organisationsformen des interreligiösen Lernens im Kontext der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit und Relevanz von interreligiösem Lernen in einer zunehmend multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft.
- Die Entwicklung und Relevanz von interkulturellem und interreligiösem Lernen in einer globalisierten und multikulturellen Gesellschaft
- Die Rolle des Christentums im Verhältnis zu anderen Religionen und die unterschiedlichen Modelle des interreligiösen Dialogs
- Die Bedeutung des interreligiösen Lernens in der Schule, die Analyse verschiedener Unterrichtsmodelle und deren Eignung zur Förderung des interreligiösen Dialogs
- Chancen und Grenzen des interreligiösen Lernens in der schulischen Praxis
- Die Relevanz von interreligiösem Lernen für die Förderung von Toleranz, Verständnis und respektvollem Zusammenleben in einer multireligiösen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und betont die Bedeutung von interreligiösem Lernen in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und die Notwendigkeit, in Bildungseinrichtungen auf die religiöse Vielfalt zu reagieren.
Kapitel 2: Annäherung an die Begriffswelt des interreligiösen Lernens
Dieses Kapitel beleuchtet die Konzepte von interkulturellem und interreligiösem Lernen. Es untersucht die Bedeutung des interreligiösen Dialogs in der heutigen Gesellschaft.
Kapitel 3: Gegenwärtige Entwicklungen
Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Entwicklungen, die die Bedeutung des interreligiösen Lernens unterstreichen. Es untersucht die Auswirkungen von Globalisierung, Migration, Säkularisierung und Individualisierung auf das Zusammenleben in einer multireligiösen Gesellschaft.
Kapitel 4: Das Christentum im Verhältnis zu außerchristlichen Religionen
Dieses Kapitel betrachtet die verschiedenen religionstheologischen Modelle, die das Verhältnis des Christentums zu anderen Religionen beschreiben. Es analysiert die Bedeutung des Absolutheits- und Wahrheitsanspruchs der Religionen und untersucht die kirchliche Einstellung zum interreligiösen Dialog.
Kapitel 5: Interreligiöses Lernen in der gegenwärtigen Schule
Dieses Kapitel untersucht die Integration des interreligiösen Lernens in den aktuellen Schulbetrieb. Es analysiert die Lehrpläne, Kriterien und Ziele des interreligiösen Lernens in der Schule.
Kapitel 6: Religionspädagogische Reaktionen auf eine multireligiöse Schülerschaft
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Modelle des Religionsunterrichts in Deutschland, die auf die religiöse Pluralität in der Gesellschaft reagieren. Es bewertet die jeweiligen Modelle hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung des interreligiösen Lernens.
Kapitel 7: Chancen und Grenzen des interreligiösen Lernens in der schulischen Umsetzung
Dieses Kapitel beleuchtet die Chancen und Herausforderungen des interreligiösen Lernens in der schulischen Praxis. Es diskutiert die Umsetzung des interreligiösen Lernens und die damit verbundenen Fragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Interkulturelles Lernen, Interreligiöses Lernen, Interreligiöser Dialog, Religionspädagogik, Multikulturalität, Multireligiosität, Globalisierung, Migration, Säkularisierung, Individualisierung, Konfessionelles Milieu, Plurale Gesellschaft, Religionstheologie, Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus, Absolutheitsanspruch, Wahrheitsanspruch, Kirche, Christentum, Schulsystem, Religionsunterricht, Unterrichtsmodelle, Chancen und Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von interreligiösem Lernen in der Schule?
Ziel ist die Vorbereitung auf ein Leben in einer pluralen Gesellschaft durch Aufklärung, Begegnung und den Abbau von Vorurteilen gegenüber anderen Religionen und Kulturen.
Was unterscheidet Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus?
Exklusivismus sieht nur die eigene Religion als wahr an. Inklusivismus erkennt Spuren der Wahrheit in anderen Religionen, sieht die eigene aber als vollkommen. Pluralismus betrachtet alle Religionen als gleichwertige Wege zur Wahrheit.
Welche Modelle des Religionsunterrichts gibt es in Deutschland?
Bekannte Modelle sind der konfessionelle Unterricht (Würzburger Synode), "Religionsunterricht für alle" (Hamburg), LER (Brandenburg) und der konfessionell-kooperative Unterricht (Tübingen).
Was ist das "Hamburger Modell"?
In Hamburg wird ein gemeinsamer Religionsunterricht für alle Schüler unabhängig von ihrer Konfession oder Religion angeboten, um den interreligiösen Dialog direkt im Klassenzimmer zu fördern.
Welche Rolle spielt die Säkularisierung für den Religionsunterricht?
Durch die abnehmende Bindung an traditionelle Kirchen und die Individualisierung der Religiosität wächst der Bedarf an Unterrichtsformen, die religiöse Orientierung in einer multireligiösen Welt bieten.
- Quote paper
- Claudia Waindok (Author), 2009, Positionen, Perspektiven und schulische Organisationsformen interreligiösen Lernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143597