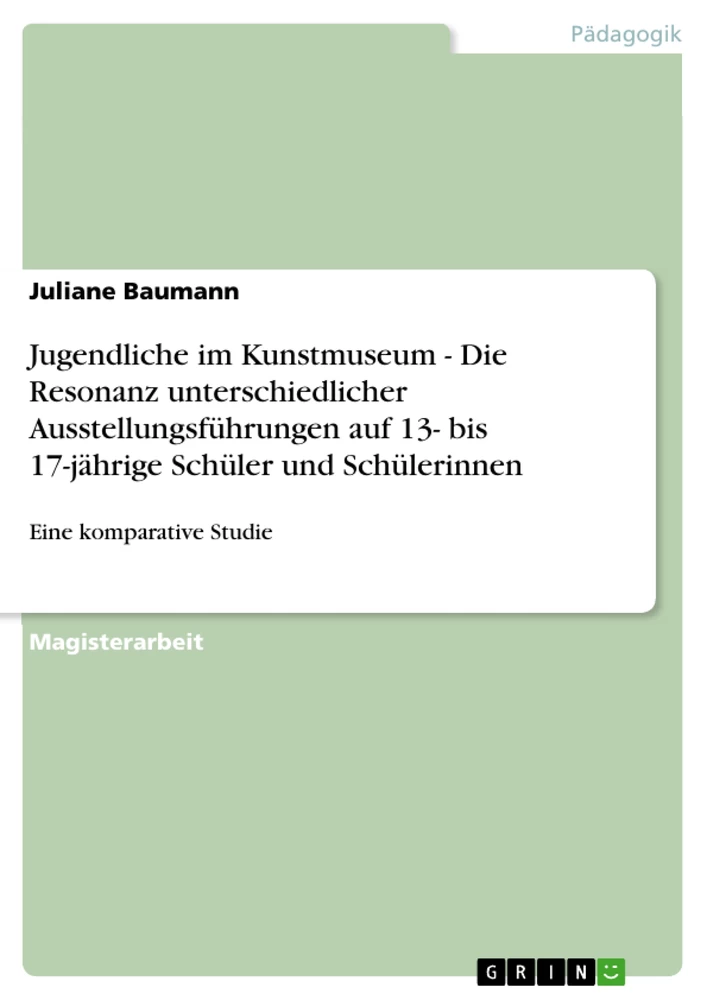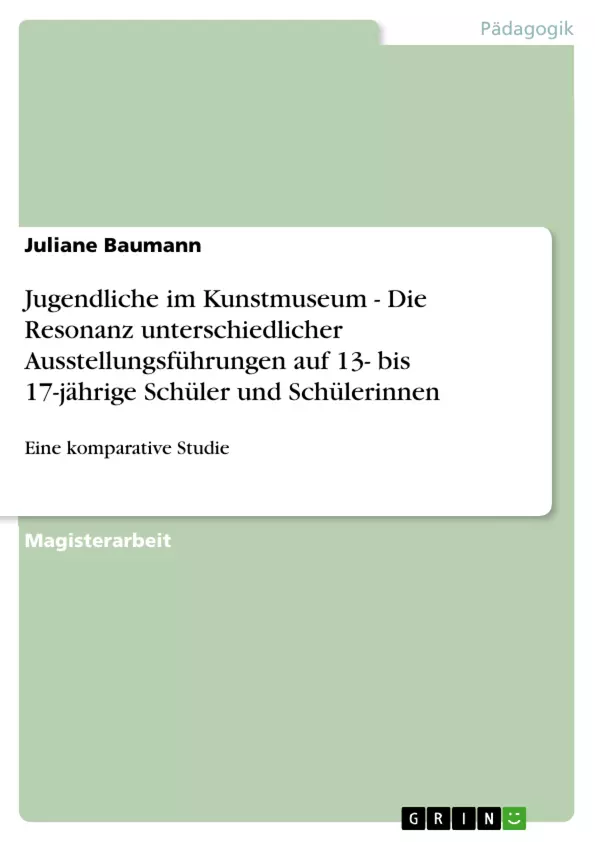Die Frage nach der Rezeption von museumspädagogischer Arbeit, stellt sich beim Besuch von Museen immer wieder. Kunstmuseen bieten eine Vielzahl von Angeboten, die über den ursprünglichen Museumsbesuch, das selbsttätige Ansehen von Bildern, hinausgehen. Dabei wird das Museum allmählich zu einem „Konsumtempel“, durch den das Publikum geschickt geleitet durchwandelt. Museumspädagogen versuchen im „Kaufhaus der Kunst“ eine eigene Nische zu finden. Sie bieten u.a. Ausstellungsführungen an, die oft mit der eigentlichen Idee Alfred Lichtwarks, lockere Museumsgespräche zu führen, wenig gemein haben. Anstelle dessen werden Museumsbesucher mit Fachwissen überhäuft und gezielt zu ausgesuchten Werken geleitet. Selbstständiges Schauen und Denken gestaltet sich dabei schwierig. Der dokumentarische Wert der Kunst steht vielfach mehr im Mittelpunkt der Betrachtung, als der wirkungsästhetische.
Die Zielgruppe der Untersuchung, 13- bis 17jährige Jugendliche, wird häufig unterschätzt und wenig beachtet. Junge Menschen sind der einseitigen Vermittlungsweise, der wissensorientierten Vermittlung, besonders ausgeliefert. Der Umgang mit Kunst und dessen Wirkung wird in der Schule meist nur sporadisch vermittelt. Museumsbesuche gestalten sich häufig als lästige Pflichtveranstaltungen. Außerhalb der Schule finden nur wenige Jugendliche „freiwillig“ den Weg ins Museen. Das kunsthistorische „Unwissen“ der Jugend könnten Museen positiver verwerten. Der Blick auf das Wesentliche ist bei ihnen noch nicht verstellt, wie bei manch „überbildeten“ Erwachsenen. Jugendliche lassen sich vielmehr im Sinne Schillers von neuem begeistern und erfreuen als belehren. Der Effekt der dadurch hervorgerufen wird, ist höher einzuschätzen, als die reine Wissensvermittlung.
Wie können Museen zu wirklichen Lern- und Erlebnisorten für junge Menschen werden?
Die Arbeit untersucht klassische Ausstellungsführungen für Schulklassen und alternative Angebote für Schüler im Freizeitbereich. Dabei geht es um die Wirkung bzw. Resonanz, die die museumspädagogischen Bemühungen bei den Jugendlichen erzeugen. Neben der ästhetischen Wirkung die Kunstwerke auf junge Menschen auslösen können, geht es auch darum, wie sich Jugendliche generell in einem Museum bzw. in einer Ausstellung verhalten. Insbesondere bei der Betrachtung von zeitgenössischer Kunst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG UND ENTWICKLUNG DER FRAGESTELLUNG(EN)...
- 2. DER GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG – DIE KUNSTFÜHRUNG IM MUSEUM.....6
- 2.1 DIE KLASSISCHE FÜHRUNG.
- 2.1.1 Die klassische Kunstführung - Beobachtungen in einem Berliner Kunstmuseum (Fallbeispiel 1)………………….
- 2.1.2 Museum und Jugend...
- 2.2 DIE KOMMUNIKATIVE KUNSTFÜHRUNG - BILDGESPRÄCHE..
- 2.2.1 Modellversuch „Reclaim the Arts!\" (Fallbeispiel 2)...
- 2.2.2 Ursprünge bei den Bildgesprächen Alfred Lichtwarks.
- 2.1 DIE KLASSISCHE FÜHRUNG.
- 3. DIE ZIELGRUPPE - JUGENDLICHE
- 3.1 JUGENDALTER.
- 3.2 JUGEND UND FREIZEIT..
- 3.3 JUGENDLICHE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST.......
- 4. ERKENNTNISLEITENDE THEORIEN – DIE FRAGE DER ÄSTHETISCHEN WIRKUNG 30
- 4.1 NEUZEITLICHE THEORIEN ÄSTHETISCHER WIRKUNG...
- 4.1.1 Kant: Eigengesetzliche ästhetische Verhaltensweisen
- 4.1.2 Schiller: Erziehung zur Freiheit durch Ästhetische Erziehung.
- 4.2 THEORETISCHE ANSÄTZE ÄSTHETISCHER WIRKUNG IN DER GEGENWART.
- 4.2.1 Erkenntnis durch ästhetische Erfahrung..
- 4.2.2 Bildwahrnehmung und ästhetisches Empfinden.......
- 4.3 ZEITGENÖSSISCHE KUNST UND ÄSTHETISCHE WIRKUNG
- 4.1 NEUZEITLICHE THEORIEN ÄSTHETISCHER WIRKUNG...
- 5. METHODISCHES VORGEHEN - METHODE DER UNTERSUCHUNG.
- 5.1 QUALITATIVE FALLSTUDIE
- 5.2 TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG....
- 5.3 FRAGEBOGEN.....
- 6. AUSSTELLUNGSFÜHRUNGEN IN BERLINER KUNSTMUSEEN UND JUGEND -
BEOBACHTUNGEN..
- 6.1 FALLBEISPIEL 1: HAMBURGER BAHNHOF - FÜHRUNGEN FÜR SCHULKLASSEN.
- 6.1.1 Durchführung
- 6.1.2 Beobachtungsstudie
- 6.1.3 Fragebogenstudie..
- 6.2 FALLBEISPIEL 2: „RECLAIM THE ARTS!\" - JUGENDLICHE FÜHREN JUGENDLICHE.
- 6.2.1 Durchführung.
- 6.2.2 Beobachtungsstudie
- 6.2.3 Fragebogenstudie..
- 6.1 FALLBEISPIEL 1: HAMBURGER BAHNHOF - FÜHRUNGEN FÜR SCHULKLASSEN.
- 7. DIE RESONANZ UNTERSCHIEDLICHER AUSSTELLUNGSFÜHRUNGEN - VERGLEICH DER BEIDEN FALLBEISPIELE..
- 8. ZUSAMMENFASSUNG.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Wirkung unterschiedlicher Ausstellungsführungen auf jugendliche Besucher im Museum. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie klassische Führungen und alternative Angebote, wie z.B. das Projekt „Reclaim the Arts!“, bei 13- bis 17jährigen Schülern und Schülerinnen ankommen und welche ästhetischen Wirkungen sie auslösen.
- Vergleich klassischer und kommunikativer Kunstführungen
- Rezeption von Kunst durch Jugendliche
- Ästhetische Wirkung von Kunst
- Rolle des Museums als Lern- und Erlebnisort für Jugendliche
- Museumspädagogische Ansätze im Kontext der Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einleitung und Entwicklung der Fragestellung. Sie beleuchtet das Erkenntnisinteresse und die Motivation, sich mit dem Thema der Rezeption von museumspädagogischer Arbeit bei Jugendlichen zu beschäftigen. Die Einleitung skizziert die Problemstellung, die sich aus der traditionellen, wissensorientierten Vermittlung von Kunst in Museen ergibt. Die Arbeit untersucht, wie Jugendliche auf klassische Ausstellungsführungen reagieren und ob alternative Angebote eine wirkungsvollere Alternative darstellen können.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Gegenstand der Untersuchung – der Kunstführung im Museum. Es werden sowohl die klassische Führung, die stark auf Fachwissen und Wissensvermittlung setzt, als auch die kommunikative Kunstführung, die den Dialog und die Interaktion im Vordergrund stellt, beleuchtet. Anhand von Fallbeispielen werden konkrete Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Zielgruppe – Jugendliche. Es werden Aspekte des Jugendalters, Jugend und Freizeit sowie die Beziehung von Jugendlichen zu zeitgenössischer Kunst beleuchtet.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den erkenntnisleitenden Theorien, die den Rahmen für die Untersuchung der ästhetischen Wirkung von Kunst auf Jugendliche liefern. Es werden sowohl neuzeitliche Theorien von Kant und Schiller als auch gegenwärtige Ansätze zur ästhetischen Erfahrung und Bildwahrnehmung vorgestellt.
Kapitel fünf erläutert das methodische Vorgehen der Untersuchung. Die Arbeit setzt auf eine qualitative Fallstudie mit teilnehmender Beobachtung und Fragebogenstudien. Die Methoden werden im Detail vorgestellt und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen begründet.
Kapitel sechs präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen. Die Arbeit beleuchtet zwei Fallbeispiele: Klassische Führungen für Schulklassen im Hamburger Bahnhof und das Projekt „Reclaim the Arts!“, bei dem Jugendliche selbst Ausstellungsführungen für andere Jugendliche gestalten. Die Ergebnisse der Beobachtungs- und Fragebogenstudien werden detailliert vorgestellt.
Das siebte Kapitel vergleicht die Ergebnisse der beiden Fallbeispiele und analysiert die Resonanz unterschiedlicher Ausstellungsführungen auf die jugendlichen Teilnehmer. Die Arbeit zeigt auf, welche Faktoren die Rezeption von Kunst durch Jugendliche beeinflussen und welche Ansätze besonders wirkungsvoll sind.
Das achte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen. Die Arbeit gibt Empfehlungen für die Gestaltung museumspädagogischer Angebote für Jugendliche und zeigt Möglichkeiten auf, wie Museen zu wirklichen Lern- und Erlebnisorten für junge Menschen werden können.
Schlüsselwörter
Museumspädagogik, Kunstführung, Jugend, ästhetische Wirkung, Zeitgenössische Kunst, Klassische Führung, Kommunikative Führung, Fallstudien, teilnehmende Beobachtung, Fragebogen, „Reclaim the Arts!“, Hamburger Bahnhof, Museumserfahrung, Lernort Museum, Jugend und Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagieren Jugendliche auf klassische Museumsführungen?
Klassische, wissensorientierte Führungen werden von Jugendlichen oft als belehrend und langweilig empfunden, da wenig Raum für eigenes Denken bleibt.
Was ist das Projekt „Reclaim the Arts!“?
Es ist ein Modellversuch, bei dem Jugendliche selbst Führungen für andere Jugendliche gestalten, was die Hemmschwelle senkt und die Kommunikation fördert.
Wer war Alfred Lichtwark?
Lichtwark war ein Kunstpädagoge, der bereits früh lockere Museumsgespräche forderte, statt Besucher mit Fachwissen zu überhäufen.
Welche Rolle spielt zeitgenössische Kunst für junge Menschen?
Zeitgenössische Kunst bietet oft Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Jugendlichen, erfordert aber neue Wege der Vermittlung, um Resonanz zu erzeugen.
Wie können Museen zu Erlebnisorten werden?
Durch interaktive Angebote, die ästhetische Erfahrung vor reine Wissensvermittlung stellen und die Perspektive der Jugendlichen ernst nehmen.
- Quote paper
- Juliane Baumann (Author), 2005, Jugendliche im Kunstmuseum - Die Resonanz unterschiedlicher Ausstellungsführungen auf 13- bis 17-jährige Schüler und Schülerinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143749