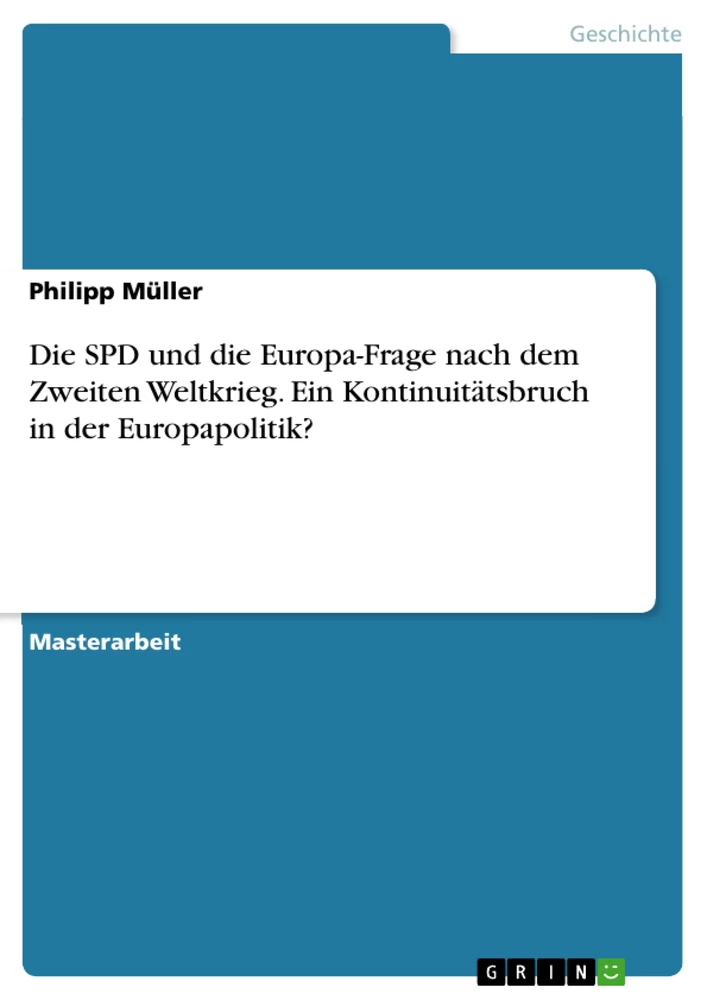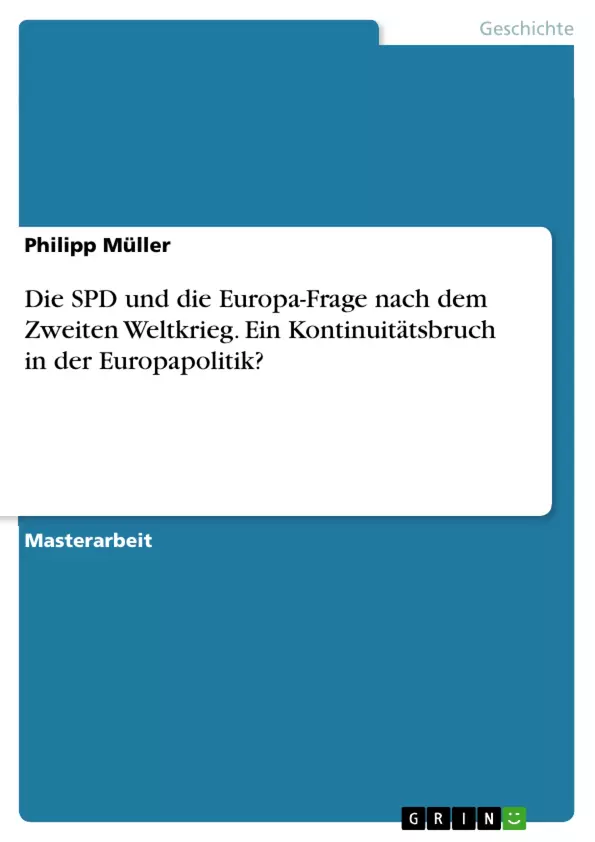In dieser Masterarbeit geht es um die Haltung der SPD in den ersten Jahren der Bundesrepublik bezüglich des europäischen Einigungsprozesses. Die Arbeit stellt heraus, dass die SPD keineswegs eine frühzeitige, durchgängige Visionärin eines europäischen Staatenbundes war. Vielmehr kritisierte und blockierte sie die Westintegration der BRD unter Adenauer vor allem in den 1950er-Jahren. Die Gründe dafür sind vielschichtig und keineswegs allein mit der Angst vor einer Festigung der Deutschen Teilung zu erklären.
Diese Arbeit nimmt dabei insbesondere die SPD-Fraktion als einen Akteur unter die Lupe und untersucht, welchen Einfluss Europa-Vorstellungen der deutsche Sozialdemokraten in der Nachkriegszeit hatten. Dabei zeigt die Arbeit zunächst die historische Entwicklungslinie dieser sozialdemokratischen Europa-Konzepte auf und wie diese die SPD-Politiker in den 1950er noch beeinflussten. Schließlich wird damit auch der programmatische Turn der SPD durch Godesberg und im Speziellen auch in der Europafrage 1957-1960 erklärt. Abschließend wird die Frage diskutiert, inwiefern die SPD-Europapolitik der Nachkriegszeit ein Kontinuitätsbruch mit der eigenen Parteitradition war.
Der Forschungsstand zur Europapolitik der SPD in den 1950er-Jahren ist gut erschlossen, insbesondere durch Werke von Klotzbach, Hrbek und Mittag. Die Untersuchung stützt sich auch auf Protokolle und Analysen der Bundestagsfraktion sowie auf aktuelle Arbeiten, die die Rolle der SPD-Fraktion im Bundestag detailliert analysieren.
Die Arbeit gliedert sich in zwei vorangestellte Kapitel, die die Tradition der Internationalität bei der Sozialdemokratie und die im Exil erarbeiteten Europavorstellungen der SPD beleuchten. Anschließend wird die Blockadehaltung der SPD in den 1950er-Jahren dargestellt, wobei die innerparteilichen Widerstände und alternativen Europakonzepte analysiert werden. Das Kapitel zur Europapolitik 1957-1960 untersucht die Weiterführung der historischen Klammer zu den Ideen des SPD-Exils. Der Ausblick auf die Kanzlerschaft unter Willy Brandt schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europa und die Sozialdemokratie bis zum Zweiten Weltkrieg
- Internationalität als Tradition?
- Europa-Vorstellungen in der Sozialdemokratie bis zum Zweiten Weltkrieg
- Europa-Konzepte im Exil während des Zweiten Weltkrieges
- Der Weg zum sozialdemokratischen Exil in London
- Die Parteitransformation im Exil
- Die Idee eines kapitalistisch-liberalen Europas
- Die Idee eines sozialistischen Europas
- Die Idee eines Europas der „Dritten Kraft“
- Von der Kapitulation 1945 zur Konstitution Deutschlands 1949 – was blieb vom sozialdemokratischen Exil?
- Der neue sozialdemokratische Nationalismus
- Kurt Schumacher als Totengräber der „Dritten Kraft“?
- Die SPD-Blockade gegenüber der Westintegration Adenauers
- Der Europarat
- Schuman-Plan und Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
- Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) und der Führungswechsel der SPD
- Die Pariser Verträge
- Die Römischen Verträge
- Gründe für die Blockadehaltung
- Innerparteiliche Strömungen für eine Europäische Integration
- Erste kritische Ansätze bis 1950
- Sozialdemokratische Befürworter des Europarats
- Schuman-Plan und Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
- Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und Europäische Politische Gemeinschaft (EPG)
- Nach den Pariser Verträgen
- Der Meinungsumschwung in der Europafrage 1957-1960
- Diskussion: Die SPD-Europapolitik der Nachkriegszeit als Kontinuitätsbruch zur Parteitradition?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Europapolitik der SPD in der unmittelbaren Nachkriegszeit und hinterfragt, ob diese eine Kontinuitätslinie zur vor- und währendkriegszeitlichen Europapolitik der SPD darstellt. Es wird untersucht, ob die SPD die europäische Integration des neuen Deutschlands unterstützte oder ob sie dieser ablehnend gegenüberstand. Im Zentrum der Betrachtung stehen die Jahre 1945 bis 1957, also die Zeit vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Unterzeichnung der Römischen Verträge.
- Die Entwicklung der Europapolitik der SPD vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
- Die Rolle der Parteivorsitzenden Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer in der Europapolitik der SPD
- Die innerparteilichen Konflikte über die europäische Integration
- Die Bedeutung der „Dritten Kraft“-Idee für die Europapolitik der SPD
- Die Gründe für die Blockadehaltung der SPD gegenüber der europäischen Integration Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage nach der Kontinuität in der Europapolitik der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg. Im zweiten Kapitel wird die Europapolitik der SPD bis zum Zweiten Weltkrieg beleuchtet, wobei der Fokus auf der internationalen Ausrichtung der Partei und ihren Europa-Vorstellungen liegt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Situation der SPD im Exil während des Zweiten Weltkriegs und analysiert die Parteitransformation im Exil, insbesondere die Entwicklung der Europa-Konzepte. Im vierten Kapitel wird die Phase der deutschen Nachkriegszeit und die Rolle der SPD in der Westintegration untersucht, insbesondere die Blockadehaltung der Partei gegenüber den westlichen Integrationsschritten. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den innerparteilichen Strömungen innerhalb der SPD, die eine europäische Integration befürworteten. Schließlich wird im sechsten Kapitel der Meinungsumschwung der SPD in der Europafrage in den Jahren 1957-1960 analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der deutschen Nachkriegsgeschichte, der europäischen Integration, der Rolle der Sozialdemokratie und der politischen Entscheidungsfindung. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Europapolitik, Sozialdemokratie, SPD, Westintegration, „Dritte Kraft“, Kontinuität, Blockadehaltung, innerparteiliche Strömungen, Meinungsumschwung, Schuman-Plan, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Europäische Politische Gemeinschaft (EPG), Römische Verträge.
- Arbeit zitieren
- Philipp Müller (Autor:in), 2021, Die SPD und die Europa-Frage nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Kontinuitätsbruch in der Europapolitik?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1437537