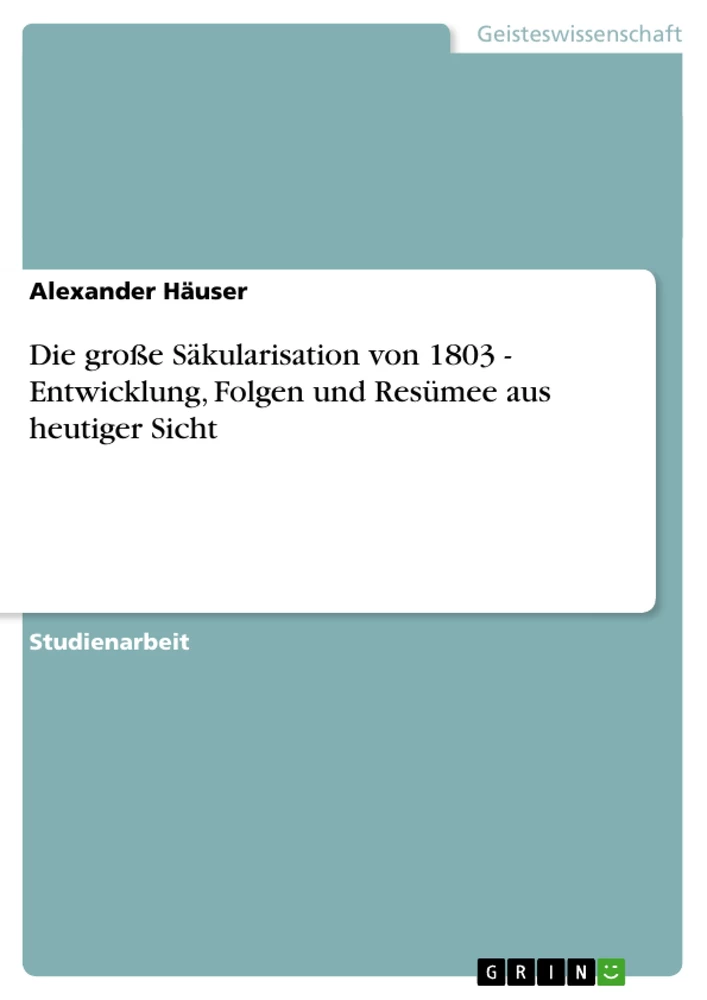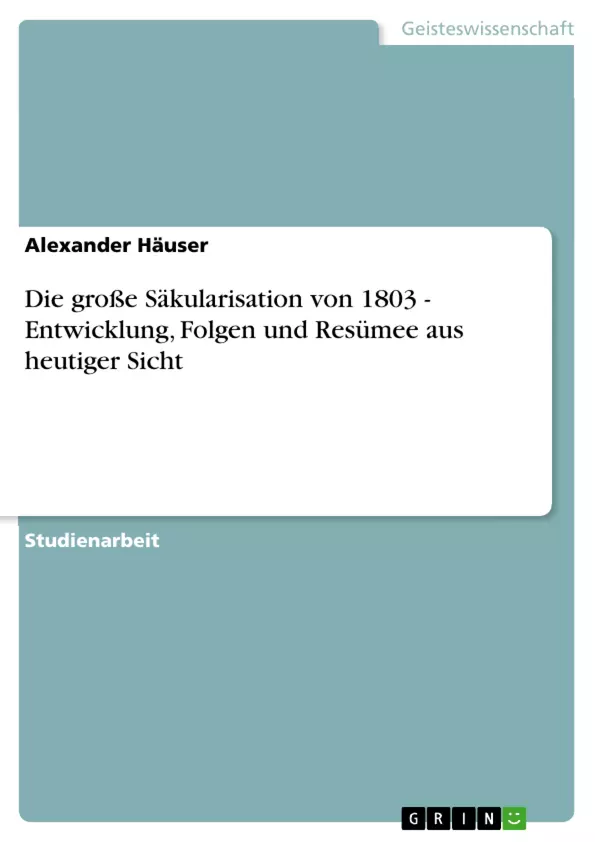Verwendet man heute den Begriff der Säkularisation, oder der Säkularisierung wie er manchmal synonym verwendet wird, meint man meistens die große Säkularisation der Kirchen und Klöster im Jahre 1803. Tatsächlich vollzog sich aber der "Übergang von geistlichem Eigentum und Hoheitsrechten in weltlichen Besitz“ schon im Mittelalter bei den Karolingern und in der Reformationszeit im Zuge des Dreißigjährigen Krieges und auch später im 20. Jahrhundert bei der Vermögenssäkularisation in der Sowjetunion und ihrer Blockstaaten kam es wieder zur Enteignung kirchlichen Wertguts. Keine dieser kann aber in ihrem Ausmaß der Auswirkungen und ihrer Durchführung mit der großen Säkularisation von 1803 verglichen werden. Seit nämlich die katholische Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die „Verweltlichung“, also der zwangsweisen Überführung großer Teile ihres rechtmäßig erworbenen Vermögens auf weltliche Erbfürsten, um ihre frühere weitgehende wirtschaftliche Selbständigkeit gebracht wurde, fand sich im Gegenzug der staatliche Souverän bereit, die fortan bestehende finanzielle Abhängigkeit der Kirche durch gewisse konkordatäre Leistungen aber auch durch die Gewährung des Rechtes auf Kirchensteuern beheben zu wollen. Diese Leistungen, bzw. Dotationen werden auch heute noch, 200 Jahre später, gewährleistet. In dieser Seminararbeit soll auf die Entwicklung der großen Säkularisation von 1803 eingegangen werden. Dabei soll ein Augenmerk auf die ersten Enteignungen der Kirchen und Klöstern und ihren unmittelbaren Folgen gelegt werden. Reaktionen Seitens der Bevölkerung sollen eine differenzierte Betrachtungsweise aufzeigen und ein abschließendes Fazit soll schließlich ein Resümee aus heutiger Zeit geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorgeschichte der großen Säkularisation
- Die Französische Revolution
- Napoleon Bonaparte als Umgestalter Europas
- Die Säkularisation in Deutschland
- Die Bestimmung der Säkularisation als Entschädigungsprinzip
- Die ersten Klostersäkularisationen
- Die unmittelbaren Folgen der Säkularisation
- Reaktionen seitens der Bevölkerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung der großen Säkularisation von 1803. Der Fokus liegt auf den ersten Enteignungen der Kirchen und Klöster sowie deren unmittelbaren Folgen. Die Reaktionen der Bevölkerung werden analysiert, um eine differenzierte Betrachtungsweise zu ermöglichen. Ein abschließendes Fazit soll schließlich ein Resümee aus heutiger Zeit liefern.
- Die Vorgeschichte der Säkularisation im Kontext der Französischen Revolution und Napoleons Herrschaft
- Die Einführung der Säkularisation als Entschädigungsprinzip in Deutschland
- Die Folgen der Säkularisation für die Kirchen und Klöster sowie die Bevölkerung
- Die politische und soziale Bedeutung der Säkularisation im Deutschen Reich
- Die langfristigen Auswirkungen der Säkularisation auf die Beziehung zwischen Staat und Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert den Begriff der Säkularisation und zeigt die Bedeutung der großen Säkularisation von 1803 im Vergleich zu anderen Säkularisationsbewegungen auf. Der Fokus der Seminararbeit wird auf die Entwicklung der Säkularisation, ihre Folgen und die Reaktionen der Bevölkerung gelegt.
Die Vorgeschichte der großen Säkularisation
Die Französische Revolution
Das Kapitel beschreibt den Ausbruch der Französischen Revolution und deren Auswirkungen auf die Kirche. Die Aufklärungsideen, die Auflösung der mittelalterlichen Feudalordnung und die Einführung von Bürgerrechten führten schließlich zur Abschaffung des Christentums in Frankreich. Der Vernunftkult wurde eingeführt, der aber in Teilen der Bevölkerung auf Widerstand stieß.
Napoleon Bonaparte als Umgestalter Europas
Das Kapitel beleuchtet Napoleons Rolle in der französischen Revolution und seinen Einfluss auf die Kirche. Durch die Einführung des Konkordats mit dem Papst wurde die katholische Kirche zwar nicht zur Staatskirche, aber wiederhergestellt. Napoleons Eroberungen in Europa führten zur Einführung der Revolutionsideen auch in anderen Ländern, wodurch die geistlichen Kurfürstentümer in Deutschland betroffen waren.
Die Säkularisation in Deutschland
Die Bestimmung der Säkularisation als Entschädigungsprinzip
Das Kapitel erklärt die Einführung der Säkularisation als Entschädigungsprinzip für die linksrheinischen Kurfürstentümer, die durch den Verlust ihrer Gebiete an Frankreich Entschädigung benötigten. Der Reichsdeputationshauptschluss von Regensburg legte die Bedingungen für die Säkularisation fest und führte zur Auflösung von geistlichen Territorien im Deutschen Reich.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Säkularisation, Französische Revolution, Napoleon Bonaparte, Konkordat, Deutsches Reich, geistliche Kurfürstentümer, Reichsdeputationshauptschluss, Entschädigungsprinzip, Kirche, Staat.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah bei der Säkularisation von 1803?
Es handelt sich um die Überführung von geistlichem Eigentum und Hoheitsrechten (Kirchen und Klöster) in weltlichen Besitz, vor allem zur Entschädigung deutscher Fürsten.
Welche Rolle spielte Napoleon Bonaparte bei der Säkularisation?
Napoleon fungierte als Umgestalter Europas; seine Eroberungen und das Konkordat mit dem Papst ebneten den Weg für die Auflösung geistlicher Territorien in Deutschland.
Was war der Reichsdeputationshauptschluss?
Dies war ein Beschluss von 1803 in Regensburg, der die rechtliche Grundlage für die Säkularisation und Mediatisierung im Heiligen Römischen Reich bildete.
Warum erhalten Kirchen heute noch Staatsleistungen?
Als Gegenleistung für die Enteignungen von 1803 verpflichtete sich der Staat zu finanziellen Dotationen und gewährte das Recht auf Kirchensteuern, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Kirche zu sichern.
Wie reagierte die Bevölkerung auf die Auflösung der Klöster?
Die Reaktionen waren differenziert; während einige die Modernisierung begrüßten, litten andere unter dem Verlust sozialer und religiöser Zentren.
- Quote paper
- Alexander Häuser (Author), 2009, Die große Säkularisation von 1803 - Entwicklung, Folgen und Resümee aus heutiger Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143791