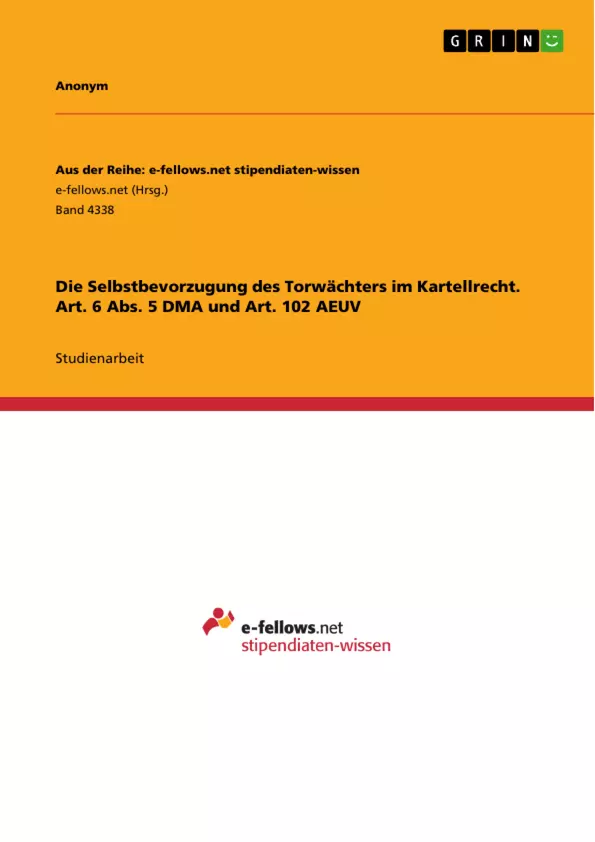Die Arbeit fokussiert sich auf die Selbstbevorzugung im Wege der Hervorhebung eigener Angebote durch vertikal integrierte Unternehmen, wie sie sog. "Gatekeepern" durch Art. 6 Abs. 5 DMA untersagt wird und wie sie Gegenstand der Google Shopping-Entscheidung der Kommission im Jahr 2017 war, welche durch das EuG 2021 bestätigt wurde. Dabei werden zunächst Zweck und Wirkweise von Art. 6 Abs. 5 DMA erläutert und anschließend untersucht, ob die Norm in ihrer Ausgestaltung ihrem Zweck gerecht wird oder ob sie eine Überregulierung zu bewirken droht.
Während die Selbstbevorzugung von Unternehmen im Kartellrecht lange Zeit keine besondere Aufmerksamkeit erzielt hat, hat sich dies in den letzten Jahren geändert. Dies liegt zum einen an dem Wandel hin zu immer stärkeren Digitalmärkten, welche in besonderem Maße anfällig sind für selbstbevorzugende Verhaltensweisen. Aber auch das Google Shopping-Urteil des EuG, ein verstärktes Engagement der Kartellbehörden in diesem Bereich und gesetzgeberische Innovationen sowohl auf nationaler als auch auf unionsrechtlicher Ebene haben dafür gesorgt, dass die Selbstbevorzugung marktstarker Unternehmen in den Fokus des Wettbewerbsrechts gerückt ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- Das Selbstbevorzugungsverbot nach Art. 6 Abs. 5 DMA.
- I. Zweck der Norm
- II. Wirkung der Norm
- C. Selbstbevorzugung als Marktmissbrauch i.S.v. Art. 102 AEUV
- I. Selbstbevorzugung als Zugangsverweigerung.
- II. Selbstbevorzugung als Koppelung.
- III. Selbstbevorzugung als Diskriminierung
- 1. Allgemeines Diskriminierungsverbot
- 2. Spezielles Diskriminierungsverbot
- IV. Zwischenergebnis
- D. (Potenzielle) Wettbewerbsschädlichkeit
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verbot der Selbstbevorzugung von Unternehmen im Kartellrecht, das in den letzten Jahren aufgrund des Wandels hin zu Digitalmärkten und des Google Shopping-Urteils des EuG an Bedeutung gewonnen hat. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Digital Markets Act auf die Selbstbevorzugung von Gatekeepern und analysiert, ob die darin verankerte Norm dem Zweck gerecht wird oder ob sie zu einer Überregulierung führt.
- Der Zweck und die Wirkung der Selbstbevorzugungsnorm nach Art. 6 Abs. 5 DMA
- Die Beurteilung der Selbstbevorzugung als Marktmissbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV
- Die potenzielle Wettbewerbsschädlichkeit der Selbstbevorzugung
- Die Frage der Überregulierung durch die Selbstbevorzugungsnorm
- Die Relevanz des Google Shopping-Urteils des EuG im Kontext der Selbstbevorzugung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die steigende Bedeutung der Selbstbevorzugung im Kartellrecht, insbesondere im Kontext von Digitalmärkten. Die Arbeit fokussiert sich auf die Selbstbevorzugung von Gatekeepern, die durch Art. 6 Abs. 5 DMA verboten ist. Im zweiten Kapitel wird der Zweck und die Wirkungsweise des Selbstbevorzugungsverbots im DMA näher beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert, ob die Norm als Marktmissbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV einzustufen ist, wobei verschiedene Aspekte wie Zugangsverweigerung, Koppelung und Diskriminierung betrachtet werden. Das vierte Kapitel beleuchtet die potenzielle Wettbewerbsschädlichkeit der Selbstbevorzugung.
Schlüsselwörter
Selbstbevorzugung, Gatekeeper, Digital Markets Act, Art. 6 Abs. 5 DMA, Art. 102 AEUV, Marktmissbrauch, Wettbewerbsschädlichkeit, Google Shopping, Überregulierung, Digitalmärkte, Kartellrecht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Die Selbstbevorzugung des Torwächters im Kartellrecht. Art. 6 Abs. 5 DMA und Art. 102 AEUV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1438133