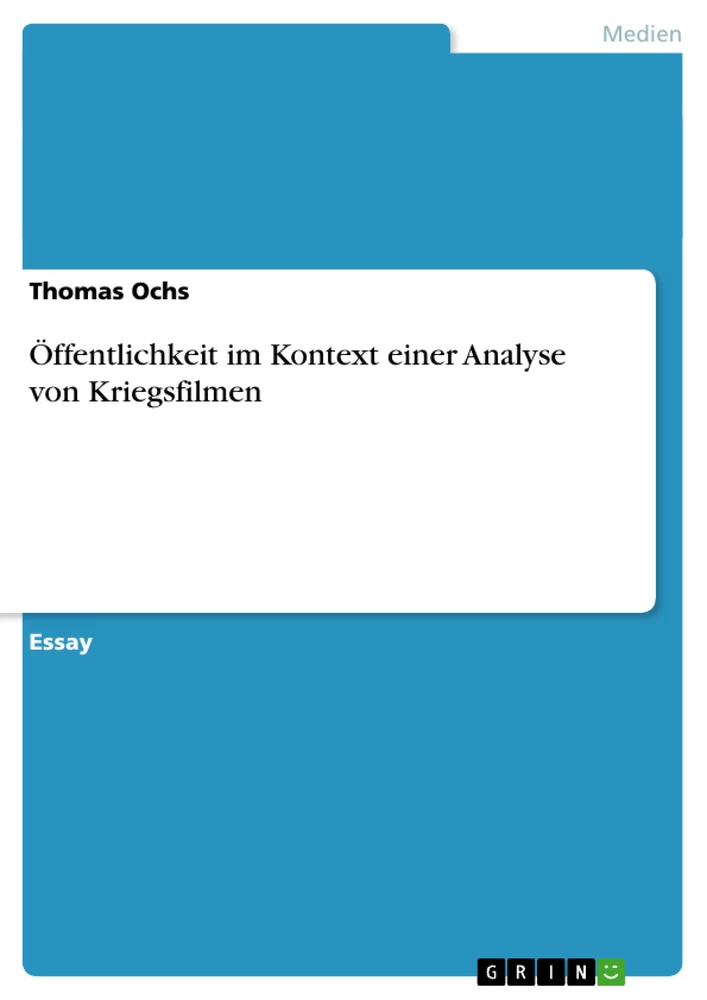Nicht nur am Wochenende gehen auf der ganzen Welt Menschen ins Kino. Es findet zu Hunderten in den verschiedensten Ländern ein Prozess statt, bei dem Öffentlichkeiten entstehen. Menschen gehen ins Kino und betrachten einen Film. Ein Bruchteil dieser Menschen betrachtet einen Film mit der Genrebezeichnung Kriegsfilm. Diese Tatsache ist insoweit erwähnenswert, da sich daraus zahlreiche Probleme und Fragen ergeben, die Teil einer gesellschaftlichen Diskussion sein sollten. Ins Kino zu gehen, heißt auch in einer Öffentlichkeit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nicht nur die Konsumierung eines Films in einem Kinoraum lässt eine Öffentlichkeit entstehen, sondern auch der mögliche Diskurs, der nach dem Film über den Film stattfinden kann. In dem Zusammenhang einer Filmlektüre des Kriegsfilms ist dieser Aspekt aus durchaus differenzierten Gründen näher zu betrachten und zu diskutieren.
Relevanz der Thematisierung von Öffentlichkeit im Kontext einer Analyse von Kriegsfilmen
Nicht nur am Wochenende gehen auf der ganzen Welt Menschen ins Kino. Es findet zu Hunderten in den verschiedensten Ländern ein Prozess statt, bei dem Öffentlichkeiten entstehen. Menschen gehen ins Kino und betrachten einen Film. Ein Bruchteil dieser Menschen betrachtet einen Film mit der Genrebezeichnung Kriegsfilm. Diese Tatsache ist insoweit erwähnenswert, da sich daraus zahlreiche Probleme und Fragen ergeben, die Teil einer gesellschaftlichen Diskussion sein sollten. Ins Kino zu gehen, heißt auch in einer Öffentlichkeit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nicht nur die Konsumierung eines Films in einem Kinoraum lässt eine Öffentlichkeit entstehen, sondern auch der mögliche Diskurs, der nach dem Film über den Film stattfinden kann. In dem Zusammenhang einer Filmlektüre des Kriegsfilms ist dieser Aspekt aus durchaus differenzierten Gründen näher zu betrachten und zu diskutieren.
Es ist nicht nur wichtig die Frage nach Öffentlichkeit im Kontext einer Analyse eines Kriegsfilms zu erörtern, sondern auch absolut notwendig. Nicht nur um die persönliche Wahrnehmungsfähigkeit weiterzuentwickeln, sondern auch um Diskurse rund um einen bestimmten Kriegsfilm und seine Thematik zu entfachen; Diskussionen anzuregen und Fragen aufzuwerfen; wiederum Thesen zu entkräften und Thesen zu bestätigen. Um aber dieser zentralen Frage Herr zu werden und bis ins Detail theoretisch zu erörtern, muss man sich natürlich erst einmal den Begrifflichkeiten, die an dieser Stelle im Mittelpunkt stehen, bewusst sein: Was kann Öffentlichkeit bedeuten? Was kann Kriegsfilm bedeuten? Die alltägliche Verwendung dieser beiden Begriffe ist durchaus nicht klar und eindeutig genug um damit Thesen zu formulieren. Zunächst sei also einmal geklärt, welche Bedeutung Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang annehmen kann. Öffentlichkeit theoretisch zu begreifen, heißt auch sich darüber im Klaren zu sein, dass sich eine Gesellschaft dadurch kennzeichnet, dass sie sich aus einem Privaten und einem Öffentlichen zusammensetzt. Dass sich Öffentlichkeiten an sich im Medienzeitalter nicht mehr recht fassen und definieren lassen, weil Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem verschwimmen, Öffentlichkeit an sich spezifisch, also einmalig ist und niemals das Gleiche meinen kann, wirft nicht gleichzeitig diese Trennung in eine private und öffentliche Gesellschaft über Bord. Freilich wird es zunehmend deutlicher, dass es aufgrund der steigenden Priorität des Internets und anderen globalen Kommunikationsmöglichkeiten immer schwerer fällt Öffentlichkeiten auch bewusst wahrzunehmen. Die Möglichkeiten des World Wide Webs sind diesbezüglich beispielgebender Punkt. Öffentlichkeit konstituiert sich nämlich gerade daran, dass Meinungen und Informationen ausgetauscht werden, also ein Diskurs zu Stande kommt. Heutzutage hängt das unmittelbar mit diversen Kommunikationsformen (nicht nur im Internet) und der sozialen, freilich häufiger digitalen, Netzwerkbildung innerhalb verschiedenster Plattformen zusammen. Nicht nur über Blog, Twitter und Facebook werden Meinungen und Diskurse angestachelt, sondern gerade auch durch die Einfachheit selbst im Internet aktiv zu werden[1]. Grenzen, Barrieren, Möglichkeiten verschwimmen und die Öffentlichkeiten, die natürlich immer noch existent sind, verschwinden zunehmend aus dem öffentlichen Raum in die offene Privatheit einer Mediengesellschaft[2]. Nun. Öffentlichkeit in begriffsgeschichtlicher Entwicklung zu charakterisieren und zu definieren, würde insoweit zu weit führen, dass man nicht in der hier gegebenen Kürze schlüssig und bis ins Detail argumentieren kann, inwieweit sich dieser gesellschaftliche Wandel vollzogen hat bzw. immer noch vollzieht. Aus diesem Grund soll es im Weiteren ausreichen Öffentlichkeit als realen (physische Sichtbarkeit) oder aber auch virtuellen (physische Unsichtbarkeit) Raum der Meinungsäußerung und des Informationsaustausches zu bezeichnen. Ich werde also von einer Öffentlichkeit sprechen, die nicht mehr zwingend von einer physischen Anwesenheit der Personen abhängig ist[3].
[...]
[1] Vgl: Mirjam Maritz, „Museumsquartier: Aufruhr um neue Hausordnung“, Die Presse 08.06.2009, http://diepresse.com/home/panorama/wien/485664/index.do?from=suche.intern.portal, 22.06.2009.
[2] Vgl: Hannah Arendt, „Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten“, Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Hg. Jörg Dünne/Stephan Günzel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006, S. 424f; Anm. Arendt spricht hier von einem „privaten Charakter des Privaten“, welcher sich dadurch charakterisiert, dass der Privatmensch gegenüber den anderen nicht recht in Erscheinung tritt aber in der modernen Gesellschaft auch dieser private Raum zuungunsten des Einzelnen zerstört wird; diesem Komplex möchte ich insoweit dem kongruent wissen, was ich eine offene Privatheit nenne und damit meine, dass die Öffentlichkeiten, die beispielsweise in der römischen Antike ausschließlich in öffentlichen Räumen entstanden sind, heute aufgrund der Massenmedien teilweise von privaten Räumen ausgehen und in virtuellen Räumen entstehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Analyse in Bezug auf Kriegsfilme und Öffentlichkeit?
Der Fokus liegt auf der Relevanz der Thematisierung von Öffentlichkeit im Kontext der Analyse von Kriegsfilmen. Es geht darum, wie das Betrachten von Kriegsfilmen im Kino Öffentlichkeiten schafft und welche gesellschaftlichen Diskussionen daraus entstehen können.
Warum ist die Frage nach Öffentlichkeit im Kontext von Kriegsfilmen wichtig?
Die Erörterung der Frage nach Öffentlichkeit ist nicht nur wichtig für die persönliche Wahrnehmungsfähigkeit, sondern auch um Diskurse anzuregen, Diskussionen zu entfachen und Fragen aufzuwerfen. Ziel ist es, Thesen zu entkräften oder zu bestätigen.
Welche Begriffe müssen geklärt werden, um die Frage nach Öffentlichkeit zu erörtern?
Die Begriffe "Öffentlichkeit" und "Kriegsfilm" müssen zunächst geklärt werden, da ihre alltägliche Verwendung nicht eindeutig genug ist, um Thesen zu formulieren. Es ist wichtig, die Bedeutung von Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang zu verstehen.
Wie wird Öffentlichkeit in diesem Kontext definiert?
Öffentlichkeit wird als realer (physische Sichtbarkeit) oder virtueller (physische Unsichtbarkeit) Raum der Meinungsäußerung und des Informationsaustausches bezeichnet. Die physische Anwesenheit der Personen ist nicht zwingend erforderlich.
Wie hat sich die öffentliche Wahrnehmung durch das Internet verändert?
Die Möglichkeiten des Internets haben die Wahrnehmung von Öffentlichkeit verändert. Grenzen und Barrieren verschwimmen, und Öffentlichkeiten verlagern sich von öffentlichen Räumen in die offene Privatheit einer Mediengesellschaft.
Worauf basiert die Definition von Öffentlichkeit in den Fußnoten?
Die Fußnoten verweisen auf verschiedene Quellen, darunter Artikel und Essays, die die Entwicklung und Definition von Öffentlichkeit untersuchen. Insbesondere werden Hannah Arendts Ansichten zur Öffentlichkeit im antiken Stadt-Staat (Polis) und die Veränderungen durch die moderne Mediengesellschaft diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Thomas Ochs (Autor:in), 2009, Öffentlichkeit im Kontext einer Analyse von Kriegsfilmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143886