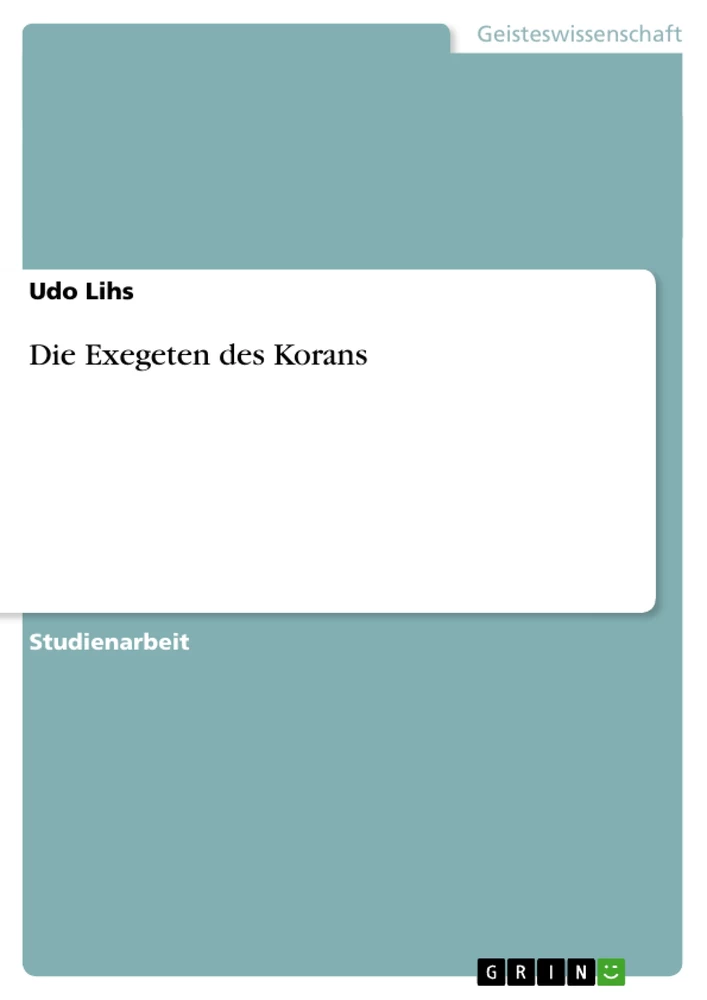Es gibt eine Exegese des Korans, nicht nur eine. Die Interpretation, die Deutung und Auslegung koranischer Verse und Zeichen, gar der Versuch der Übersetzung ist eine Jahrhunderte alte Tradition im Islam und sogar im Christentum des Mittelalters wurde versucht, den Koran zu verstehen, indem man ihn übersetzte. Im Folgenden werde ich auf sunnitische und schiitische, traditionelle und moderne Exegeten des Korans eingehen, werde ihre Motive und Akzente untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Exegese des Korans – Eine Einführung
- Sunnitische Exegese: Abû Dscha'far Muhammad Ibn Dscharīr Ibn Yazīd at-Ṭabarī
- Schiitische Exegese: Abū 'Abd Allāh Dscha'far ibn Muhammad as-Sadiq
- Weitere Exegeten
- Christliche Übersetzer: Robert von Ketton
- Moderne und postmoderne Exegeten
- Die Exegese des Korans am Beispiel der Sure 4,34
- Relevanz und Konsequenzen für das Lehrerhandeln im Fach LER
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widerlegt die Behauptung, der Islam besitze keine eigene Exegese des Korans. Ziel ist es, religionswissenschaftlich die Interpretation des Korans zu beleuchten, ohne Apologetik zu betreiben. Die Arbeit untersucht sunnitische und schiitische, traditionelle und moderne Exegeten und deren Herangehensweisen. Schließlich wird die Relevanz für den Religionsunterricht betrachtet.
- Die Existenz und Vielfalt koranischer Exegese
- Unterschiede zwischen sunnitischer und schiitischer Exegese
- Traditionelle und moderne Interpretationsansätze
- Die Bedeutung des historischen Kontextes für die Koraninterpretation
- Implikationen für den Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort thematisiert die im Okzident verbreitete Islamophobie und die damit verbundene Fehlannahme, der Islam besitze keine eigene Interpretation des Korans. Die Arbeit widerlegt diese These und untersucht die lange Tradition der Koranexegese im Islam und im mittelalterlichen Christentum. Der Fokus liegt auf der Analyse sunnitischer und schiitischer Exegeten und deren unterschiedlichen Herangehensweisen an die Interpretation des heiligen Textes. Abschließend wird die Relevanz dieser Thematik für den Religionsunterricht im Fach LER angesprochen.
Die Exegese des Korans – Eine Einführung: Dieses Kapitel stellt den Koran als zentrale heilige Schrift des Islams vor und erklärt dessen Entstehung und Struktur. Es betont die Unveränderlichkeit des koranischen Textes und die Notwendigkeit seiner Interpretation. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der unterschiedlichen Suren und Verse sowie der Herausforderungen und Prinzipien der Koranexegese. Es werden verschiedene Ansätze der Interpretation vorgestellt, die von einer wörtlichen bis hin zu einer hermeneutischen Lesart reichen, wobei der historische Kontext und die tribalen Strukturen der vorislamischen Zeit betont werden. Die Unterscheidung zwischen mekkanischen und medinischen Suren wird als relevant für eine historische Interpretation hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Koranexegese, sunnitische Exegese, schiitische Exegese, Tafsīr, Koraninterpretation, Islam, Religionsunterricht, LER, Hermeneutik, historischer Kontext, Islamophobie.
Häufig gestellte Fragen zur Koranexegese
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit widerlegt die Behauptung, der Islam besitze keine eigene Exegese des Korans. Sie beleuchtet religionswissenschaftlich die Interpretation des Korans, untersucht sunnitische und schiitische, traditionelle und moderne Exegeten und deren Herangehensweisen und betrachtet schließlich die Relevanz für den Religionsunterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Existenz und Vielfalt koranischer Exegese, die Unterschiede zwischen sunnitischer und schiitischer Exegese, traditionelle und moderne Interpretationsansätze, die Bedeutung des historischen Kontextes für die Koraninterpretation und die Implikationen für den Religionsunterricht. Konkrete Beispiele werden an der Sure 4,34 gegeben.
Welche Exegeten werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt sunnitische Exegeten wie Abû Dscha'far Muhammad Ibn Dscharīr Ibn Yazīd at-Ṭabarī und schiitische Exegeten wie Abū 'Abd Allāh Dscha'far ibn Muhammad as-Sadiq vor. Darüber hinaus werden weitere Exegeten und auch christliche Übersetzer wie Robert von Ketton sowie moderne und postmoderne Exegeten erwähnt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, eine Einführung in die Koranexegese, Kapitel zu sunnitischer und schiitischer Exegese, Kapitel zu weiteren Exegeten (inkl. christlichen Übersetzern und modernen Exegeten), eine Analyse der Sure 4,34 als Beispiel, einen Abschnitt zur Relevanz für den Religionsunterricht und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welchen Zweck hat die Analyse der Sure 4,34?
Die Analyse der Sure 4,34 dient als konkretes Beispiel zur Illustration der unterschiedlichen Interpretationsansätze und Methoden der Koranexegese.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit widerlegt die These, der Islam besitze keine eigene Koranexegese. Sie zeigt die lange Tradition und Vielfalt der Interpretation des Korans auf, sowohl innerhalb des Islam (sunnitisch und schiitisch) als auch in der Auseinandersetzung mit dem Islam im mittelalterlichen Christentum. Die Relevanz für den Religionsunterricht wird hervorgehoben. Die Arbeit betont dabei einen religionswissenschaftlichen Ansatz ohne Apologetik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Koranexegese, sunnitische Exegese, schiitische Exegese, Tafsīr, Koraninterpretation, Islam, Religionsunterricht, LER, Hermeneutik, historischer Kontext, Islamophobie.
- Arbeit zitieren
- Udo Lihs (Autor:in), 2009, Die Exegeten des Korans, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143984