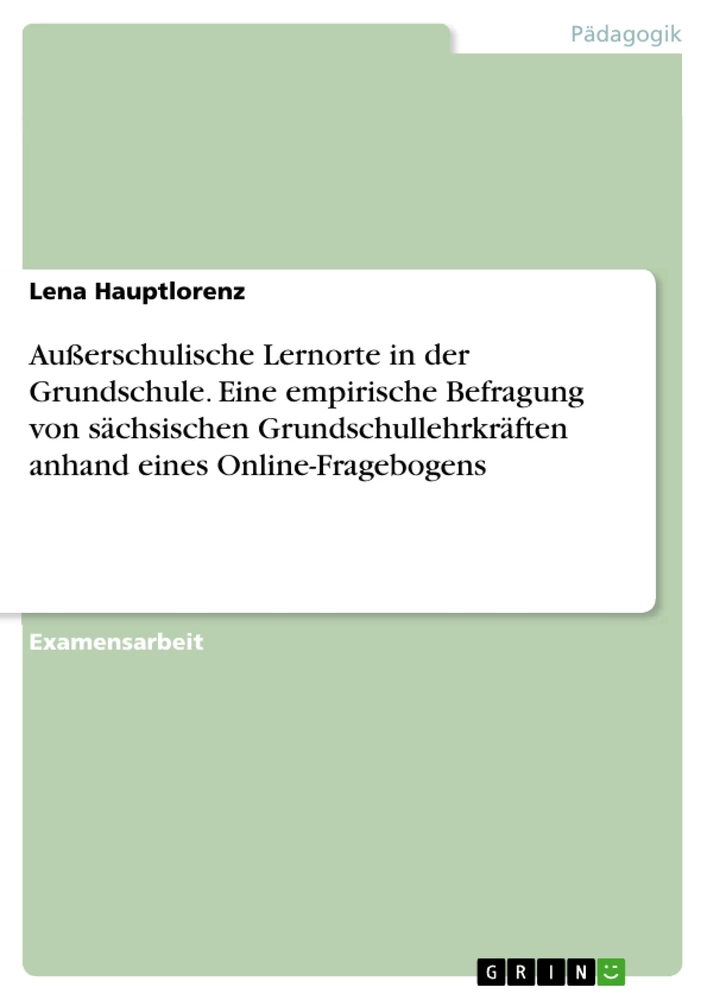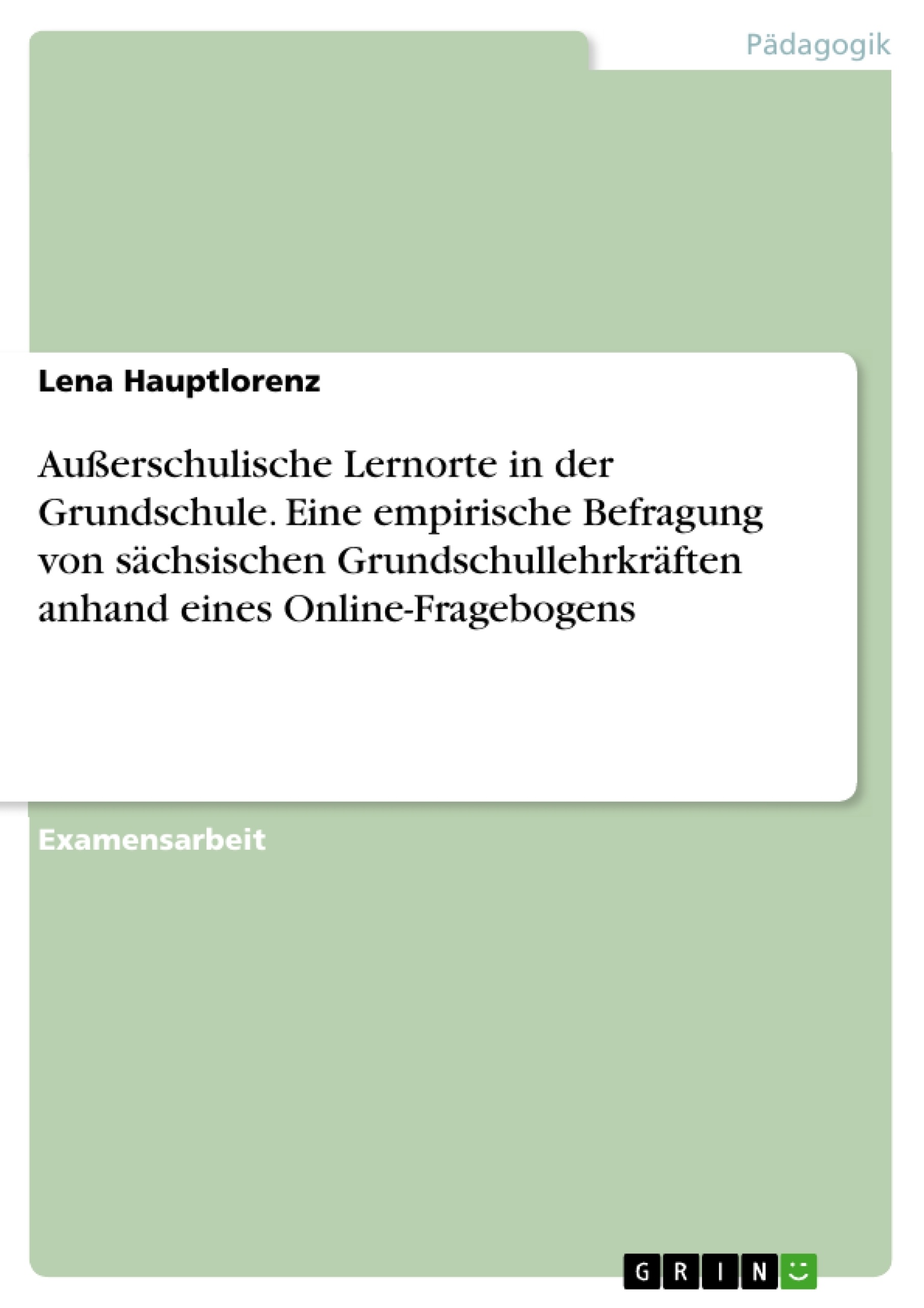Die Forscherin hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen dieser Arbeit eine empirische Befragung sächsischer Grundschullehrer anhand eines Online-Fragebogens durchzuführen. Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet dabei: "Inwieweit binden sächsische Lehrkräfte außerschulische Lernorte in den Grundschulalltag ein und welche Faktoren beeinflussen dies?". Hierbei sollen aus Sicht der Lehrpersonen die Bedeutung und Potenziale von Lernortbesuchen, deren theoretisch notwendige sowie deren tatsächliche Umsetzung im Schulalltag herausgestellt werden. Ebenso soll aufgezeigt werden, in welchen Fächern Grundschullehrkräfte ASL einbinden, und wie oft sie die fünf Lernortkategorien nach Brade und Dühlmeier nutzen. Des Weiteren werden die größten Herausforderungen aufgezeigt, die sächsische Lehrpersonen an ländlichen und städtischen Grundschulen mit Lernortbesuchen verbinden. Ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge, um das Lernen außerhalb der Schule noch besser und öfter durchführen zu können, sind dabei ebenfalls von Interesse. Die Ergebnisse dieser Erhebung liefern wertvolle Einblicke in die Grundschulpraxis, inwieweit es sächsischen Lehrern möglich ist, ihren Unterricht außerhalb des Schulgeländes durchzuführen und identifizieren mögliche Unterstützungsmaßnahmen für ländliche und städtische Grundschulen, um die Einbindung ASL besser zu fördern.
An welchen Orten lernen Grundschulkinder? Wahrscheinlich kommt bei dieser Frage als erstes die Schule als Ort der Wissensvermittlung in den Sinn. Jedoch stellt diese nur einen Lernort neben zahlreichen anderen dar. Während im ersten Zitat die Lehrkraft versucht, die Außenwelt didaktisch für ihren Unterricht zu reduzieren und diese ihren Schülern innerhalb des Klassenzimmers zu vermitteln, beschreibt das zweite Zitat die heutige Wunschvorstellung des Konzepts "Öffnung von Schule". Lernen in der Grundschule sollte dabei nicht nur das stupide Aneignen von theoretischem Wissen innerhalb des Klassenzimmers umfassen. Immer stärker wird für eine direkte Begegnung mit der realen Lebenswelt der Kinder sowie für das selbständige Erarbeiten und praktische Anwenden im Grundschulunterricht plädiert, um das Lernen handlungsorientiert und effektiver zu gestalten. In einer Welt, in der Realitäts- und Praxisbezug zunehmend verloren gehen, ist es umso wichtiger, dass Schulen ihren Grundschülern Möglichkeiten bieten, reale Erfahrungen zu machen und ihre Umwelt aktiv zu erkunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen des außerschulischen Lernens
- Begriffsdefinition „außerschulischer Lernort“
- Kategorisierung außerschulischer Lernorte
- Historie des außerschulischen Lernens
- Außerschulische Lernorte in aktuellen sächsischen Lehrplänen
- Chancen und Barrieren außerschulischen Lernens
- Potenziale außerschulischer Lernorte
- Herausforderungen außerschulischer Lernorte
- Methodischer Teil
- Forschungsstand und These
- Methodendarstellung und -begründung
- Die Gestaltung des Erhebungsinstruments
- Testgütekriterien
- Planung und Vorbereitung der Erhebung
- Stichprobenkonstruktion
- Durchführung der Erhebung
- Auswertungsmethode
- Ergebnisse der Online-Befragung
- Allgemeines
- Geschlechterverteilung
- Dienstzeit der Lehrkräfte
- Standort der Grundschulen
- Bedeutung außerschulischer Lernorte im Grundschulalltag
- Theoretisch notwendige Häufigkeit von Lernortbesuchen
- Tatsächliche Umsetzung von außerschulischem Lernen
- Fächer zum Aufsuchen außerschulischer Lernorte
- Einbindung der fünf Lernortkategorien
- Lernorte in der Naturwelt
- Lernorte in der Kulturwelt
- Lernorte in der sozialen und politischen Welt
- Lernorte in der Arbeits- und Wirtschaftswelt
- Lernorte in der Welt der Wissenschaft und Technik
- Potenziale außerschulischer Lernorte
- Herausforderungen außerschulischer Lernorte
- Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Lehrkräfte
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- Zur Bedeutung und Einbindung außerschulischer Lernorte
- Fächer zum Aufsuchen außerschulischer Lernorte
- Einbindung der fünf Lernortkategorien
- Potenziale außerschulischer Lernorte
- Herausforderungen außerschulischer Lernorte
- Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Lehrkräfte
- Maßnahmen zur Förderung und Steigerung von Lernortbesuchen
- Methodenkritische Reflexion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einbindung außerschulischer Lernorte in den Grundschulalltag in Sachsen. Ziel ist es, die Praxis sächsischer Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer zu erforschen und Herausforderungen und Potenziale dieser Lernform aufzuzeigen. Die Ergebnisse sollen Hinweise für die zukünftige Gestaltung von ausserschulischem Lernen liefern.
- Praxis der Einbindung außerschulischer Lernorte im sächsischen Grundschulkontext
- Herausforderungen bei der Umsetzung außerschulischen Lernens
- Potenziale außerschulischer Lernorte für den Lernprozess
- Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Lehrkräfte
- Implikationen für die schulische Praxis und die Lehrerausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Einbindung außerschulischer Lernorte im Grundschulalltag ein und skizziert den Forschungsstand sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie legt die Bedeutung außerschulischen Lernens für die ganzheitliche Bildung von Kindern dar und begründet die Wahl der empirischen Methode.
Theoretische Grundlagen des außerschulischen Lernens: Dieses Kapitel liefert eine umfassende theoretische Grundlage zum Thema außerschulische Lernorte. Es definiert den Begriff „außerschulischer Lernort“, kategorisiert verschiedene Arten von Lernorten und beleuchtet die historische Entwicklung dieses pädagogischen Ansatzes. Besonders wird die Relevanz außerschulischer Lernorte im Kontext der sächsischen Lehrpläne untersucht und die Chancen und Herausforderungen außerschulischen Lernens werden ausführlich diskutiert, wobei sowohl die Potenziale als auch die Schwierigkeiten beleuchtet werden.
Methodischer Teil: In diesem Kapitel wird die Methodik der durchgeführten empirischen Studie detailliert beschrieben. Es werden die Forschungsfrage und die zugrundeliegende Hypothese erläutert. Die Wahl des Online-Fragebogens als Erhebungsinstrument wird begründet und die methodischen Schritte, von der Gestaltung des Fragebogens über die Testung bis hin zur Durchführung und Auswertung, werden transparent dargestellt. Die Stichprobenziehung und die angewandte Auswertungsstrategie (SPSS) werden genau spezifiziert, um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse sicherzustellen.
Ergebnisse der Online-Befragung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Online-Befragung von sächsischen Grundschullehrkräften. Die Daten werden umfassend dargestellt und analysiert, beginnend mit allgemeinen demografischen Merkmalen der Befragten (Geschlecht, Dienstzeit, Schulstandort). Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von außerschulischen Lernorten im Grundschulalltag, der tatsächlichen Häufigkeit von Lernortbesuchen, den bevorzugten Fächern und den verschiedenen Kategorien von Lernorten (Natur, Kultur, soziale/politische Welt, Arbeitswelt, Wissenschaft/Technik). Sowohl positive Aspekte (Potenziale) als auch negative Aspekte (Herausforderungen) der Einbindung außerschulischer Lernorte werden anhand der empirischen Daten aufgezeigt.
Interpretation und Diskussion der Ergebnisse: Das Kapitel interpretiert und diskutiert die im vorherigen Kapitel präsentierten Ergebnisse. Es analysiert die Bedeutung der Einbindung außerschulischer Lernorte, die Auswahl der Fächer und die Nutzung der verschiedenen Lernortkategorien im Detail. Die Ergebnisse werden im Kontext der theoretischen Grundlagen diskutiert und die Potenziale und Herausforderungen werden im Lichte der empirischen Befunde erneut beleuchtet. Es werden Wünsche und Verbesserungsvorschläge der befragten Lehrkräfte berücksichtigt, und schließlich werden Maßnahmen zur Förderung von außerschulischem Lernen vorgeschlagen. Abschließend wird eine kritische Reflexion der angewendeten Methode vorgenommen.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, Grundschule, Sachsen, Empirische Befragung, Online-Fragebogen, Lehrkräfte, Lernorte, Potenziale, Herausforderungen, Lehrplan, Bildung, Praxis, Qualitative Forschung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einbindung außerschulischer Lernorte in den sächsischen Grundschulalltag
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einbindung außerschulischer Lernorte in den sächsischen Grundschulalltag. Sie erforscht die Praxis sächsischer Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer und zeigt Herausforderungen und Potenziale dieser Lernform auf. Ziel ist es, Hinweise für die zukünftige Gestaltung außerschulischen Lernens zu liefern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die Praxis der Einbindung außerschulischer Lernorte im sächsischen Grundschulkontext, die Herausforderungen bei der Umsetzung außerschulischen Lernens, die Potenziale außerschulischer Lernorte für den Lernprozess, die Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Lehrkräfte sowie Implikationen für die schulische Praxis und die Lehrerausbildung.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Methode. Es wurde eine Online-Befragung von sächsischen Grundschullehrkräften durchgeführt. Der methodische Teil beschreibt detailliert die Forschungsfrage, die Hypothese, die Gestaltung des Online-Fragebogens, die Testung, die Durchführung und die Auswertung der Daten mit SPSS. Die Stichprobenziehung wird ebenfalls genau spezifiziert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen des außerschulischen Lernens, Methodischer Teil, Ergebnisse der Online-Befragung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Die theoretischen Grundlagen umfassen die Begriffsdefinition „außerschulischer Lernort“, die Kategorisierung außerschulischer Lernorte, die Historie des außerschulischen Lernens, die Darstellung außerschulischer Lernorte in aktuellen sächsischen Lehrplänen sowie eine Diskussion der Chancen und Barrieren außerschulischen Lernens (Potenziale und Herausforderungen).
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Online-Befragung werden umfassend dargestellt und analysiert. Dies beinhaltet demografische Merkmale der Befragten (Geschlecht, Dienstzeit, Schulstandort), die Bedeutung außerschulischer Lernorte im Grundschulalltag, die tatsächliche Häufigkeit von Lernortbesuchen, die bevorzugten Fächer und die Nutzung verschiedener Lernortkategorien (Natur, Kultur, soziale/politische Welt, Arbeitswelt, Wissenschaft/Technik). Sowohl Potenziale als auch Herausforderungen werden anhand der empirischen Daten aufgezeigt.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse analysiert die Bedeutung der Einbindung außerschulischer Lernorte, die Auswahl der Fächer und die Nutzung der verschiedenen Lernortkategorien im Detail. Die Ergebnisse werden im Kontext der theoretischen Grundlagen diskutiert, Potenziale und Herausforderungen werden im Lichte der empirischen Befunde erneut beleuchtet. Wünsche und Verbesserungsvorschläge der befragten Lehrkräfte werden berücksichtigt und Maßnahmen zur Förderung außerschulischen Lernens vorgeschlagen. Eine methodenkritische Reflexion schließt das Kapitel ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Außerschulisches Lernen, Grundschule, Sachsen, Empirische Befragung, Online-Fragebogen, Lehrkräfte, Lernorte, Potenziale, Herausforderungen, Lehrplan, Bildung, Praxis, Qualitative Forschung.
- Citar trabajo
- Lena Hauptlorenz (Autor), 2023, Außerschulische Lernorte in der Grundschule. Eine empirische Befragung von sächsischen Grundschullehrkräften anhand eines Online-Fragebogens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1440970