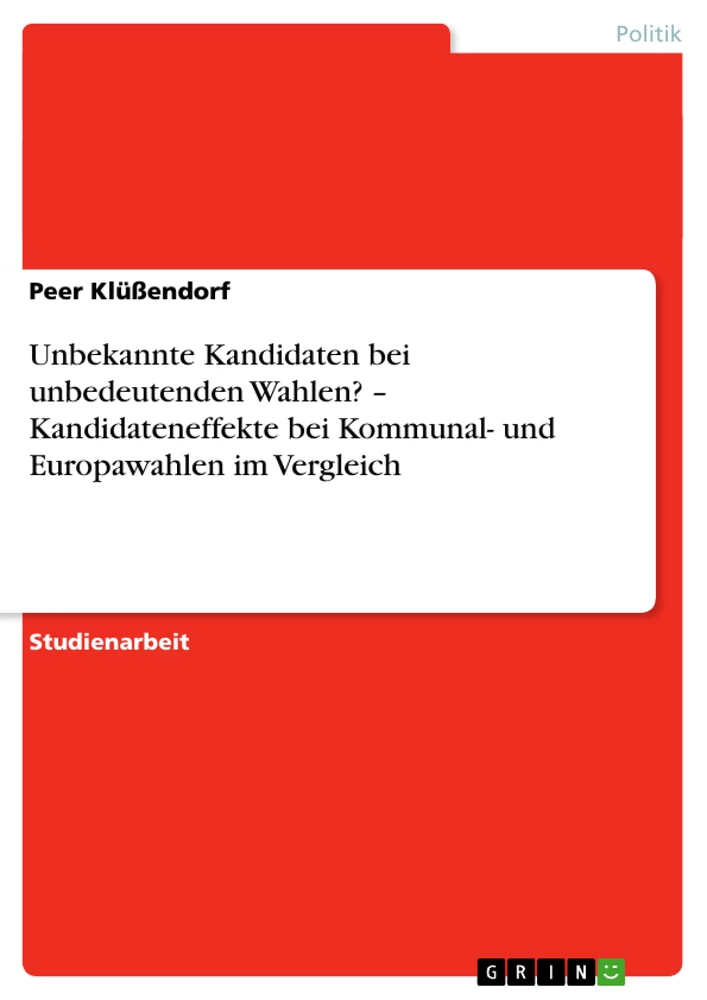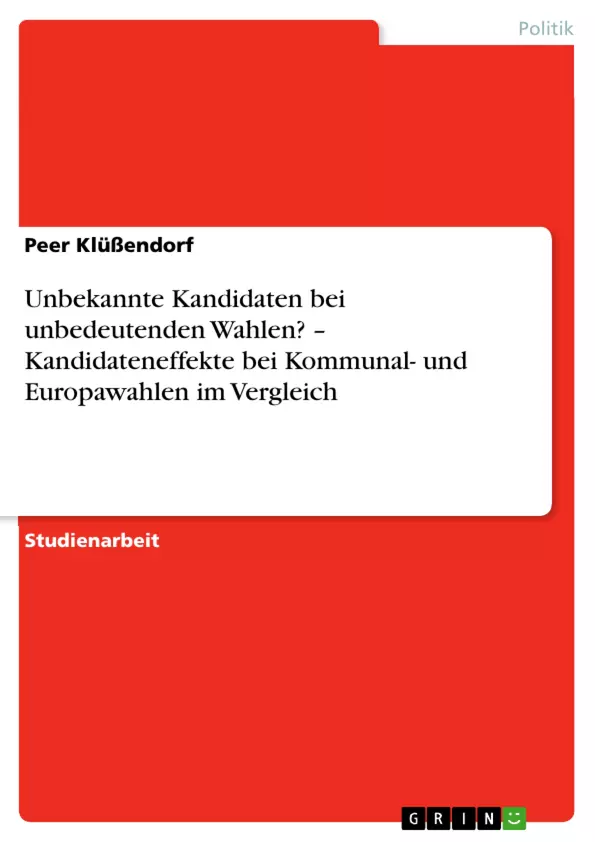Martin Schulz und Hans-Gert Pöttering.
Namen, die der europapolitisch interessierte Politikwissenschaftler mit den jetzigen und ehemaligen Vorsitzenden von zwei großen Fraktionen des Europaischen Parlamentes in Verbindung bringt.
Namen, die der politisch durchschnittlich informierte Wähler in den seltensten Fällen überhaupt mit etwas in Verbindung bringen kann – obwohl beide bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 07. Juni 2009 die Spitzenkandidaten ihrer Partei waren.
So erreichte Hans-Gert Pöttering (CDU) wenige Tage vor der Europawahl einen Bekanntheitsgrad von 2% in einer repräsentativen Umfrage.
Derartige Umfragewerte werfen die Fragen auf, wieso europäische Spitzenpolitiker in der Bevölkerung weitgehend unbekannt sind und inwiefern sie als Kandidaten deshalb überhaupt einen Einfluss auf das Ergebnis der Europawahlen haben können.
Ein Erklärungsansatz dafür wird in der „Ferne“ der Arbeit des europäischen Parlaments zum politischen Alltag der Wähler gesehen. Demnach müssten gerade bei Kommunalwahlen die zur Wahl stehenden Personen von größter Bedeutung sein, auch wenn sich auf dieser Ebene eine äußerst geringe Wahlbeteiligung feststellen lässt. Gerade diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die in der Wahrnehmung und im Einfluss der Kandidaten bei Kommunal- und Europawahlen existieren, gilt es im Folgenden zu untersuchen.
Da am 07. Juni 2009 in Rostock zeitgleich die Wahlen zur Rostocker Bürgerschaft und zum Europäischen Parlament stattfanden, konnten unter gleichen Rahmenbedingungen Einstellungen zu den Kandidaten auf unterschiedlichen Ebenen erfragt werden. Dazu wurde in Rostock-Dierkow ein Exit-Poll mit 157 Wählern durchgeführt, auf dessen Ergebnisse in dieser Hausarbeit im Speziellen eingegangen wird.
Zuvor werden die theoretischen Grundlagen der Kandidateneffekte auf kommunaler und europäischer Ebene näher erläutert, um die darauf aufbauenden Hypothesen überprüfen zu können.
Auf Grund der geringen Bezugsmöglichkeiten zur Fachliteratur soll sich daher in der folgenden Argumentation insbesondere auf die Ergebnisse des Rostocker Exit-Polls gestützt und weiterführende Hypothesen zu den Kandidateneffekten bei Kommunal- und Europawahlen aufgestellt werden.
Anhand dieser Erkenntnisse wird ausblickend überprüft, ob dem politischen Personal auf den untersuchten Ebenen in Zukunft eine größere Bedeutung in der politikwissenschaftlichen Analyse zugemessen werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlegung
- 2.1. „Personalisierung“ der Wahlentscheidung
- 2.2. Kandidateneffekte bei Kommunal- und Europawahlen
- 2.3. Hypothesen
- 3. Analyse der Umfrage
- 3.1. Analyse des Fragebogens
- 3.2. Erwartungen an die Kandidaten
- 3.3. Einfluss der Kandidaten auf das Rostocker Wahlergebnis
- 4. Kandidaten bei Kommunal- und Europawahlen - eine vernachlässigbare Größe?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Kandidaten auf das Wahlergebnis bei Kommunal- und Europawahlen. Im Fokus stehen die Herausforderungen der geringen Bekanntheit von Kandidaten, insbesondere auf europäischer Ebene, und deren Auswirkungen auf die Wahlentscheidung der Wähler. Dabei wird die Frage nach der Bedeutung von Kandidatenorientierung im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren wie Parteiidentifikation und Issue-Orientierung beleuchtet. Die Arbeit stützt sich dabei auf Ergebnisse einer Exit-Poll in Rostock-Dierkow, die zeitgleich zur Wahl zur Rostocker Bürgerschaft und zum Europäischen Parlament im Juni 2009 durchgeführt wurde.
- Kandidateneffekte bei Kommunal- und Europawahlen
- Personalisierung der Wahlentscheidung
- Einflussfaktoren auf das Wahlverhalten
- Analyse von Exit-Poll-Daten
- Bewertung der Bedeutung von Kandidaten im Wahlprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit dar. Es wird auf die geringe Bekanntheit von Kandidaten bei Europawahlen hingewiesen und der Vergleich zu Kommunalwahlen hergestellt. Die theoretische Grundlegung behandelt den Einfluss von Kandidaten auf die Wahlentscheidung, wobei das Ann-Arbor-Modell als Ausgangspunkt dient. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Ergebnisse einer Exit-Poll in Rostock-Dierkow. Die Ergebnisse der Umfrage werden vorgestellt und analysiert, um den Einfluss von Kandidaten auf das Wahlergebnis zu bewerten. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob Kandidaten bei Kommunal- und Europawahlen eine vernachlässigbare Größe darstellen.
Schlüsselwörter
Kandidateneffekte, Kommunalwahlen, Europawahlen, Personalisierung, Wahlentscheidung, Exit-Poll, Parteiidentifikation, Issue-Orientierung, Wahlverhalten, Rostocker Bürgerschaft, Europäisches Parlament.
Warum sind Spitzenkandidaten bei Europawahlen oft unbekannt?
Ein Grund ist die wahrgenommene „Ferne“ des EU-Parlaments zum politischen Alltag der Wähler, was zu geringer medialer Präsenz und Bekanntheit führt.
Haben unbekannte Kandidaten einen Einfluss auf das Wahlergebnis?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und vergleicht Kandidateneffekte auf kommunaler Ebene mit denen auf europäischer Ebene.
Was ist ein Exit-Poll?
Eine Befragung von Wählern unmittelbar nach der Stimmabgabe vor dem Wahllokal, um Wählermotive und Trends zu analysieren.
Welche Rolle spielt die Parteiidentifikation im Vergleich zum Kandidaten?
Bei geringer Bekanntheit der Kandidaten (wie oft bei der EU-Wahl) rückt die Parteiidentifikation als Entscheidungshilfe stärker in den Vordergrund.
Welches konkrete Ereignis wurde in Rostock untersucht?
Die zeitgleichen Wahlen zur Rostocker Bürgerschaft und zum Europäischen Parlament am 7. Juni 2009.
- Arbeit zitieren
- Peer Klüßendorf (Autor:in), 2009, Unbekannte Kandidaten bei unbedeutenden Wahlen? – Kandidateneffekte bei Kommunal- und Europawahlen im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144104