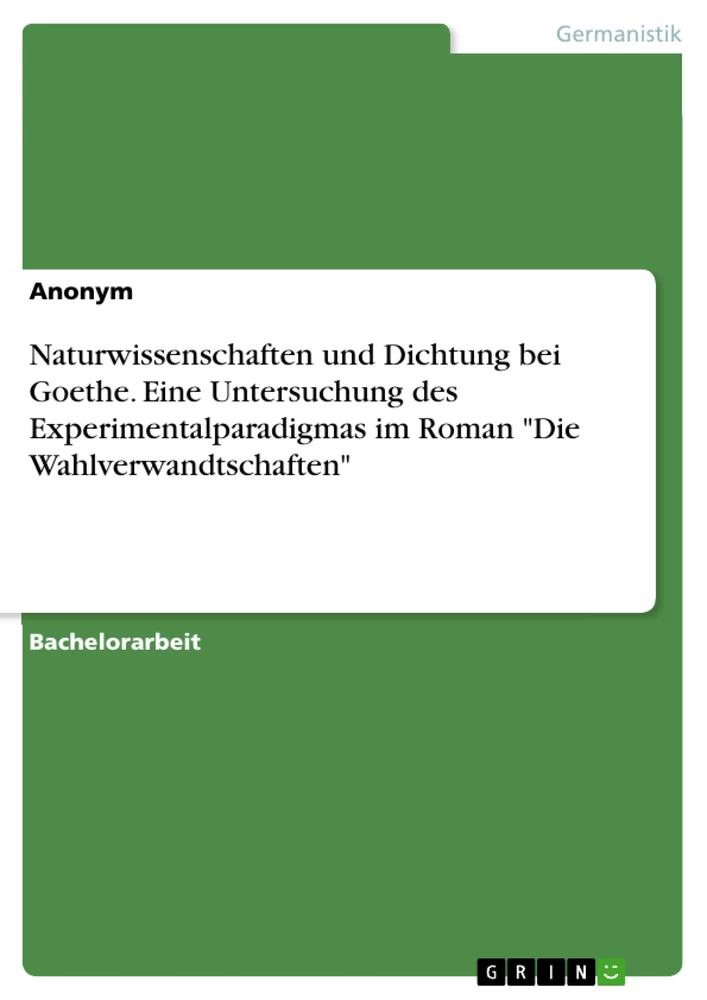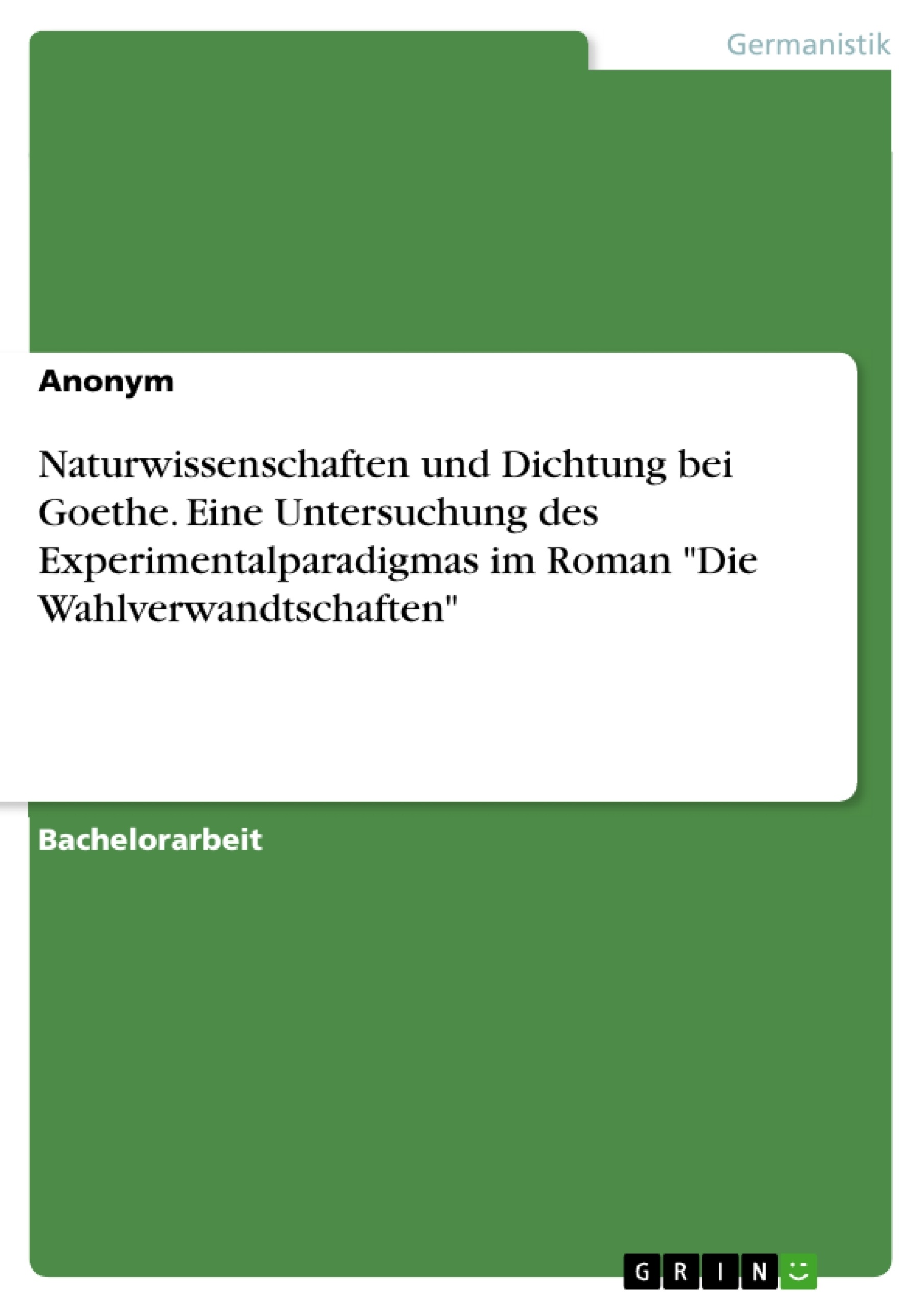Der Roman "Die Wahlverwandtschaften" ist nicht nur aufgrund seiner Interferenzen von Naturwissenschaften und Literatur für die Forschung von Bedeutung, sondern weil er darüber hinaus den Umbruch, der sich wissenschaftshistorisch vollzog, verhandelt. Diese These wurde in der Forschung bereits mehrfach aufgestellt, allerdings ohne sie weiter auszuführen. Deshalb ist es das Ziel dieser Arbeit, darzulegen, inwiefern der Roman den Umbruch vom Einheits- zum Differenzdenken reflektiert und problematisiert.
Goethe gilt als einer der letzten Universalgelehrten, der bestrebt war, Dichtung und Naturforschung in seinem Schaffen zu verbinden. Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass sich im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert ein tiefgreifender Paradigmenwechsel vollzog, in dessen Folge sich die seit der Antike bestehende Einheit von Naturwissenschaft und Dichtung allmählich auflöste. Diese Trennung festige sich im Laufe des 19. Jahrhunderts und mündete in dem bis heute bestehenden Dualismus von Natur- und Geisteswissenschaften.
Die Relation von Literatur und Wissenschaft rückte Mitte des 20. Jahrhunderts ins Interesse der Forschung und ist seitdem Gegenstand verschiedenster kultur- wissenschaftlicher sowie wissenschaftshistorischer Forschungsrichtungen.
Das Forschungsinteresse galt dabei auch immer wieder Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften", der "wie kein anderer Text auf der Grenze zwischen wissenschaftlichen und poetischen Argumentationsfeldern steht".
Da "Die Wahlverwandtschaften" ein breites Spektrum zeitgenössischer Naturwissenschaft verhandeln, ist es erforderlich, sich auf einen Aspekt zu beschränken. Das Experiment eignet sich, wie gezeigt werden wird, dafür in besonderem Maße, weil es als tertium comparationis von Wissenschaft und Literatur sowohl deren Einheit als auch Differenz offenlegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Naturwissenschaft und Dichtung um 1800
- Goethes Wissenschaftsbegriff
- Naturwissenschaft und Dichtung bei Goethe
- Das Experiment um 1800
- Goethes Haltung zu Experimenten
- Experiment und Literatur
- Das Experiment in den Wahlverwandtschaften
- Die Wahlverwandtschaften als Gattungsexperiment
- Goethes Haltung zum Gattungsexperiment
- Tagebuch und Aphorismus: zwischen Naturwissenschaft und Dichtung
- Ottilies Tagebuch
- Der Erzähler als Naturforscher
- Objektivität des Erzählers
- Wandel der Erzählhaltung
- Ironisierung des Erzählers
- Die Figuren als chemische Substanzen
- Die Figuren als Objekte und Subjekte
- Die Experimente der Figuren
- Die Vermessungen des Hauptmanns
- Die Gleichnisrede
- Das Pendelexperiment
- Eduards Selbstversuch
- Exkurs
- Die Polarität der Figuren
- Einheit und Trennung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Naturwissenschaften und Poesie im Werk Goethes, insbesondere mit dem Roman „Die Wahlverwandtschaften“. Sie zielt darauf ab, zu zeigen, wie dieser Roman den Umbruch vom Einheits- zum Differenzdenken reflektiert und problematisiert, indem er das Experiment als tertium comparationis von Wissenschaft und Literatur einsetzt.
- Die historische Entwicklung der Trennung von Naturwissenschaft und Dichtung im 18. und 19. Jahrhundert
- Goethes wissenschaftliche und poetische Ansätze sowie seine Haltung zum Experiment
- Die Rolle des Experiments als verbindendes und trennendes Element zwischen Wissenschaft und Literatur im Roman „Die Wahlverwandtschaften“
- Die Analyse des Experimentalparadigmas auf den Ebenen der Gattung, des Erzählers und der Figuren
- Die Darstellung des Romans als Gattungsexperiment, das die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Dichtung erforscht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit vor, indem sie auf die historische Entwicklung der Trennung von Naturwissenschaft und Dichtung sowie Goethes Position in diesem Kontext eingeht. Im zweiten Kapitel werden die Hintergründe der Trennung von Dichtung und Naturwissenschaften skizziert und Goethes Wissenschaftsbegriff erläutert, um ein Verständnis für die historischen Zusammenhänge zu schaffen. Kapitel drei widmet sich dem Experiment als tertium comparationis von Wissenschaft und Literatur im 19. Jahrhundert, wobei Goethes Haltung zu Experimenten sowie deren Bedeutung in der Literatur beleuchtet werden. Im vierten Kapitel wird das Experimentalparadigma des Romans auf der Ebene der Gattung untersucht, indem die „Wahlverwandtschaften“ als Gattungsexperiment vorgestellt werden. Kapitel fünf befasst sich mit dem Erzähler als Naturforscher und analysiert die Objektivität, den Wandel der Erzählhaltung und die Ironisierung des Erzählers im Roman. Im sechsten Kapitel werden die Figuren als chemische Substanzen betrachtet und ihre Experimente, sowie die Polarität und Einheit der Figuren untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Naturwissenschaft und Dichtung, Experiment, Goethes „Die Wahlverwandtschaften“, Gattungsexperiment, Erzählperspektive, Figuren, chemische Substanzen, Polarität, Einheit und Trennung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Naturwissenschaften und Dichtung bei Goethe. Eine Untersuchung des Experimentalparadigmas im Roman "Die Wahlverwandtschaften", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1441051