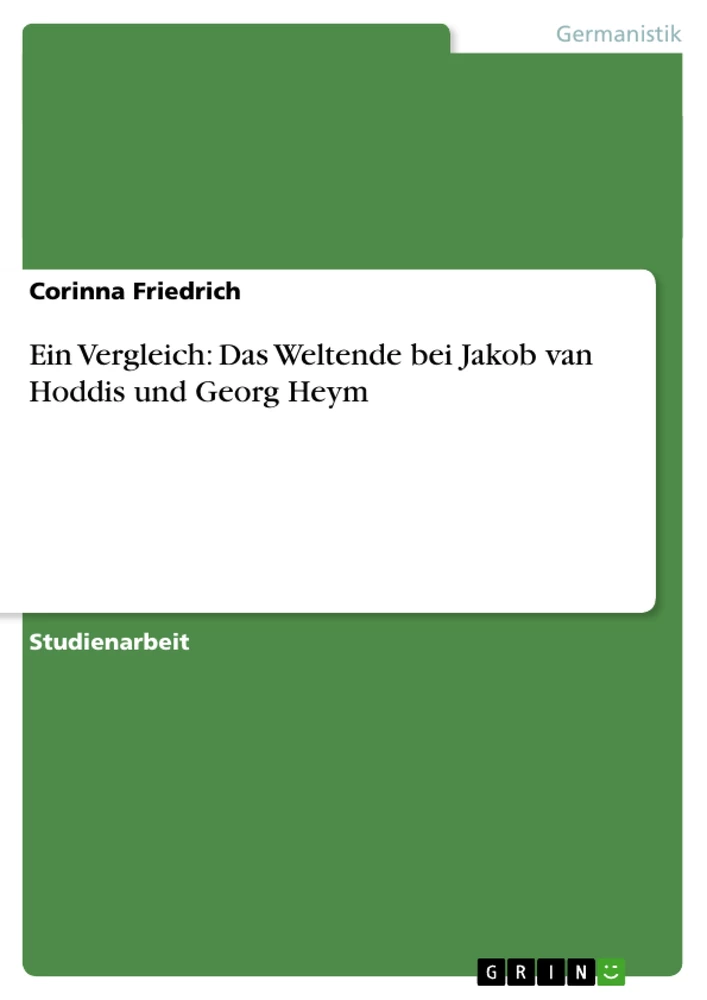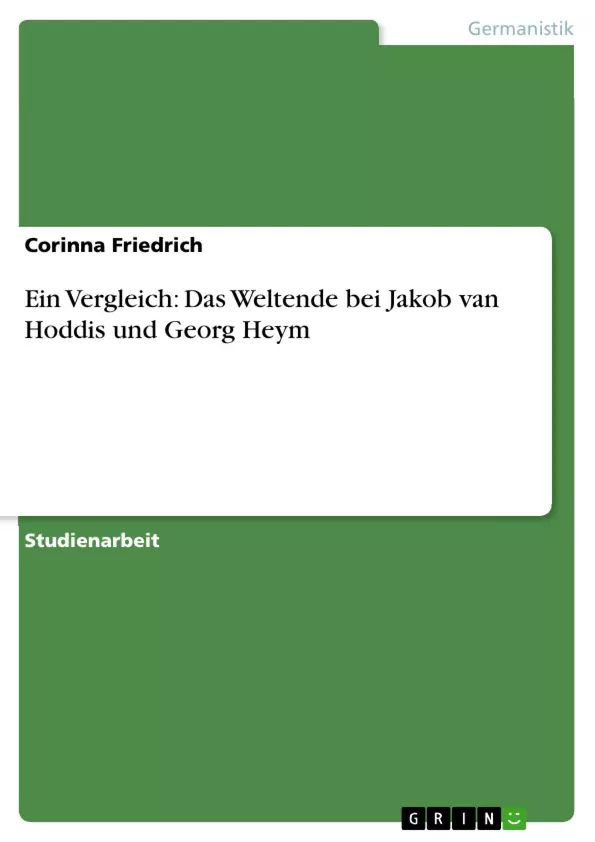Die Epoche des Expressionismus ist gekennzeichnet durch Industrialisierung und Automatisierung sowie Anonymisierung und Verelendung. Der Erfahrungsbereich der Großstadt spielte in der Zeit des Expressionismus eine wichtige Rolle in der Literatur. Ohne die unmittelbare Großstadterfahrung wäre der Expressionismus kaum denkbar gewesen. Die Stadt bot den Schriftstellern eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Themen und Bildern, auf die sie in ihren Werken zurückgreifen konnten. Gegenstand dieser Arbeit sind die Gedichte Weltende von Jakob van Hoddis und Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen von Georg Heym, welche zum Signal der Zeit um 1910 wurden. Beide Gedichte thematisieren ein Weltende. Ich werde in meiner Arbeit jedes Werk vorstellen und interpretieren und im Resümee auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Umsetzung des Themas Weltende eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Jakob van Hoddis und Georg Heym im Expressionismus
- Jakob van Hoddis: Weltende
- Wirkungsgeschichte
- Formale Aspekte
- Interpretation
- Darstellung des Bürgers
- Georg Heym: Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen
- Wirkungsgeschichte
- Formale Aspekte
- Interpretation
- Vergleich und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Gedichte „Weltende“ von Jakob van Hoddis und „Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen“ von Georg Heym im Kontext des Expressionismus. Ziel ist es, die jeweiligen Gedichte zu interpretieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Darstellung des „Weltende“-Motivs herauszuarbeiten.
- Das Motiv des „Weltende“ im frühen 20. Jahrhundert
- Der Einfluss der Großstadt auf die expressionistische Lyrik
- Formale und stilistische Aspekte der Gedichte
- Die Darstellung des „Bürgers“ in den Gedichten
- Der Vergleich der poetischen Umsetzung des „Weltende“-Motivs bei Hoddis und Heym
Zusammenfassung der Kapitel
Jakob van Hoddis und Georg Heym im Expressionismus: Dieses Kapitel führt in die Epoche des Expressionismus ein, betont die Bedeutung der Großstadterfahrung und den gesellschaftlichen Kontext der Industrialisierung und Verelendung. Es stellt die beiden Gedichte „Weltende“ und „Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen“ als zentrale Werke dieser Epoche vor und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit.
Jakob van Hoddis: Weltende: Dieses Kapitel analysiert das berühmte Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis. Es beleuchtet die Wirkungsgeschichte des Gedichts als Signal des beginnenden Expressionismus und interpretiert dessen formale und inhaltliche Aspekte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung des „Bürgers“ und dem Gefühl der bevorstehenden Katastrophe, das in dem Gedicht eindrücklich vermittelt wird. Der Einfluss des Halleyschen Kometen und die damit verbundene Panikstimmung werden ebenfalls berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Jakob van Hoddis, Georg Heym, Weltende, Großstadtlyrik, Industrialisierung, Verelendung, Bürger, Interpretation, Formale Aspekte, Wirkungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jakob van Hoddis und Georg Heym im Expressionismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Gedichte "Weltende" von Jakob van Hoddis und "Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen" von Georg Heym im Kontext des Expressionismus. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Gedichte und dem Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Darstellung des "Weltende"-Motivs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Motiv des "Weltende" im frühen 20. Jahrhundert, den Einfluss der Großstadt auf die expressionistische Lyrik, formale und stilistische Aspekte der Gedichte, die Darstellung des "Bürgers" in den Gedichten und einen Vergleich der poetischen Umsetzung des "Weltende"-Motivs bei Hoddis und Heym.
Welche Gedichte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert "Weltende" von Jakob van Hoddis und "Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen" von Georg Heym. Für "Weltende" werden Wirkungsgeschichte, formale Aspekte, Interpretation und die Darstellung des Bürgers untersucht. Für Heyms Gedicht werden Wirkungsgeschichte, formale Aspekte und Interpretation behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die den Expressionismus einführen, "Weltende" von Hoddis analysieren, "Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen" von Heym analysieren und schließlich einen Vergleich und ein Resümee bieten. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Expressionismus, Jakob van Hoddis, Georg Heym, Weltende, Großstadtlyrik, Industrialisierung, Verelendung, Bürger, Interpretation, Formale Aspekte, Wirkungsgeschichte.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Gedichte "Weltende" und "Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen" zu interpretieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Darstellung des "Weltende"-Motivs herauszuarbeiten. Die Arbeit untersucht den Einfluss des gesellschaftlichen und historischen Kontextes auf die Gedichte.
Welche Aspekte von "Weltende" werden besonders hervorgehoben?
Bei der Analyse von "Weltende" wird besonderes Augenmerk auf die Darstellung des "Bürgers", das Gefühl der bevorstehenden Katastrophe und den Einfluss des Halleyschen Kometen gelegt.
- Quote paper
- Corinna Friedrich (Author), 2007, Ein Vergleich: Das Weltende bei Jakob van Hoddis und Georg Heym, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144114