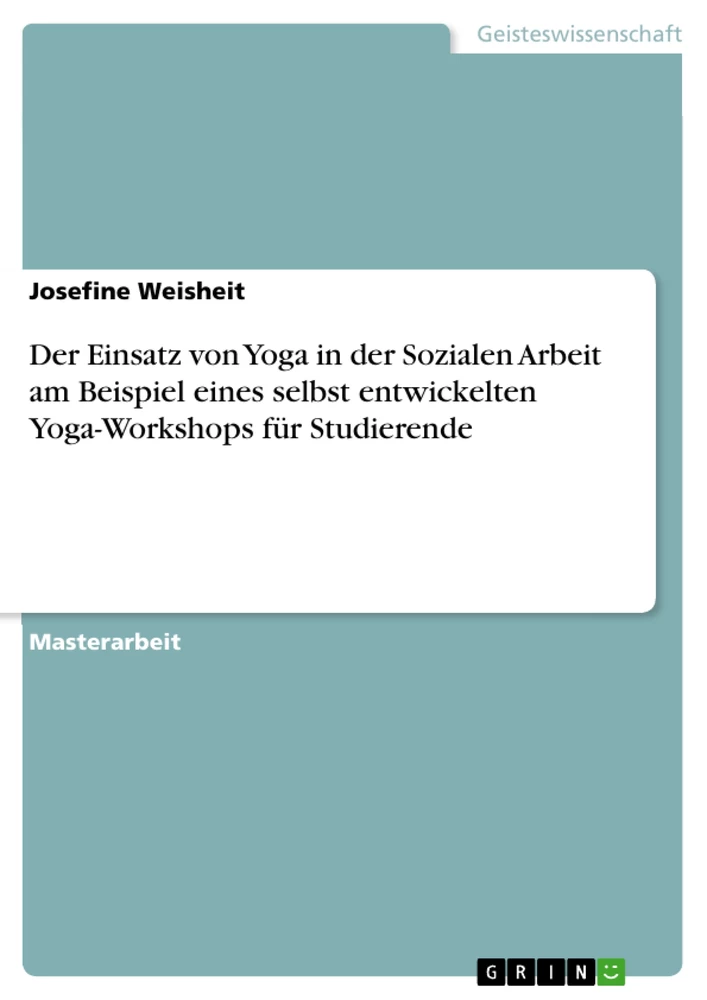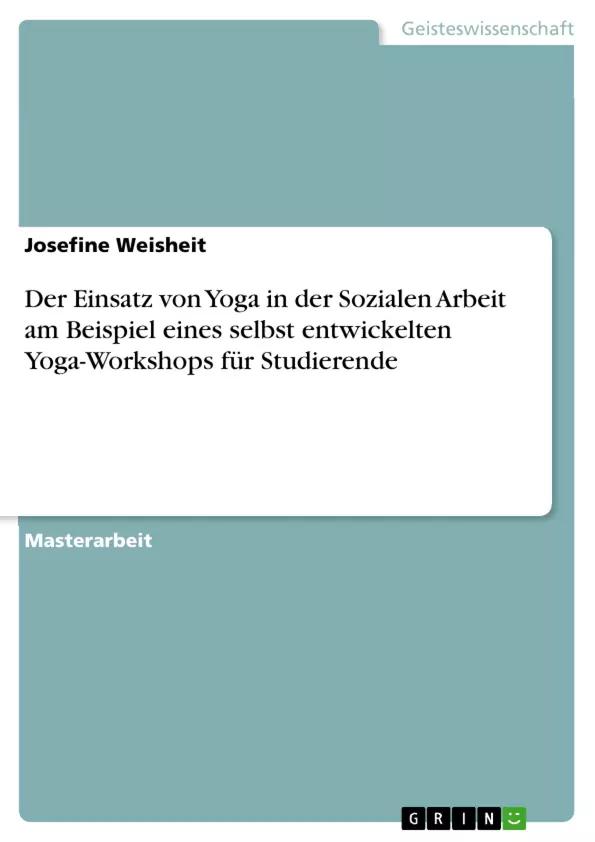Das Streben nach ganzheitlichem Wohlbefinden und gesundheitlichen Vorteilen hat Yoga in der westlichen Welt zu einer weit verbreiteten Praxis gemacht. Die präventive Wirkung und die ganzheitliche Betrachtung des Menschen tragen dazu bei, dass Yoga zunehmend auch in therapeutischen Kontexten Anwendung findet. Trotz dieser Entwicklung fehlt es in den Sozialarbeitswissenschaften noch weitgehend an einer eingehenden Auseinandersetzung mit Embodiment-Ansätzen wie Yoga.
Diese Arbeit setzt genau hier an und führt eine explorative Untersuchung zum Einsatz von Yoga in der Sozialen Arbeit durch. Die Autorin, selbst Sozialarbeitende und Yogalehrerin, entwickelte einen Yogaworkshop für Studierende der Sozialen Arbeit an der EAH-Jena. Ziel war es, herauszufinden, wie in den Sozialarbeitswissenschaften ein Bewusstsein für Yoga als komplementäre Praxis etabliert werden kann.
Der theoretische Teil beginnt mit einer grundlegenden Definition und einem historischen Überblick zu Yoga. Dabei werden insbesondere das Yogasutra von Patanjali und Hatha Yoga beleuchtet. Im Anschluss wird die Frage nach der Wirkungsweise von Yoga aufgegriffen, wobei das autonome Nervensystem, Bottom-Up- und Top-Down-Regulierung sowie aktuelle Forschungsergebnisse eine Rolle spielen.
Der Blick richtet sich dann darauf, wie Yoga in die Soziale Arbeit integriert werden kann. Gemeinsamkeiten, Möglichkeiten, Chancen, aber auch Grenzen und Bedingungen werden diskutiert, unter besonderer Berücksichtigung von Traumasensibilität und Qualifizierung. Der theoretische Teil schafft so eine Grundlage für die nachfolgende praktische Untersuchung.
Im praktischen Teil wird der entwickelte Yogaworkshop für Studierende analysiert. Durch leitfadengestützte Interviews und Gruppenauswertungen werden Erkenntnisse über den Bedarf von Studierenden an Selbstfürsorge und praktischen Fähigkeiten während ihres Studiums gewonnen. Die Ergebnisse werden mit den theoretischen Erkenntnissen verknüpft und dienen als Ausgangspunkt für weitere Forschungsvorhaben.
Diese Arbeit trägt dazu bei, den Einsatz von Yoga in den Sozialarbeitswissenschaften zu fördern. Der Fokus liegt darauf, Sozialarbeitenden ein zusätzliches Werkzeug für die individuelle Betreuung ihrer Klient:innen bereitzustellen. Durch die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung wird ein Beitrag zur Etablierung eines Bewusstseins für Yoga als komplementäre Praxis in der Sozialen Arbeit geleistet.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1 Hintergrund der Arbeit
- 2 Ziele und Aufbau
- II Theoretischer Teil
- 3 Was ist Yoga?
- 3.1 Begriffsdefinition und historischer Überblick
- 3.2 Das Yogasutra von Patanjali
- 3.3 Hatha Yoga
- 3.4 Im Yoga verwendete Techniken
- 3.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse
- 4 Wie wirkt Yoga?
- 4.1 Das autonome Nervensystem
- 4.2 Bottom-up und Top-down Regulierung durch Yoga
- 4.3 Aktueller Forschungsstand
- 4.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse
- 5 Wie kann Yoga in die Sozialen Arbeit integriert werden?
- 5.1 Gemeinsamkeiten
- 5.2 Möglichkeiten und Chancen
- 5.3 Grenzen und Bedingungen
- 5.4 Traumasensibilität und Qualifizierung
- 5.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse
- 3 Was ist Yoga?
- III Praktischer Teil
- 6 Der Workshop – Vorüberlegungen
- 6.1 Inhalt und Aufbau
- 6.2 Teilnehmende und Ablauf
- 7 Vorgehen zur Auswertung
- 8 Darstellung der Ergebnisse
- 8.1 Ergebnisse der Gruppenauswertung
- 8.2 Ergebnisse der Interviews
- 8.3 Zusammenfassung der Erkenntnisse und Diskussion
- 6 Der Workshop – Vorüberlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration von Yoga in die Soziale Arbeit. Sie analysiert den theoretischen Hintergrund von Yoga, seine Wirkungen auf das menschliche Wohlbefinden und die Möglichkeiten und Grenzen seiner Anwendung in der Sozialen Arbeit.
- Die Bedeutung von Yoga für die körperliche und mentale Gesundheit
- Die Wirkmechanismen von Yoga auf das autonome Nervensystem
- Die Integration von Yoga in die Soziale Arbeit, insbesondere in Bezug auf Trauma und Stress
- Die Rolle der Traumasensibilität und Qualifizierung von Sozialarbeiter*innen
- Die Ergebnisse eines Workshops zur Erprobung von Yoga-Methoden in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieser Abschnitt legt den Grundstein der Arbeit, indem er den aktuellen Forschungsstand und die Relevanz der Integration von Yoga in die Soziale Arbeit beleuchtet.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse von Yoga als Konzept und Praxis. Es behandelt verschiedene Yoga-Stile, die Funktionsweise des autonomen Nervensystems und den Einfluss von Yoga auf dieses System.
- Kapitel 3: Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Potenziale und Herausforderungen der Integration von Yoga in die Soziale Arbeit. Es werden die Gemeinsamkeiten zwischen Yoga und Sozialer Arbeit erörtert, sowie Chancen und Grenzen der Anwendung von Yoga in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf und die Inhalte eines Workshops, der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von Yoga-Methoden in der Sozialen Arbeit.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse des Workshops und stellt die gewonnenen Erkenntnisse aus der Gruppenauswertung und den Interviews dar.
Schlüsselwörter
Yoga, Soziale Arbeit, Traumasensibilität, Autonomes Nervensystem, Workshop, Gruppenauswertung, Interviews, Integrative Ansätze, Psycho-soziale Gesundheit, Mindfulness, Achtsamkeit, Selbstregulation, Stressbewältigung.
- Citar trabajo
- Josefine Weisheit (Autor), 2023, Der Einsatz von Yoga in der Sozialen Arbeit am Beispiel eines selbst entwickelten Yoga-Workshops für Studierende, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1441638