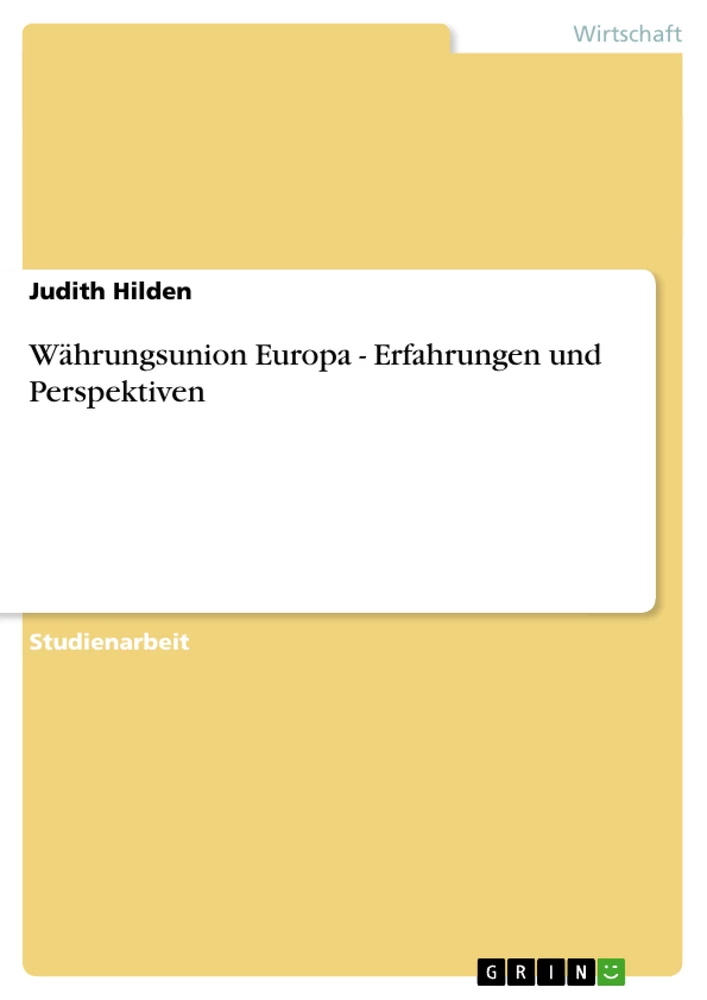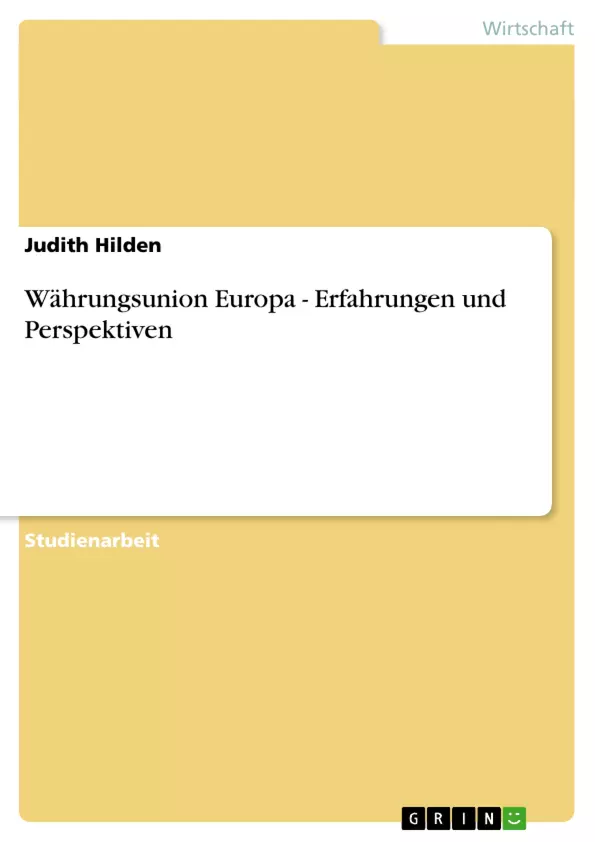„Im Sinne des Währungsgesetzes (1948) und vorherrschenden Sprachgebrauchs
Bezeichnung für die konkrete Gestalt des nationalen Geldwesens“ (GEIGANT
u.a. 1983, 729).
„Die Einheit des gesetzlichen Zahlungsmittels und die Geldordnung eines Landes
bzw. eines Währungsgebiets. Der Außenwert einer Währung bezeichnet ihre
Kaufkraft im Ausland. Er wird durch den jeweiligen Wechselkurs im Verhältnis zu
den einzelnen ausländischen Währungen ausgedrückt. Entsprechend ihrem
Verhältnis zum Gold unterscheidet man sogenannten Goldwährungen (das sind
Währungen, für die die Notenbank zum Tausch gegen Gold verpflichtet ist und
für die eine entsprechende Goldreserve auch tatsächlich vorhanden sein muß)
und an keinen Metallwert gebundene Papierwährungen. Von einer Indexwährung
spricht man, wenn der Geldwert an einen bestimmten Preisindex gekoppelt ist“
(vgl. Microsoft Encarta Enzyklopädie, 1998). „Unwiderrufliche Fixierung des Wechselkurses zwischen zwei oder mehreren
Währungen, oder durch die Übernahme einer neuen gemeinsamen Währung“
(GABLER 1997).
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsdefinitionen
- Definition „Währung“
- Definition „Währungsunion“
- Definition „Wirtschafts- und Währungsunion“
- Schritte zur währungspolitischen Integration
- Der Maastrichter Vertrag
- Die Phasen der EWU-Bildung
- Phasen der Euro-Einführung
- Die Vorbereitungsschritte in Phase A (Mai bis Dezember 1998)
- Umstellung des Buchgeldes in Phase B (1999-2001)
- Bargeldaustausch in Phase C (erste Hälfte 2002)
- Die Europäische Zentralbank
- Gründung der Europäischen Zentralbank
- Aufgaben der Europäischen Zentralbank
- Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank
- Konvergenzkriterien
- Chancen und Risiken der Währungsunion
- Volkswirtschaftliche Vorteile
- Chancen für den Arbeitsmarkt
- Währungsunion als Perspektive für Deutschland? – Eine kritische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Europäischen Währungsunion, analysiert deren Entwicklung und beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit der Einführung des Euro verbunden sind.
- Definition und Entwicklung der Währungsunion
- Wichtige Meilensteine der europäischen Integration im Währungs- und Wirtschaftsbereich
- Die Rolle der Europäischen Zentralbank
- Konvergenzkriterien und deren Bedeutung
- Volkswirtschaftliche und arbeitsmarktbezogene Auswirkungen der Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten Kapitel legen den Grundstein für das Verständnis der Währungsunion, indem sie die relevanten Begriffe wie „Währung", „Währungsunion" und „Wirtschafts- und Währungsunion" definieren. Es wird die historische Entwicklung der europäischen Integration im währungspolitischen Bereich aufgezeigt, angefangen von den Römischen Verträgen bis zum Maastrichter Vertrag. Die Einführung des Euro wird in drei Phasen beschrieben.
Die Europäische Zentralbank, ihre Gründung, Aufgaben und Unabhängigkeit werden im Detail erläutert. Die Konvergenzkriterien, die ein wichtiger Bestandteil der europäischen Integration sind, werden ebenfalls besprochen.
In den weiteren Kapiteln werden die Chancen und Risiken der Währungsunion beleuchtet. Dabei werden sowohl die volkswirtschaftlichen Vorteile als auch die möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt betrachtet. Die Diskussion über die Währungsunion aus der Sicht Deutschlands stellt kritische Punkte in den Vordergrund.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion, Euro, Wirtschafts- und Währungsunion, Europäische Zentralbank, Konvergenzkriterien, Chancen und Risiken, volkswirtschaftliche Auswirkungen, Arbeitsmarkt, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer Währungsunion und einer Wirtschaftsunion?
Eine Währungsunion fixiert Wechselkurse oder führt eine gemeinsame Währung ein, während eine Wirtschaftsunion zusätzlich die Wirtschaftspolitik koordiniert.
In welchen Phasen wurde der Euro eingeführt?
In Phase A (Vorbereitung), Phase B (Umstellung des Buchgeldes 1999-2001) und Phase C (Bargeldaustausch 2002).
Welche Aufgaben hat die Europäische Zentralbank (EZB)?
Die EZB sichert die Preisstabilität, verwaltet die Währungsreserven und legt die Geldpolitik für das Euro-Währungsgebiet fest.
Was sind die Konvergenzkriterien?
Es sind wirtschaftliche Bedingungen (z.B. Preisstabilität, Haushaltsdisziplin), die EU-Staaten erfüllen müssen, um der Währungsunion beizutreten.
Welche Risiken birgt die Währungsunion für Deutschland?
Die Arbeit diskutiert kritisch den Verlust der nationalen Währungssouveränität und die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt.
- Quote paper
- Judith Hilden (Author), 2002, Währungsunion Europa - Erfahrungen und Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14427