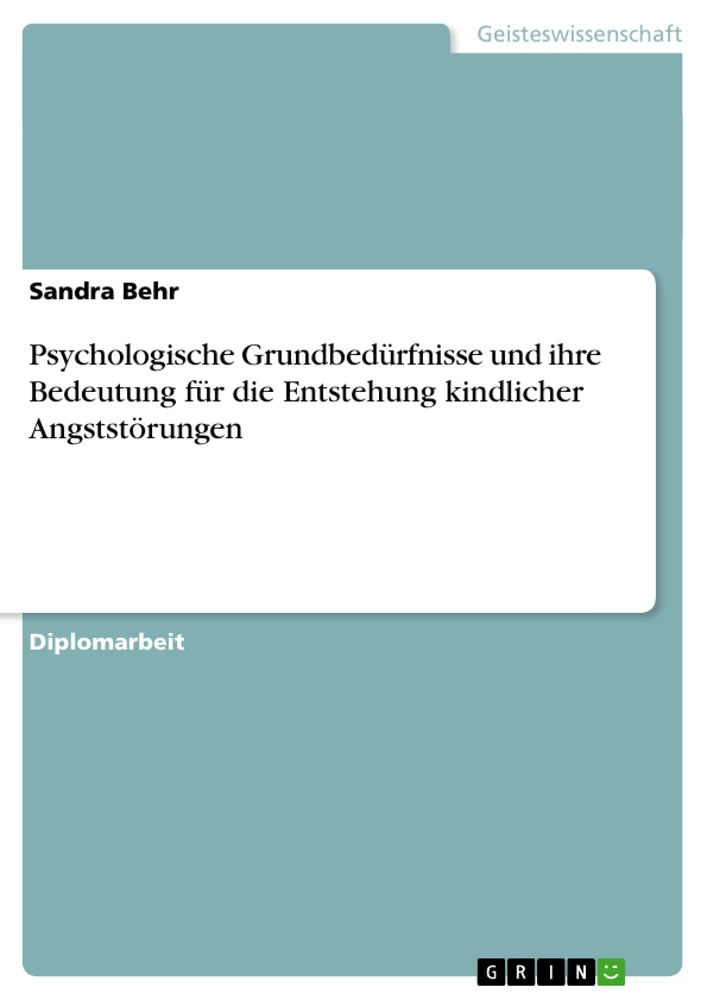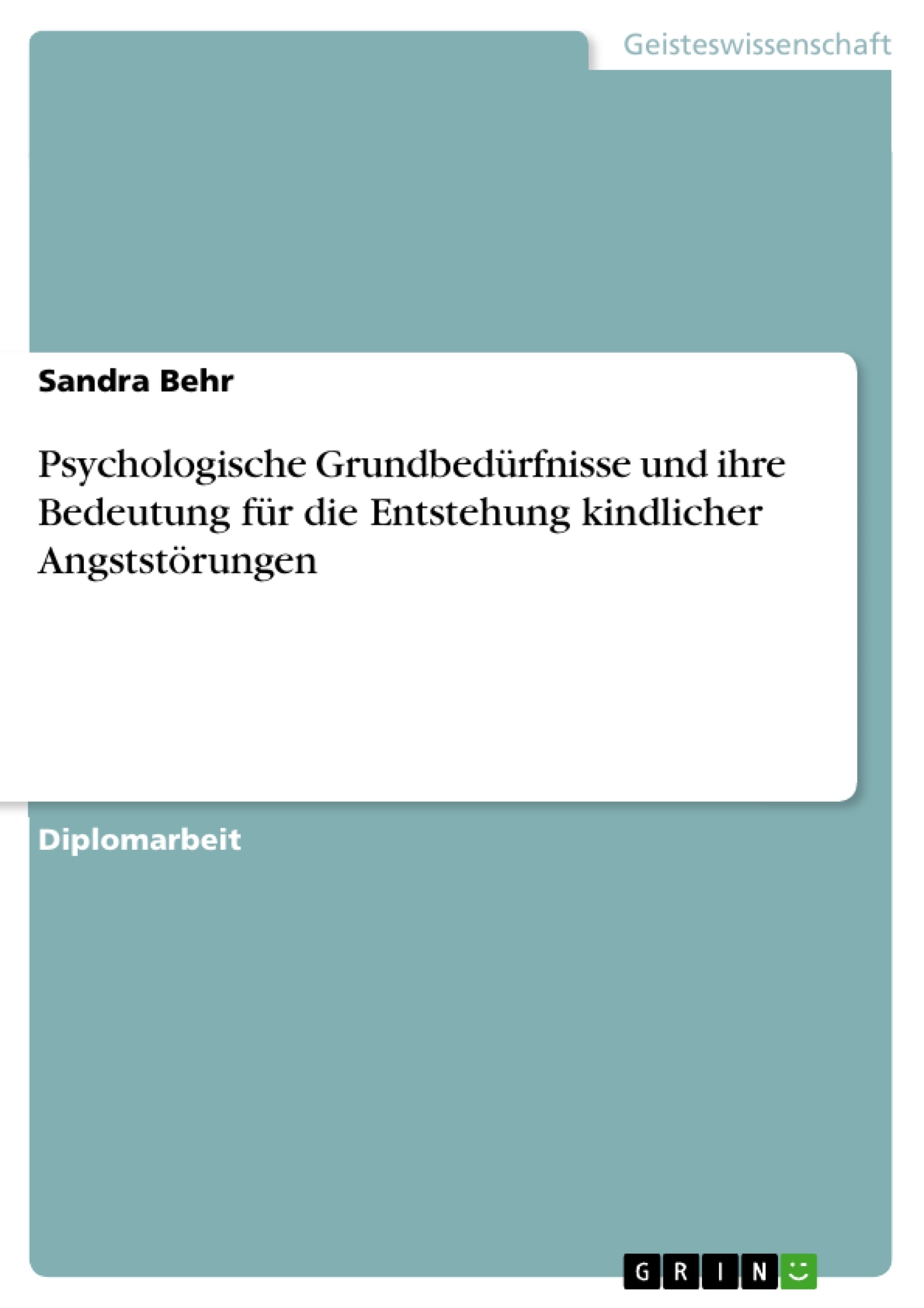Ergebnissen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes des Jahres 2004 zufolge erkrankt etwa jeder dritte Erwachsene der Bundesrepublik Deutschland im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung. Auch bei Kindern und Jugendlichen zählen die Angststörungen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Bei ihnen werden die spezifischen Phobien am häufigsten diagnostiziert.
Weiterhin ist mittlerweile, insbesondere durch die wissenschaftlichen Arbeiten von Grawe, anzunehmen, dass die wichtigste Ursache für die Entwicklung psychischer Störungen in einer schweren und dauerhaften Verletzung der psychologischen Grundbedürfnisse zu sehen ist.
Diese beiden wissenschaftlichen Erkenntnisse liefen bislang nebeneinander her und sollen nun im Rahmen dieser Abschlussarbeit vereint werden, um einen konkreten Zusammenhang zwischen der Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse und der Entstehung von Angststörungen aufzudecken.
Zunächst soll der Begriff der Angststörungen näher beleuchtet werden. Dazu zählen neben allgemeinen Begriffsdefinitionen und der Darlegung der Dimensionen der Angst auch Entstehungsmodelle von Angststörungen. Lerntheoretische sowie kognitive Theorien werden an dieser Stelle erläutert. Weiterhin erfolgt eine Vorstellung der Internationalen Klassifikation von Angststörungen nach dem ICD-10. Abschließend für diesen ersten Teil sollen die Spezifische Phobie und die Soziale Phobie vorgestellt werden.
Der darauf folgende Teil der Arbeit wird sich mit den psychologischen Grundbedürfnissen nach Grawe beschäftigen. Neben einer kurzen Begriffsbestimmung sowie der Erläuterung des Grundprinzips der Konsistenzregulation soll eine detailliertere Ausführung der vier Grundbedürfnisse nach Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung sowie Lustgewinn und Unlustvermeidung erfolgen.
Das daran anschließende Kapitel hat den Anspruch, die zuvor exemplarisch ausgewählten und vorgestellten Formen der Angststörungen daraufhin zu überprüfen, ob ihre Entwicklung in einer mangelnden oder möglicherweise auch unverhältnismäßig hohen Befriedigung der einzelnen psychologischen Grundbedürfnisse begründet liegen kann.
Das fünfte Kapitel soll die Bedeutung der bis dahin gewonnenen Einsichten über die Zusammenhänge zwischen der Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse und der Entstehung von Angststörungen für die Soziale Arbeit aufbereiten und eine Anregung für die praktische Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Angststörungen
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.2 Prävalenz
- 2.3 Komorbidität
- 2.4 Dimensionen der Angst
- 2.5 Ätiologie
- 2.5.1 Lerntheoretische Modelle
- 2.5.1.1 Klassische Konditionierung
- 2.5.1.2 Operante Konditionierung
- 2.5.1.3 Lernen am Modell
- 2.5.2 Kognitive Theorien
- 2.5.2.1 Die Angsttheorie nach Lazarus
- 2.5.2.2 Die Angstkontrolltheorie nach Epstein
- 2.5.2.3 Kognitives Modell der Angst nach Beck und Emery
- 2.6 Klassifikation von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen nach ICD-10
- 2.7 Ausgewählte Störungsbilder
- 2.7.1 Spezifische (isolierte) Phobie
- 2.7.2 Soziale Phobie
- 3 Psychologische Grundbedürfnisse
- 3.1 Das Grundprinzip der Konsistenzregulation
- 3.2 Klassifikation der psychologischen Grundbedürfnisse
- 3.2.1 Das Bindungsbedürfnis
- 3.2.2 Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
- 3.2.3 Das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung
- 3.2.4 Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung
- 3.3 Zusammenfassende Betrachtung
- 3.4 Der GBKJ
- 4 Angststörungen und psychologische Grundbedürfnisse
- 4.1 Angststörungen und Inkonsistenz
- 4.2 Angststörungen und Bindung
- 4.3 Angststörungen und Orientierung und Kontrolle
- 4.4 Angststörungen und Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung
- 4.5 Angststörungen und Lustgewinn und Unlustvermeidung
- 5 Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen psychologischen Grundbedürfnissen und der Entstehung kindlicher Angststörungen. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Bedürfnisse für das Verständnis und die Behandlung von Angststörungen bei Kindern zu beleuchten.
- Definition und Klassifizierung von Angststörungen bei Kindern
- Lerntheoretische und kognitive Modelle zur Entstehung von Angststörungen
- Psychologische Grundbedürfnisse und deren Relevanz für die psychische Gesundheit
- Der Zusammenhang zwischen unbefriedigten Grundbedürfnissen und der Entwicklung von Angststörungen
- Implikationen für die soziale Arbeit im Umgang mit angstgestörten Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert die Bedeutung des Forschungsfeldes. Sie beschreibt den Forschungsansatz und die Zielsetzung der Arbeit.
2 Angststörungen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung verschiedener Aspekte von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Es beinhaltet Definitionen, Prävalenzraten, Komorbiditäten, Dimensionen von Angst sowie verschiedene ätiologische Modelle, die lerntheoretische und kognitive Ansätze umfassen. Die Klassifizierung von Angststörungen nach ICD-10 wird ebenso behandelt wie ausgewählte Störungsbilder wie spezifische Phobien und soziale Phobien. Die Kapitelteile greifen verschiedene Theorien auf und beleuchten die Komplexität der Angstentstehung.
3 Psychologische Grundbedürfnisse: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit dem Konzept der psychologischen Grundbedürfnisse. Er erläutert das Prinzip der Konsistenzregulation und klassifiziert die Grundbedürfnisse nach verschiedenen Kategorien wie Bindungsbedürfnis, Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz und -erhöhung sowie Lustgewinn und Unlustvermeidung. Jedes Bedürfnis wird detailliert beschrieben und seine Bedeutung für die psychische Entwicklung und Stabilität herausgestellt.
4 Angststörungen und psychologische Grundbedürfnisse: In diesem zentralen Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Angststörungen und unbefriedigten Grundbedürfnissen untersucht. Es analysiert, wie ein Mangel an Bindung, Orientierung, Kontrolle, Selbstwertgefühl oder lustvollen Erfahrungen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beitragen kann. Dieser Teil der Arbeit stellt eine fundierte Verbindung zwischen den vorherigen Kapiteln her und liefert wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der Entstehung von Angst.
5 Bedeutung für die Soziale Arbeit: Das Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen für die soziale Arbeit. Es werden konkrete Handlungsansätze und Interventionsmöglichkeiten für den Umgang mit angstgestörten Kindern im Kontext sozialer Arbeit aufgezeigt. Es wird betont, wie wichtig die Berücksichtigung der psychologischen Grundbedürfnisse in der Intervention ist.
Schlüsselwörter
Angststörungen, Kinder, Jugendliche, Psychologische Grundbedürfnisse, Bindung, Orientierung, Kontrolle, Selbstwert, Lerntheorien, Kognitive Theorien, ICD-10, Soziale Arbeit, Intervention, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen im Kontext psychologischer Grundbedürfnisse
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen psychologischen Grundbedürfnissen und der Entstehung kindlicher Angststörungen. Sie beleuchtet die Bedeutung dieser Bedürfnisse für das Verständnis und die Behandlung von Angststörungen bei Kindern.
Welche Inhalte werden in der Diplomarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Darstellung von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen, einschließlich Definitionen, Prävalenz, Komorbidität, Ätiologie (Lerntheorien und kognitive Modelle), Klassifizierung nach ICD-10 und ausgewählte Störungsbilder (spezifische und soziale Phobien). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung und Klassifizierung psychologischer Grundbedürfnisse (Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwert, Lustgewinn/Unlustvermeidung) und deren Zusammenhang mit der Entstehung von Angststörungen. Die Arbeit schließt mit Implikationen für die Soziale Arbeit im Umgang mit angstgestörten Kindern.
Welche Theorien werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht verschiedene lerntheoretische Modelle (klassische und operante Konditionierung, Lernen am Modell) und kognitive Theorien (Angsttheorie nach Lazarus, Angstkontrolltheorie nach Epstein, kognitives Modell der Angst nach Beck und Emery) zur Entstehung von Angststörungen mit ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Angststörungen (mit detaillierter Beschreibung und Klassifizierung), Psychologische Grundbedürfnisse (mit Beschreibung und Klassifizierung), der Zusammenhang zwischen Angststörungen und Grundbedürfnissen, Bedeutung für die Soziale Arbeit und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Angststörungen, Kinder, Jugendliche, Psychologische Grundbedürfnisse, Bindung, Orientierung, Kontrolle, Selbstwert, Lerntheorien, Kognitive Theorien, ICD-10, Soziale Arbeit, Intervention, Prävention.
Welches ist das zentrale Forschungsziel?
Das zentrale Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen unbefriedigten psychologischen Grundbedürfnissen und der Entwicklung von Angststörungen bei Kindern aufzuzeigen und daraus Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit abzuleiten.
Welche praktischen Implikationen ergeben sich aus der Arbeit?
Die Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse für die Praxis der Sozialen Arbeit im Umgang mit angstgestörten Kindern. Sie zeigt auf, wie die Berücksichtigung der psychologischen Grundbedürfnisse in der Intervention und Prävention von Angststörungen hilfreich sein kann.
Wie wird die Klassifizierung von Angststörungen vorgenommen?
Die Klassifizierung von Angststörungen erfolgt gemäß der ICD-10.
Welche Arten von Angststörungen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt im Detail spezifische (isolierte) Phobien und soziale Phobien.
- Quote paper
- Dipl.Soz.Arb./Soz.Päd Sandra Behr (Author), 2009, Psychologische Grundbedürfnisse und ihre Bedeutung für die Entstehung kindlicher Angststörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144295