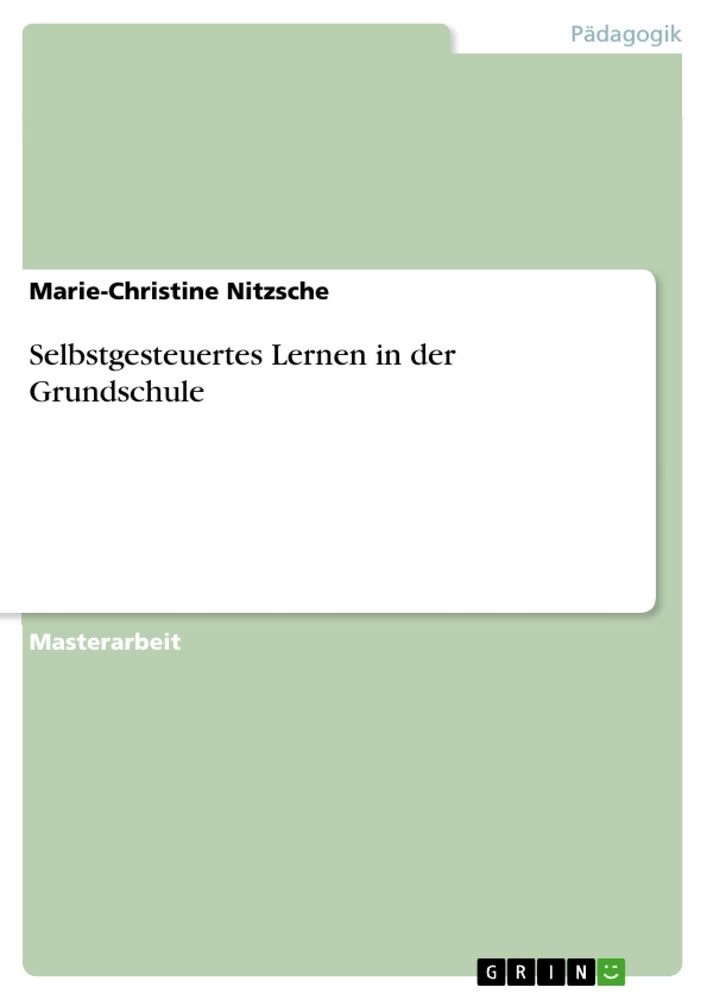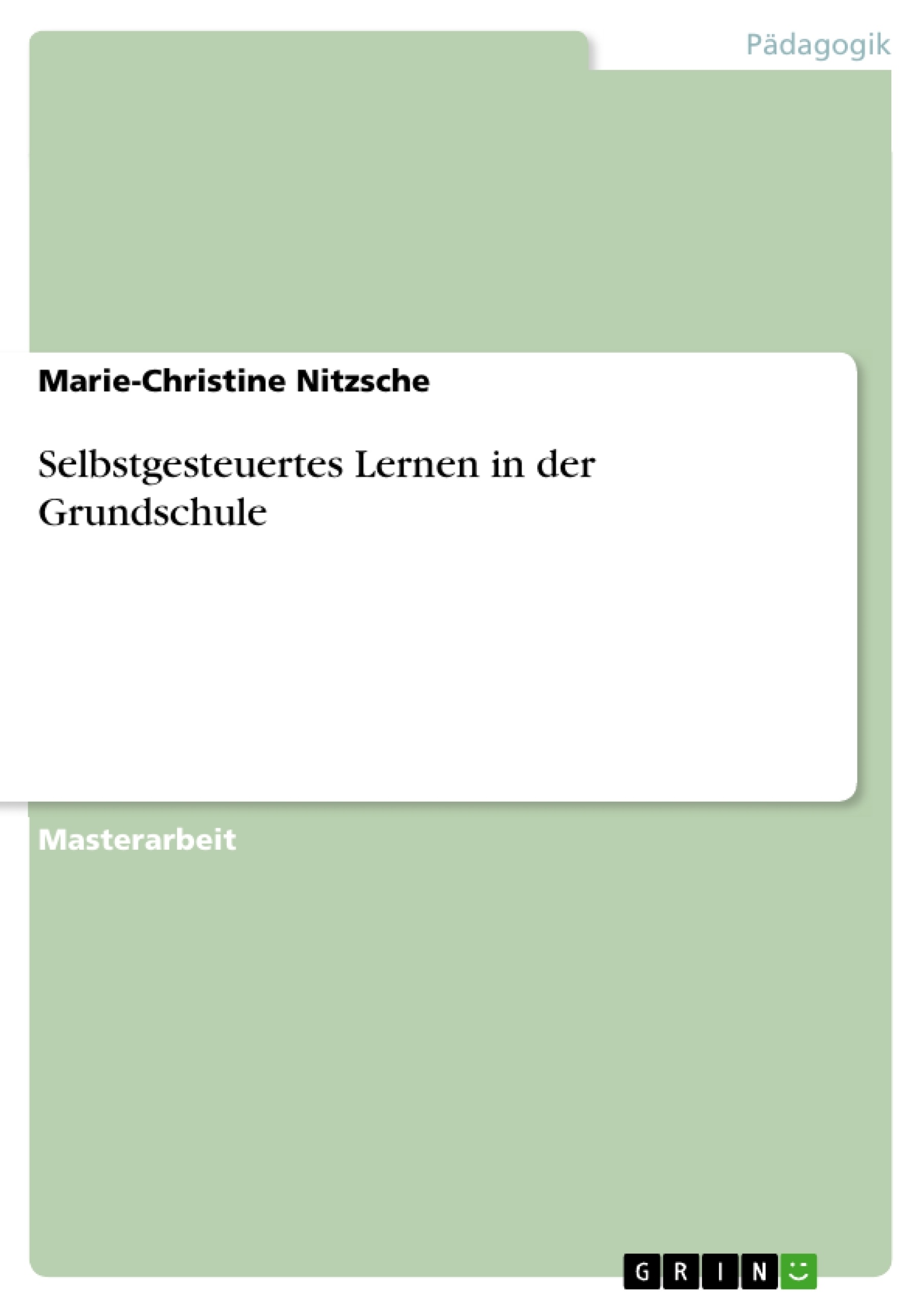Ein großes Ziel der heutigen Grundschularbeit muss es sein, Kinder zu befähigen, selbstständig und eigenverantwortlich zu Handeln und im Besonderen zu Lernen.
Von ihnen wird in Zukunft gefordert sich eigenständig weiterzubilden und fortlaufend zu entwickeln. Für diesen Reife- und Bildungsprozess bedarf es Handwerkszeug, welches die Lernenden bereits in den ersten Schuljahren ihres Lebens ergründen und benutzen lernen sollen. Ein Pool aus Methoden und Lernstrategien, aus dem Konzept des Selbstgesteuerten Lernens, soll die Lernenden dann dabei unterstützen, lebenslang eigeninitiativ lernen zu können.
Diesem Anspruch bedarf ein Paradigmenwechsel, welcher auch umfassend in dieser Arbeit beleuchtet wird. Die Rolle der Lehrenden hat sich, im Zuge der autonomiefördernden Entwicklung der Lernenden, ebenfalls grundlegend gewandelt. Kinder sollen nicht mehr belehrt werden, sondern durch eine anregende Lernumgebung und angepasste didaktische und pädagogische Prinzipien der Lernperson, lernen selbst zu lernen. Selbstständiges Lernen muss somit das zentrale Ziel heutiger Schularbeit werden.
Beginnen wird diese Ausarbeitung mit der Erläuterung von entsprechender Fachtermini und zentralen Theorien zum Selbstgesteuerten Lernen“. Diese Arbeit wird sich abschließend in dem Forschungsvorhaben explizit mit der „neuen Rolle“ der Lehrenden beschäftigen wie auch mit der Kooperation von Lernenden in selbstgesteuerten Lernprozessen. Dort soll ergründet werden, in wieweit sich die Lehrenden in ihren neuen Aufgabenbereich einfinden und wie die selbstgesteuerten Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler durch das Arbeiten in kooperativen Lernarrangements beeinflusst werden. Nach einer Gesamtanalyse dieser beiden Aspekte wird diese Arbeit mit einem Fazit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Konzeptionelle Klärung des Begriffs „Selbstgesteuertes Lernen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Selbstgesteuerten Lernens in der Grundschule und beleuchtet den damit verbundenen Paradigmenwechsel in der Rolle der Lehrkraft sowie die Bedeutung der Kooperation von Lernenden in selbstgesteuerten Lernprozessen. Ziel ist es, die Eingewöhnung der Lehrkräfte in ihre neuen Aufgabenbereiche und den Einfluss kooperativer Lernarrangements auf selbstgesteuerte Lernprozesse zu ergründen.
- Konzeptionelle Klärung des Begriffs „Selbstgesteuertes Lernen“
- Die neue Rolle der Lehrkraft im Kontext des Selbstgesteuerten Lernens
- Kooperative Lernprozesse im Selbstgesteuerten Lernen
- Selbststeuerung als Voraussetzung, Methode und Ziel des Lernens
- Phasen selbstgesteuerter Handlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das zentrale Ziel der heutigen Grundschularbeit: Kinder zu befähigen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln und zu lernen. Es wird ein Paradigmenwechsel gefordert, der die Rolle der Lehrkraft von der Belehrung hin zur Schaffung einer anregenden Lernumgebung verändert. Selbstständiges Lernen wird als zentrales Ziel heutiger Schularbeit definiert. Die Arbeit erläutert Fachtermini und zentrale Theorien zum Selbstgesteuerten Lernen und befasst sich mit der neuen Rolle der Lehrkräfte und der Kooperation von Lernenden in selbstgesteuerten Lernprozessen.
1. Konzeptionelle Klärung des Begriffs „Selbstgesteuertes Lernen“: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der vielschichtigen Definition von „Selbstgesteuertem Lernen“. Es analysiert die Begriffe „Selbst“ und „Lernen“ einzeln, um anschließend eine umfassende Definition zu entwickeln. Dabei werden verschiedene Perspektiven und Lerntheorien, wie Kognitivismus und Konstruktivismus, berücksichtigt. Die Bedeutung intrinsischer Motivation und die Rolle von Lernstrategien werden ausführlich diskutiert. Die aktive, konstruktive, kumulative und zielorientierte Natur des Lernens wird hervorgehoben, wobei die individuellen Lernwege der Schülerinnen und Schüler im Fokus stehen. Das Kapitel differenziert zwischen Selbstgesteuertem und Selbstreguliertem Lernen, unterstreicht die Bedeutung von Selbststeuerung als Voraussetzung, Methode und Ziel des Lernens, und gliedert selbstgesteuerte Handlungen in drei Phasen.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, Grundschule, Lehrkraftrolle, Kooperation, Lernprozesse, kognitive Wende, Lernstrategien, Selbststeuerung, Autonomie, intrinsische Motivation, Kognitivismus, Konstruktivismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstgesteuertes Lernen in der Grundschule
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Selbstgesteuertes Lernen in der Grundschule, den damit verbundenen Paradigmenwechsel in der Lehrerrolle und die Bedeutung der Kooperation von Lernenden in diesen Prozessen. Das Hauptziel ist es, die Eingewöhnung der Lehrkräfte in ihre neuen Aufgaben und den Einfluss kooperativer Lernarrangements auf selbstgesteuerte Lernprozesse zu ergründen.
Welche Aspekte des Selbstgesteuerten Lernens werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet konzeptionell den Begriff „Selbstgesteuertes Lernen“, analysiert die neue Rolle der Lehrkraft, untersucht kooperative Lernprozesse im Kontext selbstgesteuerten Lernens und betrachtet Selbststeuerung als Voraussetzung, Methode und Ziel des Lernens. Die einzelnen Phasen selbstgesteuerter Handlungen werden ebenfalls beschrieben.
Wie wird der Begriff „Selbstgesteuertes Lernen“ definiert?
Das Kapitel zur konzeptionellen Klärung analysiert die Begriffe „Selbst“ und „Lernen“ einzeln und entwickelt daraus eine umfassende Definition. Es berücksichtigt verschiedene Perspektiven und Lerntheorien (Kognitivismus und Konstruktivismus), die Bedeutung intrinsischer Motivation und die Rolle von Lernstrategien. Die aktive, konstruktive, kumulative und zielorientierte Natur des Lernens sowie die individuellen Lernwege der Schüler stehen im Fokus. Die Arbeit differenziert zudem zwischen Selbstgesteuertem und Selbstreguliertem Lernen.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft im Selbstgesteuerten Lernen?
Die Arbeit beschreibt einen Paradigmenwechsel in der Lehrerrolle. Die Lehrkraft wechselt von der reinen Belehrung hin zur Schaffung einer anregenden Lernumgebung, die selbstständiges Lernen der Schüler ermöglicht und unterstützt.
Welche Bedeutung hat die Kooperation im Selbstgesteuerten Lernen?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung kooperativer Lernarrangements für den Erfolg selbstgesteuerter Lernprozesse und deren Einfluss auf die Lernentwicklung der Schüler.
Welche Phasen selbstgesteuerter Handlungen werden unterschieden?
Die Arbeit gliedert selbstgesteuerte Handlungen in drei Phasen (die genauen Phasen werden im Text detailliert beschrieben, sind hier aber nicht explizit genannt).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstgesteuertes Lernen, Grundschule, Lehrkraftrolle, Kooperation, Lernprozesse, kognitive Wende, Lernstrategien, Selbststeuerung, Autonomie, intrinsische Motivation, Kognitivismus, Konstruktivismus.
Welche Lerntheorien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf den Kognitivismus und den Konstruktivismus.
Was ist das Ziel der heutigen Grundschularbeit laut der Einleitung?
Das Ziel ist es, Kinder zu befähigen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln und zu lernen.
- Quote paper
- Bachelor of Science Marie-Christine Nitzsche (Author), 2009, Selbstgesteuertes Lernen in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144300