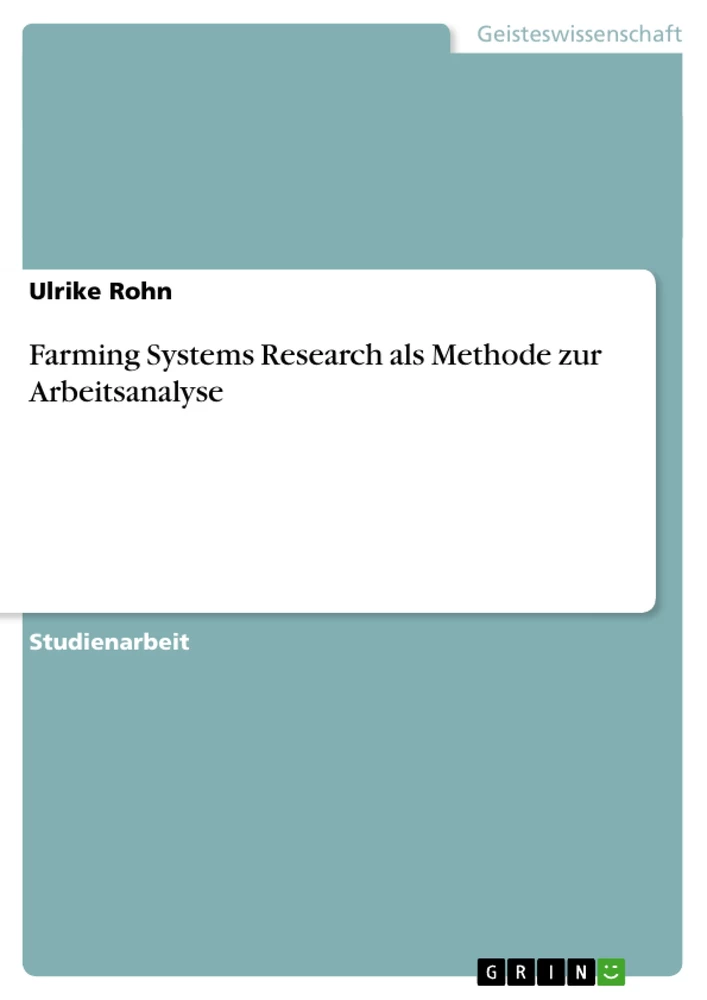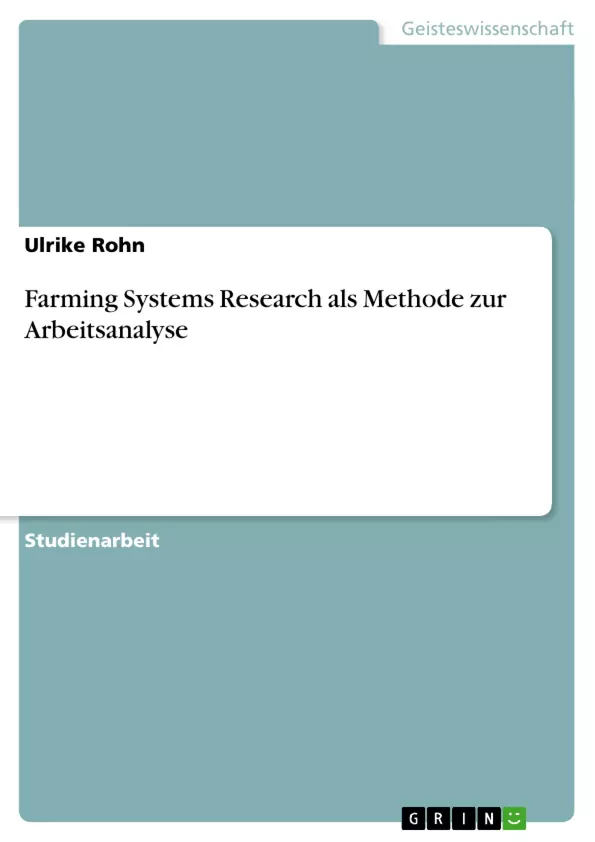Die zunehmende Urbanisierung sowie das Bevölkerungswachstum in weiten Teilen Afrikas haben
zur Folge, dass der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt, ohne jedoch dass die Agrarproduktion im
gleichen Maße zunimmt. In Industrieländern kann das Missverhältnis zwischen ländlichem Angebot
und städtischer Nachfrage durch eine erhebliche Mehrproduktion aufgrund von fortschrittlicher
Agrartechnologie ausgeglichen werden. Zudem ermöglicht eine Spezialisierung in der
Agrarproduktion einen für manche Agrarprodukte erreichten Ertrag über den Eigenbedarf hinaus, so
dass die Produkte im Austausch gegen andere Waren und Industriegütern exportiert werden können.
In den meisten Ländern Afrikas machen jedoch die fehlende agrarwirtschaftliche Technologie und
die damit zusammenhängende fehlende Spezialisierung und Marktintegration eine Mehrproduktion
zur großflächigen Versorgung mit Agrarprodukten sehr schwierig.
Vor diesem Hintergrund trafen sich im März 1984 Ethnologen, Ökonomen,
Politikwissenschaftler, Agrarwissenschaftler und Entwicklungshilfepraktiker auf einer von der Ford
und Rockefeller-Stiftung organisierten Konferenz in Italien. Ziel ihres Zusammenkommens war das
Zusammentragen der Erkenntnisse über die Ursachen der zu geringen Agrarproduktivität in den
Teilen Afrikas südlich der Sahara sowie über die Potenzialbereiche einer Verbesserung der
Situation. Im Zentrum der Konferenz stand hierbei das so genannte Farming Systems Research, im
Folgenden FSR genannt. FSR bezeichnet einen Prozess, in welchem durch Forschung in
kleinbäuerlichen Haushalten und durch direkten Kontakt mit den Haushaltsmitgliedern Bereiche der
einzelnen Arbeitsprozesse identifiziert werden, welche die Argrarproduktivität limitieren. Auf der
Basis dieser Ergebnisse werden im Rahmen eines FSR-Projektes unter Berücksichtigung sämtlicher
sozioökonomischer Faktoren der Haushalte neue Strategien bzw. Technologien entwickelt und
eingeführt, von denen man annimmt, dass diese zu einer Zunahme der Produktivität führen. Zu
diesen Strategien bzw. Technologien zählen z.B. der Einsatz von Maschinen, der Anbau neuer
Agrarsorten oder die Verschiebung der Erntezeit. Die einzelnen Beiträge im Rahmen dieser
Konferenz sind in dem Buch von Joyce LEWINGER (Hrsg.): Understanding Africa’s Rural
Households and Framing Systems (1986) veröffentlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Merkmale der Afrikanischen Agrarwirtschaft
- Farming Systems Research in der Theorie
- Farming Systems Research als mehrstufiger Prozess
- Methodischer und disziplinärer Beitrag von Farming Systems Research
- Training und Maßnahmenpolitik
- Farming Systems Research in der Praxis
- Studie zu den Auswirkungen von Haushaltskritierien auf die Produktivität in Burkina Faso
- Studien zur Rolle und Status der Frau in Senegal, Burkina Faso und der Elfenbeinküste
- Studie zum verbesserten Einsatz von Ziegen und Schafen in Nigeria
- Studie zu Konflikten innerhalb der Haushalte in Kamerun
- Studie zum Haushaltsmanagement in Botswana
- Kritik und Anregungen
- Über das Buch
- Hat das Buch sein Ziel erreicht?
- Wurde FSR ausreichend, deutlich und widerspruchsfrei dargestellt?
- Kam es zu einer kritischen Auseinandersetzung mit FSR und zu Lösungsvorschlägen?
- Über Farming Systems Research
- Erscheint Farming Systems Research als durchführbar und sinnvoll?
- Erscheint Farming Systems Research als eine geeignete Methode zur Arbeitsanalyse?
- Ist Farming Systems Research eine Methode zur optimalen Arbeitsanalyse im Sinne Spittlers?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Konzept des Farming Systems Research (FSR) und setzt sich kritisch mit dessen Anwendbarkeit in der afrikanischen Agrarwirtschaft auseinander. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der theoretischen Grundlagen, der praktischen Anwendung und der Kritik an FSR als Methode zur Arbeitsanalyse. Die Arbeit stellt zudem die Relevanz von FSR im Kontext des Bevölkerungswachstums, der steigenden Nahrungsmittelnachfrage und der Herausforderungen der afrikanischen Agrarwirtschaft in den Vordergrund.
- Theoretische Grundlagen und methodischer Ansatz von FSR
- Praktische Anwendung von FSR in afrikanischen Kontexten
- Kritik an FSR als Methode zur Arbeitsanalyse
- Relevanz von FSR im Kontext des Bevölkerungswachstums und der afrikanischen Agrarwirtschaft
- Optimale Arbeitsanalyse und die Rolle von FSR in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der afrikanischen Agrarwirtschaft und die Relevanz von FSR im Kontext des Bevölkerungswachstums und der steigenden Nahrungsmittelnachfrage ein. Anschließend werden die Merkmale der afrikanischen Agrarwirtschaft vorgestellt und die theoretischen Grundlagen von FSR erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem mehrstufigen Prozess von FSR und beleuchtet den methodischen und disziplinären Beitrag von FSR zu traditionellen Haushaltsstudien. Es werden zudem die Aspekte Training und Maßnahmenpolitik im Rahmen von FSR-Projekten behandelt.
In Kapitel 4 werden verschiedene FSR-Projekte aus der Praxis vorgestellt, die Einblicke in die Anwendung des Konzepts in verschiedenen afrikanischen Ländern gewähren. Die Kapitel untersuchen die Auswirkungen von FSR auf die Produktivität, die Rolle und den Status der Frau, den Einsatz von Ressourcen wie Ziegen und Schafen sowie Konfliktbereiche innerhalb von Haushalten.
Schlüsselwörter
Farming Systems Research (FSR), afrikanische Agrarwirtschaft, Arbeitsanalyse, Haushaltsstudien, Produktivität, Ressourcenmanagement, Konfliktlösung, Entwicklungszusammenarbeit, Ethnologie der Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Farming Systems Research (FSR)?
FSR ist ein Forschungsansatz, der kleinbäuerliche Haushalte als ganzheitliche Systeme betrachtet, um Hemmnisse der Agrarproduktivität direkt vor Ort zu identifizieren.
Warum ist FSR für Afrika südlich der Sahara relevant?
Angesichts rasanter Urbanisierung und Bevölkerungswachstums hilft FSR dabei, Strategien zu entwickeln, die die geringe Agrarproduktivität ohne teure Hochtechnologie steigern können.
Welche Rolle spielen Frauen in diesen landwirtschaftlichen Systemen?
Die Arbeit thematisiert Studien aus Senegal und Burkina Faso, die zeigen, dass Frauen oft eine zentrale, aber sozioökonomisch benachteiligte Rolle in den Arbeitsprozessen einnehmen.
Welche konkreten Technologien werden durch FSR eingeführt?
Dazu gehören der Einsatz angepasster Maschinen, der Anbau neuer Agrarsorten, verbesserte Viehhaltung (z.B. Ziegen) oder die Optimierung von Erntezeiten.
Ist FSR eine geeignete Methode zur Arbeitsanalyse?
Die Arbeit setzt sich kritisch damit auseinander, ob FSR im Sinne der Ethnologie eine optimale Analyse der tatsächlichen Arbeitsprozesse in Haushalten ermöglicht.
- Quote paper
- Ulrike Rohn (Author), 2002, Farming Systems Research als Methode zur Arbeitsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14431