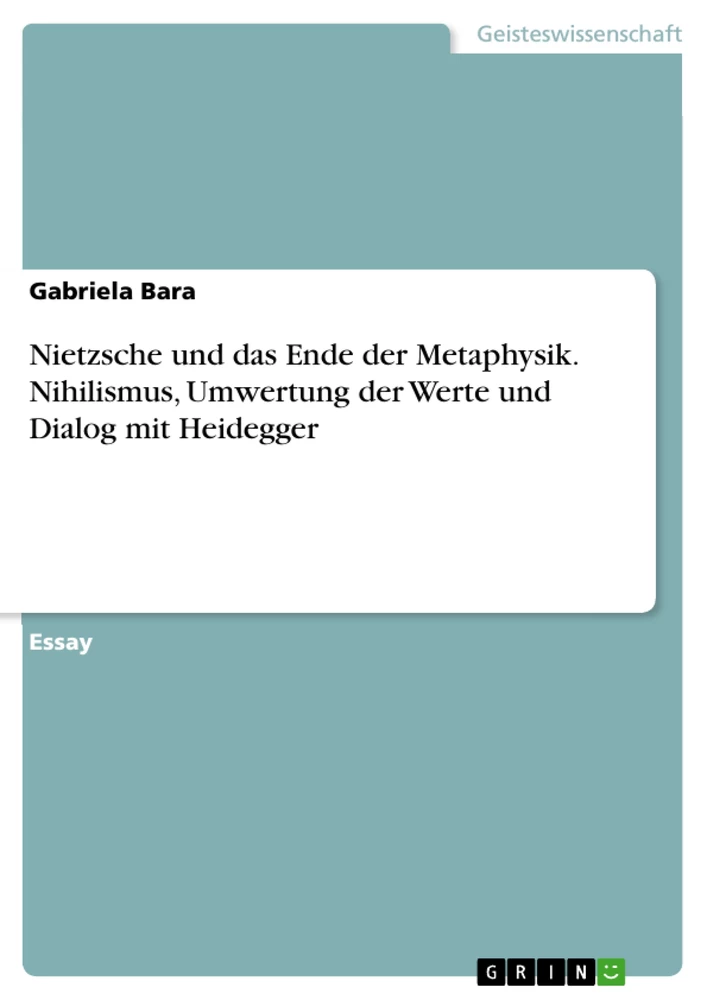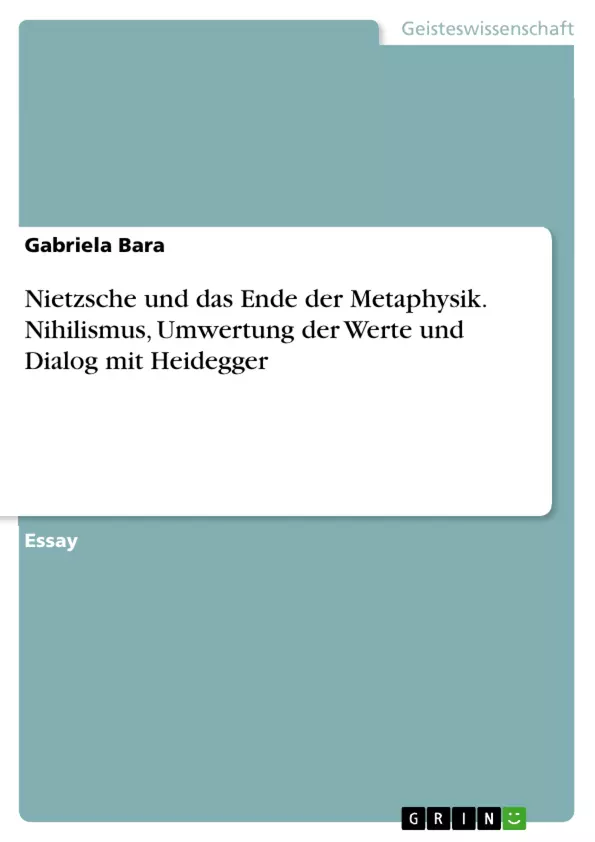Die metaphysische Tradition der abendländische Philosophie ist durch die Philosophie Platons vorgegeben: Einheit bezieht sich auf die ideale Welt, Vielheit dagegen umfasst die phänomenale Welt, wobei die ideale, wahre Welt positiv und die scheinbare Welt der Phänomene negativ konnotiert ist.
Aufgrund eines Ressentiments gegen die Wirklichkeit, wegen des Hasses gegen eine Welt des Leidens, haben die Metaphysiker eine „wahre“ Welt des Unbedingten geschaffen. Nietzsches Aufgabe wird es, die Welt der Metaphysik abzuschaffen, und dabei das Werden als einzige Realität wiederherzustellen.
Die Vielheit ist nicht mehr von der Einheit abhängig, und das Werden auch nicht von dem Sein. Die Einheit erhält einen neuen Sinn durch das Spiel der ewigen Wiederkehr. Das Hasard wird das Objekt der Bejahung. Es wird die Eins des Mehrfachen, und das Sein des Werdens wird bejaht. In der Nietzscheschen Intuition des Werdens wird das Sein als ewige Wiederkehr hergestellt.
Der Nietzschesche Gedanke, der das ganze Seiende zu dieser Welt und zu dieser Wirklichkeit reduziert, soll auch die Idee der Gottheit ersetzen. Die Doktrin der ewigen Wiederkehr ist für Nietzsche wichtig, weil nur durch sie der Tod Gottes endgültig wird und die Nichtigkeit übertroffen werden kann.
Die Aussage „Gott ist tot“ symbolisiert nicht nur die Wirkungslosigkeit des christlichen Gottes, sondern auch das Ende der Metaphysik, indem die traditionellen Werte der Philosohie das Dasein nicht mehr stützen können. Der Glaube an die Kategorien der Vernunft, die sich auf eine rein imaginäre Welt bezogen, ging durch Nietzsche zu Ende. Der Geist des Philosophen hypostasiert nicht mehr das Wissen, sondern das Leben.
Die Untreue zur Erde verursachte das Zerreißen des Menschen in die Antithese des Sinnlichen und Übersinnlichen, in die Opposition Körper-Seele. Der Übermensch soll diese Kluft heilen; er soll alles, was der Erde genommen und gestohlen wurde, wiedergeben. Der Übermensch ist der Schöpfer schlechthin, und sein schöpferischer Geist befindet sich im Spiel. In seiner Unschuld erschafft und zerstört sich das Spiel selbst immer wieder; das Spiel ist ewige Wiederkehr.
Durch seine Kritik an dem Optimismus des theoretischen Menschen, durch seine Kritik an Moral und Christentum und seinen Versuch, einen Ausweg aus dem Nihilismus zu finden, bildet Nietzsches Philosophie eine Mittelstelle zwischen Metaphysik und Technik.
Inhaltsverzeichnis
- I. Das Ende der Metaphysik: Das Werden als Wirklichkeit
- II. Der Nihilismus: das fundamentale Ereignis der Metaphysik
- III. Versuch einer Umwertung der Werte
- IV. Dialog Nietzsche-Heidegger
- V. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Nietzsches Kritik an der traditionellen Metaphysik und seine Konzeption des Werdens als einzige Wirklichkeit. Sie beleuchtet den Nihilismus als Folge des Todes Gottes und die Notwendigkeit einer Umwertung der Werte. Der Dialog zwischen Nietzsche und Heidegger wird angedeutet, ohne jedoch detailliert ausgeführt zu werden.
- Kritik an der traditionellen Metaphysik und dem Konzept des Seins
- Nietzsches Konzeption des Werdens und der ewigen Wiederkehr
- Der Nihilismus als Konsequenz des Todes Gottes und die Entwertung der Werte
- Die Notwendigkeit einer Umwertung der Werte und die dionysische Lebensbejahung
- Der Einfluss von Heraklit auf Nietzsches Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Das Ende der Metaphysik: Das Werden als Wirklichkeit: Dieses Kapitel analysiert Nietzsches Abkehr von der traditionellen Metaphysik, die eine Trennung zwischen Sein und Werden vornimmt. Nietzsche widerlegt diese Unterscheidung und proklamiert das Werden als einzige Wirklichkeit. Er greift dabei auf Heraklits Philosophie zurück, die den ewigen Fluss und Kampf der Gegensätze betont. Das Konzept des „Chaos“ als konstantes Werden wird eingeführt, wobei betont wird, dass dieses Chaos nicht als fehlende Notwendigkeit, sondern als fehlende Ordnung, Form und Struktur verstanden werden muss. Die ewige Wiederkehr als Konsequenz der finiten Gesamtheit der Kräfte wird erläutert und als Bejahung des Werdens interpretiert, im Gegensatz zum nihilistischen Aburteilen des Werdens. Die dionysische Lebensbejahung wird als positive Antwort auf die Vergänglichkeit und die Herausforderungen des Lebens vorgestellt.
II. Der Nihilismus: das fundamentale Ereignis der Metaphysik: Dieses Kapitel behandelt den Nihilismus als fundamentales Ereignis der abendländischen Metaphysik, gekennzeichnet durch den Tod Gottes und die Entwertung traditioneller Werte. Nietzsche kritisiert die Vorstellung einer transzendenten Welt der Werte als Illusion. Der Tod Gottes wird als die Erschütterung der Grundlagen der modernen Zivilisation dargestellt, die zu einer Reflexion über die Welt- und Selbstrealität führt. Nietzsche analysiert die moralischen Absichten hinter philosophischen Systemen und zeigt auf, wie die Angst vor Pessimismus zur Humanisierung des Universums und zur Erfindung absoluter Werte führte. Der Nihilismus wird in drei Aspekte unterteilt: die Irreführung durch einen vermeintlichen Zweck des Werdens, die Projektion von Einheit und Ganzheit auf die Welt des Werdens und der verlorene Glaube an eine metaphysische, wahre Welt. Die traditionellen Werte werden als Perspektiven bezüglich Nützlichkeit und Selbsterhaltung des Menschen entlarvt, nicht als Essenz der Dinge.
Schlüsselwörter
Metaphysik, Sein, Werden, Nietzsche, Nihilismus, Ewige Wiederkehr, Dionysos, Umwertung der Werte, Heraklit, Tod Gottes, Moral, Perspektivismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Nietzsches Kritik an der traditionellen Metaphysik und seine Konzeption des Werdens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Friedrich Nietzsches Kritik an der traditionellen Metaphysik und seine Konzeption des Werdens als einzige Wirklichkeit. Sie beleuchtet den Nihilismus als Folge des Todes Gottes und die Notwendigkeit einer Umwertung der Werte. Der Dialog zwischen Nietzsche und Heidegger wird angerissen, jedoch nicht detailliert ausgeführt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Nietzsches Kritik an der traditionellen Metaphysik und dem Konzept des Seins, seine Konzeption des Werdens und der ewigen Wiederkehr, der Nihilismus als Konsequenz des Todes Gottes und die damit verbundene Entwertung traditioneller Werte, die Notwendigkeit einer Umwertung der Werte und die dionysische Lebensbejahung sowie der Einfluss von Heraklit auf Nietzsches Philosophie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Das Ende der Metaphysik: Das Werden als Wirklichkeit; Der Nihilismus: das fundamentale Ereignis der Metaphysik; Versuch einer Umwertung der Werte; Dialog Nietzsche-Heidegger; Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was wird im Kapitel „Das Ende der Metaphysik: Das Werden als Wirklichkeit“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert Nietzsches Abkehr von der traditionellen Metaphysik mit ihrer Trennung von Sein und Werden. Nietzsche proklamiert das Werden als einzige Wirklichkeit, beruft sich auf Heraklit und führt das Konzept des „Chaos“ (als fehlende Ordnung, nicht Notwendigkeit) und die ewige Wiederkehr ein. Die dionysische Lebensbejahung wird als positive Antwort auf die Vergänglichkeit präsentiert.
Was wird im Kapitel „Der Nihilismus: das fundamentale Ereignis der Metaphysik“ behandelt?
Dieses Kapitel behandelt den Nihilismus als Folge des Todes Gottes und der Entwertung traditioneller Werte. Nietzsche kritisiert die Vorstellung einer transzendenten Welt der Werte als Illusion. Der Nihilismus wird in drei Aspekte unterteilt: Irreführung durch vermeintlichen Zweck des Werdens, Projektion von Einheit auf die Welt des Werdens und der verlorene Glaube an eine metaphysische, wahre Welt. Traditionelle Werte werden als Perspektiven bezüglich Nützlichkeit und Selbsterhaltung entlarvt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Metaphysik, Sein, Werden, Nietzsche, Nihilismus, Ewige Wiederkehr, Dionysos, Umwertung der Werte, Heraklit, Tod Gottes, Moral, Perspektivismus.
Wie wird der Dialog Nietzsche-Heidegger behandelt?
Der Dialog zwischen Nietzsche und Heidegger wird nur angedeutet und nicht detailliert ausgeführt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen (allgemeine Aussage)?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse von Nietzsches Philosophie bezüglich Metaphysik, Nihilismus und der Notwendigkeit einer Umwertung der Werte. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerungen ist nicht explizit in der Vorschau angegeben.
- Quote paper
- Gabriela Bara (Author), 2005, Nietzsche und das Ende der Metaphysik. Nihilismus, Umwertung der Werte und Dialog mit Heidegger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144319