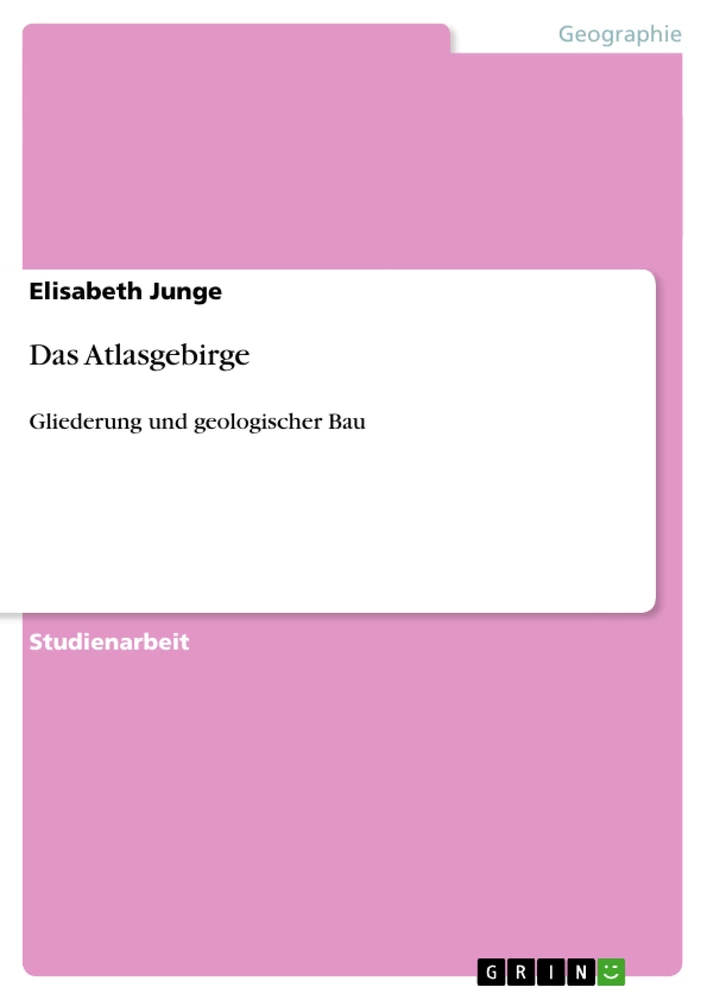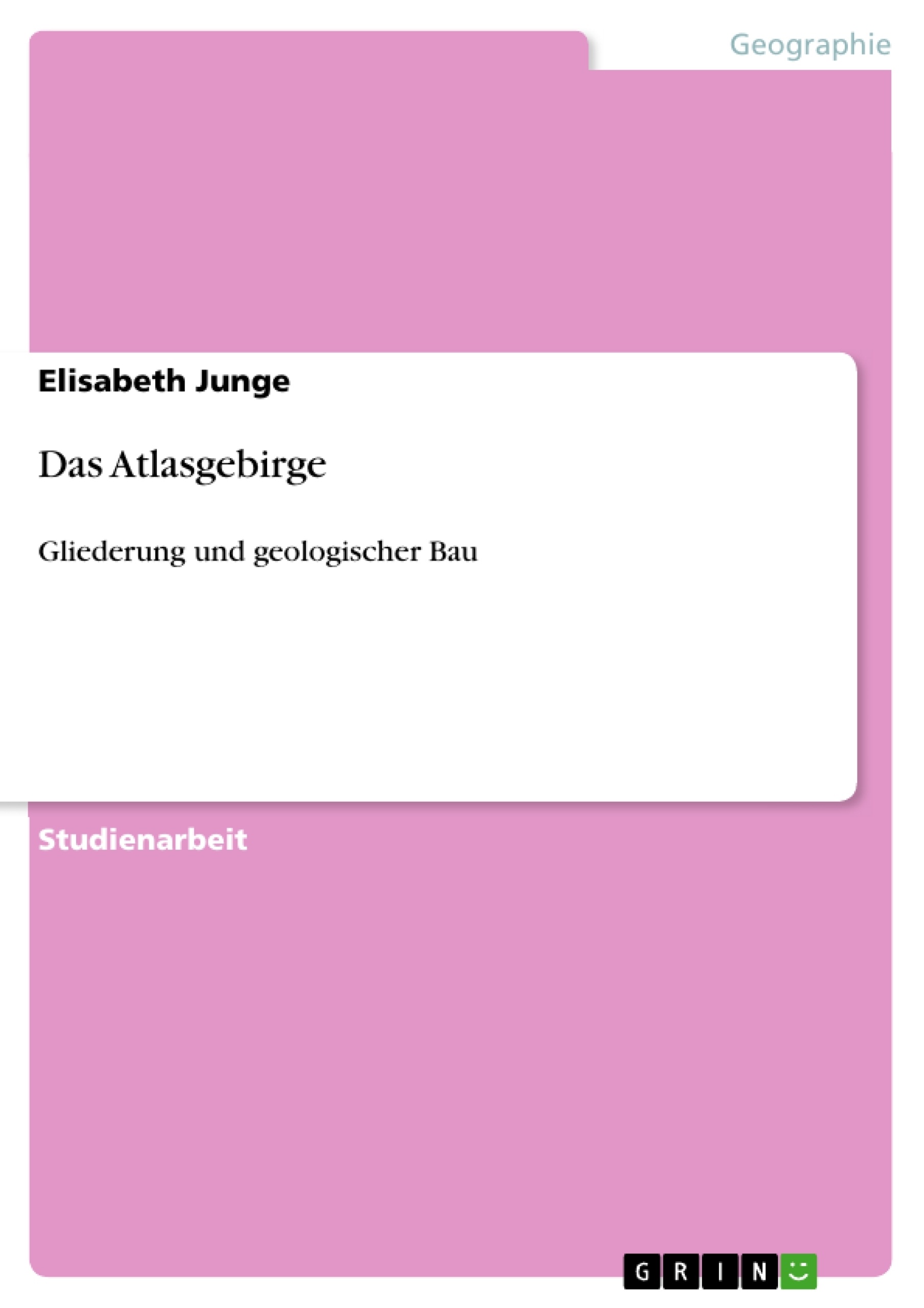Erinnert man sich an die Antike zurück, so ist es der Titan Atlas, der das
Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt. Die „alte Welt“ grenzte im fernsten Westen
an ein unendliches Meer, das schliesslich nach dem Titanen benannt wurde: der
Atlantische Ozean (STETS 1981, S. 804).
„Afrika gehört zwei großen tektonischen Erdregionen an. Das Atlasgebirge ist ein Glied
des Gürtels der in der Tertiärzeit1 gefalteten Hochgebirge, die Südeuropa und Asien
durchziehen. Das übrige Afrika, das wir als die afrikanische Platte2 bezeichnen können,
bildet zusammen mit dem außerandinen Südamerika, Arabien, Vorderindien und
Australien ein einst zusammenhängendes Gebiet gleichartigen Baus, das keine jüngere
Faltung mehr erlitten hat, und von E. Suess als Gondwanaland bezeichnet worden ist“
(JAEGER 1954, S. 53).
Das vorangehende Zitat von Fritz Jaeger zeigt, dass Afrika, im Gegensatz zu Gegenden
wie Südamerika oder Europa, ein Kontinent ist, der nicht mit verschiedenen
Hochgebirgen glänzen kann, deren Höhen sich im Bereich der Superlative bewegen.
Gebirge finden sich auf diesem Kontinent nur als vereinzelte Akzente in der
Eintönigkeit der Flächen und treten nicht als konstituierende Elemente des Großreliefs
auf, wie in Südamerika oder Eurasien (WIESE 1997, S. 28). Nachdem in Afrika
vorwiegend flaches Relief die Landschaft prägt und einstige Gebirge durch
Verwitterung und Abtragung eingeebnet worden sind, möchte ich mich im Zuge dieser
Arbeit mit dem somit aus der Landschaft herausragenden Atlasgebirge beschäftigen
(JAEGER 1954, S. 53).
Neben einer allgemeinen Lagebeschreibung des Gebirges geht die Arbeit genauer auf
die Entstehung ein. Nach eingehender Betrachtung der Gliederung des Gebirgssystems,
soll der geologische Bau des Atlasgebirges beleuchtet werden. Um den Rahmen der
Arbeit nicht zu sprengen und zusammenfassender vorzugehen, beschäftige ich mich an
diesem Punkt speziell mit zwei Beispielregionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Atlasgebirge
- Lage
- Entstehung
- Gliederung
- Rif-Atlas
- Mittlerer Atlas
- Hoher Atlas
- Westlicher Hoher Atlas
- „Massif Ancien“
- Zentraler Hoher Atlas
- Östlicher Hoher Atlas
- Tell-Atlas
- Sahara-Atlas
- Geologischer Bau
- Bau des Hohen Atlas
- Bau des Mittleren Atlas
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Atlasgebirge in Nordafrika. Ziel ist es, eine umfassende Übersicht über die Lage, Entstehung, Gliederung und den geologischen Bau des Gebirges zu geben. Der Fokus liegt dabei auf den wichtigsten Gebirgszügen.
- Lage und Ausdehnung des Atlasgebirges
- Tektonische Entstehung und geologische Prozesse
- Gliederung des Atlasgebirges in seine verschiedenen Teilgebiete
- Geologischer Aufbau des Hohen und Mittleren Atlas
- Vergleich des Atlasgebirges mit anderen Gebirgen weltweit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein, indem sie den Atlas – den Titanen der griechischen Mythologie – mit dem gleichnamigen Gebirge in Nordafrika verbindet und den Kontrast zwischen Afrikas im Großen und Ganzen flachem Relief und dem herausragenden Atlasgebirge hervorhebt. Es wird der Forschungsfokus auf die Lage, Entstehung, Gliederung und den geologischen Bau des Gebirges gelegt, wobei die Arbeit sich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf ausgewählte Regionen konzentriert.
Das Atlasgebirge: Dieses Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in das Atlasgebirge, beschreibt seine charakteristischen Merkmale wie den schnellen Wechsel von Ketten, Becken, Tälern und Schollen und betont seinen Status als subtropisches Winterregengebiet. Es werden die Höhenangaben des Gebirges erwähnt und seine Zusammensetzung aus Gebirgsketten, Hochländern und Tiefländern beleuchtet.
Lage: Das Kapitel beschreibt die geographische Lage des Atlasgebirges im Nordwesten Afrikas, seine Ausdehnung über Marokko, Algerien und Tunesien und seine Verbindung zu den Gebirgsketten des Mittelmeers und dem Atlantik. Es hebt die Bedeutung des Atlasgebirges als nördliche Begrenzung des afrikanischen Kontinents hervor und betont seinen Einfluss auf die umliegende Landschaft und Kultur.
Entstehung: Der Entstehungsteil erklärt die Bildung des Atlasgebirges als Ergebnis der Kollision zwischen den afrikanischen und eurasischen Platten, analog zur Alpenbildung. Es wird ein prä-orogenes Grabensystem beschrieben, das mit der Öffnung des Atlantiks in Verbindung gebracht wird. Die Bedeutung von älteren Verwerfungen für die Struktur des entstehenden Gebirges wird betont. Der Text führt auch die Hypothese eines Mantelplume unter dem Atlasgebirge an, um die ungewöhnliche Hebung des Gebirges zu erklären.
Gliederung: Das Kapitel befasst sich mit der Gliederung des Atlasgebirges in verschiedene Teilgebirge nach verschiedenen Autoren. Es wird die Uneinigkeit bezüglich der Einordnung des Anti-Atlas diskutiert und die Entscheidung getroffen, sich auf den Rif-, Tell-, Mittleren und Hohen Atlas sowie den Sahara-Atlas zu konzentrieren. Die einzelnen Gebirgszüge werden kurz vorgestellt.
Rif-Atlas: Dieses Kapitel beschreibt den Rif-Atlas, seinen Aufbau aus Flyschschiefern und -sandsteinen sowie Kalkmassiven, und seine Geographie. Es hebt seine Eigenständigkeit von den algerischen Gebirgszügen hervor und beschreibt seine komplexe geologische Struktur, charakterisiert durch Geosynklinaltröge, Schuppentektonik und Deckenbildung. Es wird auch die Zuordnung von Teilbereichen zu verschiedenen tektonischen Platten erwähnt.
Mittlerer Atlas: Hier wird der Mittlere Atlas, seine Ausrichtung, seine höchsten Erhebungen (Jbel Bou Naceur und Jbel Bou Iblane) und seine Unterteilung durch das Lineament des Accident Nord Moyen-Atlasique beschrieben. Das Kapitel betont die Bedeutung des Mittleren Atlas als Klimascheide und beschreibt seinen gemäßigten Faltenbau, die hohe Erhebung und die tiefen Täler. Die unterschiedlichen klimatischen und vegetativen Bedingungen auf den Nord- und Südseiten werden angesprochen.
Hoher Atlas: Der Hohe Atlas wird als intrakontinentales Gebirge mit seinen höchsten Gipfeln (Jbel Toubkal und Jbel M´Goun) eingeführt. Die Unterteilung in Westlichen, „Massif Ancien“, Zentralen und Östlichen Hohen Atlas wird erwähnt. Es wird kurz die geologische Beschaffenheit der einzelnen Bereiche angedeutet.
Tell-Atlas: Der Tell-Atlas, als Mittelgebirge mit einzelnen Hochgebirgsbereichen wie dem Djurdjura, wird vorgestellt. Seine Lage in Algerien, die intramontanen Becken und seine Bewaldung und landwirtschaftliche Nutzung werden hervorgehoben. Der Tell-Atlas wird im Kontext seiner Beziehung zum Sahara-Atlas und den Dorsale in Tunesien beschrieben.
Sahara-Atlas: Das Kapitel beschreibt den Sahara-Atlas als Abschlusssystem des Atlasgebirges zur Sahara, seine Zusammensetzung aus einzelnen Massiven und Schichtrippen und Schichtstufenlandschaften, und seine weniger geschlossene Struktur im Vergleich zu den marokkanischen Teilen des Atlasgebirges. Die Höhe des Aurèsgebirges wird als Beispiel für die höchsten Erhebungen genannt.
Geologischer Bau: Dieses Kapitel vergleicht den geologischen Bau des Atlas mit anderen Gebieten und hebt seine Besonderheiten hervor. Es erwähnt den präkambrisch-paläozoischen Sockel und das mesozoische Deckgebirge. Die Unterschiede im Baustil und Relief der verschiedenen Gebirgszüge werden angesprochen, wobei der Rif-Atlas als Orogen und der Mittlere und Hohe Atlas als Inversionsstrukturen beschrieben werden.
Bau des Hohen Atlas: Hier wird der präkambrische Sockel, die vorgelagerten paläozoischen Serien und der Schollenbau des Hohen Atlas detaillierter beschrieben. Die Rolle der Trias-Schichten, der Bruchtektonik und die unterschiedliche tektonische Beanspruchung der verschiedenen Gesteinsschichten werden erklärt.
Bau des Mittleren Atlas: Der Mittlere Atlas wird in Bezug auf das „Accident Nord Moyen-Atlasique“ und seine Unterteilung in zwei Bereiche (Plateau und gefalteter Mittlerer Atlas) beschrieben. Der unterschiedliche Faltenbau und die Zusammensetzung aus jurassischen Karbonatgesteinen, sowie die Anwesenheit von Vulkaniten werden erläutert.
Atlasgebirge: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Atlasgebirge in Nordafrika. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Lage, Entstehung, Gliederung und dem geologischen Bau des Gebirges.
Welche Bereiche des Atlasgebirges werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Bereiche des Atlasgebirges, einschließlich des Rif-Atlas, des Mittleren Atlas, des Hohen Atlas (mit Unterteilungen in Westlichen, „Massif Ancien“, Zentralen und Östlichen Hohen Atlas), des Tell-Atlas und des Sahara-Atlas. Es werden die geographische Lage, geologische Entstehung, geologische Strukturen und Besonderheiten der einzelnen Bereiche detailliert beschrieben.
Wie ist das Atlasgebirge geologisch aufgebaut?
Der geologische Aufbau wird detailliert beschrieben, wobei Unterschiede zwischen den einzelnen Gebirgszügen hervorgehoben werden. Es wird der präkambrisch-paläozoische Sockel und das mesozoische Deckgebirge erwähnt. Der Rif-Atlas wird als Orogen und der Mittlere und Hohe Atlas als Inversionsstrukturen beschrieben. Der Bau des Hohen Atlas und des Mittleren Atlas wird separat mit Fokus auf die jeweiligen Gesteinsformationen und tektonischen Prozesse erläutert.
Welche tektonischen Prozesse haben zur Entstehung des Atlasgebirges geführt?
Die Entstehung des Atlasgebirges wird als Ergebnis der Kollision zwischen den afrikanischen und eurasischen Platten erklärt, analog zur Alpenbildung. Ein prä-orogenes Grabensystem im Zusammenhang mit der Öffnung des Atlantiks wird beschrieben, sowie die Rolle älterer Verwerfungen und die Hypothese eines Mantelplume unter dem Gebirge.
Wie ist das Atlasgebirge gegliedert?
Die Gliederung des Atlasgebirges in seine verschiedenen Teilgebiete wird detailliert beschrieben. Es wird auf die unterschiedlichen Klassifizierungen verschiedener Autoren eingegangen und die gewählte Einteilung in Rif-Atlas, Tell-Atlas, Mittleren Atlas, Hohen Atlas und Sahara-Atlas begründet. Die einzelnen Gebirgszüge werden jeweils kurz vorgestellt und ihre charakteristischen Merkmale beschrieben.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Einleitung, dem Atlasgebirge allgemein, Lage, Entstehung, Gliederung (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Gebirgszügen: Rif-Atlas, Mittlerer Atlas, Hoher Atlas, Tell-Atlas, Sahara-Atlas), geologischem Bau (mit Unterkapiteln zu Hohen und Mittleren Atlas) und Schluss.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist es, eine umfassende Übersicht über die Lage, Entstehung, Gliederung und den geologischen Bau des Atlasgebirges zu geben. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Gebirgszügen und es wird ein Vergleich mit anderen Gebirgen angestrebt (obwohl dies im Detail nicht ausführlich ausgeführt wird).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter umfassen: Atlasgebirge, Rif-Atlas, Mittlerer Atlas, Hoher Atlas, Tell-Atlas, Sahara-Atlas, Geologie, Tektonik, Plattentektonik, Gebirgsbildung, Orogenese, Geographie, Nordafrika, Marokko, Algerien, Tunesien.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Junge (Autor:in), 2010, Das Atlasgebirge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144429