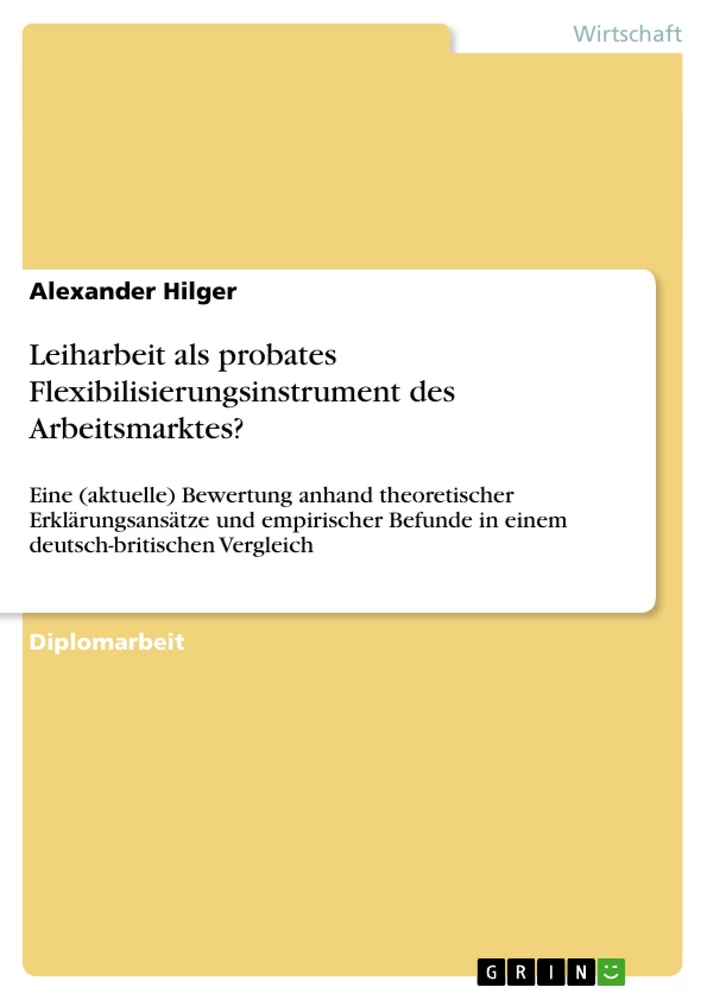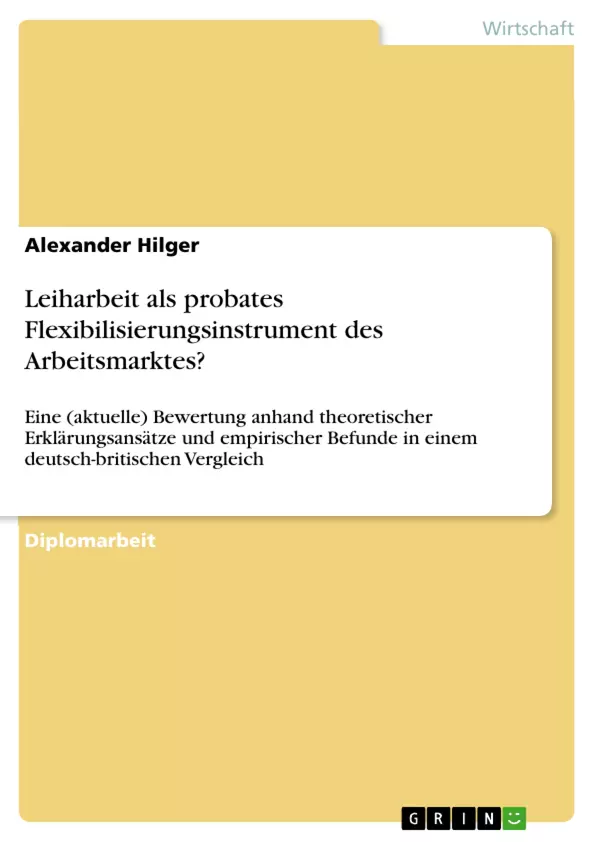Nach einführenden begrifflichen Klärungen (Abschnitt 2) folgen in zwei Hauptabschnitten zunächst theoretische Überlegungen zur Grundlegung und Charakterisierung der Leiharbeit (in Abschnitt 3) sowie empirische Analysen mit einem internationalen Vergleich der Leiharbeit in Großbritannien (GB) und in Deutschland (DE). Der Teilarbeitsmarkt der Leiharbeit in GB gilt als relativ entwickelt und stärker ausgedehnt, so dass sich ein solcher Vergleich dadurch besonders rechtfertigen lässt (Abschnitt 4). Die Arbeit schließt mit einem zusammenfassenden Abschnitt und dem Versuch eines Ausblicks zur zukünftigen Entwicklung der Leiharbeit in DE.
Im grundlegenden Theorieteil werden auf der Basis einer breit angelegten Literaturbearbeitung wesentliche Argumente zugunsten der Entwicklung der Leiharbeitsverhältnisse aus der Sicht der beteiligten Akteure, der Entleihunternehmen, der Leiharbeitnehmer und der Verleiher, herausgearbeitet. Die Darstellung enthält eine systematische Analyse der jeweils relevanten Interessen und Determinanten. Neben der ausführlichen Literaturrecherche enthält die Diplomarbeit mehrere kompakte Zusammenfassungen in Form von tabellarischen Darstellungen. Des Weiteren werden nachteilige Merkmale der Leiharbeit unter dem Stichwort prekärer Arbeitsbedingungen hervorgehoben.
In analoger Weise folgt sodann die empirische Analyse im vierten Abschnitt, die wegen unzureichender Daten in GB schwierig durchzuführen war. Der Autor vergleicht hier Umfang und Entwicklung der Leiharbeit in beiden Ländern, die qualitative Merkmale von Leiharbeitnehmern sowie die arbeitsmarktpolitische Brückenfunktion bzw. Klebeeffekte der Leiharbeit (trotz allzu lückenhafter Quellenmaterialien in GB). In Abstimmung mit dem Theorieteil werden schließlich auch die nachteiligen Merkmale der Prekarität untersucht.
Abschließend werden Theorieteil und die Länder miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Zur wissenschaftlichen Arbeit
- Problemstellung und Zielsetzung
- Begründung des Gliederungskonzepts
- Begriffsbestimmungen: Leiharbeit, andere atypische Beschäftigungsformen und das Normalarbeitsverhältnis
- Bestimmung nach Erwerbstätigkeitsmerkmalen
- Bestimmung nach Flexibilitätscharakter
- Theoretische Grundlagen zur Leiharbeit
- Grundsätzliches Prinzip der Verleihung - das Dreiecksverhältnis
- Arbeitsrecht als institutioneller Rahmen und Determinante
- Aspekte der rechtlichen Ausgestaltung
- SCHLAGLICHT: Der „Gleichbehandlungsgrundsatz“ in der Leiharbeit
- Motive für Leiharbeit aus Sicht der Beteiligten
- Überblick leiharbeitsrelevanter ökonomischer Theorien
- Arbeitsnachfrageseitige Motive
- Personalanpassungsfunktion
- Rekrutierungsfunktion
- Kostenreduktion
- Arbeitsangebotsseitige Motive
- Brückenfunktion und Klebeeffekt
- Genuine Motive
- Rolle und Interessen der Verleiher
- Nachteile bei Leiharbeit aus Sicht der Beteiligten
- Nachteile für Leiharbeitnehmer – „Prekarisierung“ durch Leiharbeit?
- Nachteile für Unternehmen
- Zusammenfassung und abschließende Betrachtung: Die Determinanten der Leiharbeit
- Deutsch-britische Gegenüberstellung
- Rechtliche Situationen und Entwicklungen
- Leiharbeitsregulierung
- SCHLAGLICHT: Die „Personal-Service-Agenturen“ in Deutschland
- Arbeitsmarktregulierung und -konstitution
- Empirische Befunde
- Zu den Datenlagen der Länder
- Umfang und Entwicklung
- Merkmale von Leiharbeitnehmern, Verleihern und Entleihern
- Motive der Leiharbeiter und Übergangsraten in der Leiharbeit
- Motive der Entleiher
- Zur Prekarisierung
- Zu den SCHLAGLICHTERN
- Der „Gleichbehandlungsgrundsatz“ in Europa
- Die „Personal-Service-Agenturen“ in Deutschland
- Zusammenfassende Analyse
- Vergleich: Theoretische Aspekte vs. empirische Befunde
- Vergleich: Deutschland vs. Großbritannien
- Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Leiharbeit und ihrer Rolle als Flexibilisierungsinstrument des Arbeitsmarktes. Sie analysiert die theoretischen und empirischen Grundlagen der Leiharbeit im deutsch-britischen Vergleich, um eine aktuelle Bewertung des Instruments zu ermöglichen.
- Theoretische Erklärungsansätze der Leiharbeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland und Großbritannien
- Empirische Befunde zum Umfang, den Merkmalen und den Folgen der Leiharbeit
- Vergleich der Situation in Deutschland und Großbritannien
- Bewertung der Leiharbeit als Flexibilisierungsinstrument
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Bedeutung der Leiharbeit im Kontext der Arbeitsmarktentwicklung herausgestellt und die Forschungsfrage formuliert. Das zweite Kapitel klärt die Begriffsbestimmungen von Leiharbeit, anderen atypischen Beschäftigungsformen und dem Normalarbeitsverhältnis. Es werden die wichtigsten Merkmale der Leiharbeit und die Unterschiede zu anderen Beschäftigungsformen dargestellt.
Kapitel drei beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Leiharbeit. Es werden verschiedene ökonomische Theorien vorgestellt, die Motive für den Einsatz von Leiharbeit aus Sicht der Unternehmen und Arbeitnehmer erklären. Auch die Nachteile der Leiharbeit werden beleuchtet.
In Kapitel vier wird die rechtliche Situation und die Entwicklung der Leiharbeit in Deutschland und Großbritannien im Vergleich dargestellt. Es werden die wichtigsten Regulierungsmechanismen und die empirischen Befunde zur Verbreitung und den Merkmalen der Leiharbeit in beiden Ländern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Aspekten der Leiharbeit, darunter das Dreiecksverhältnis, die Flexibilität des Arbeitsmarktes, die Prekarisierung von Leiharbeitern, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Großbritannien sowie die Motive und Auswirkungen der Leiharbeit auf Unternehmen und Arbeitnehmer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Leiharbeit und wie funktioniert das Dreiecksverhältnis?
Leiharbeit basiert auf einem Dreiecksverhältnis zwischen dem Verleiher (Arbeitgeber), dem Leiharbeitnehmer und dem Entleiher (Unternehmen, in dem gearbeitet wird).
Welche Motive haben Unternehmen für den Einsatz von Leiharbeit?
Wichtige Gründe sind die Personalanpassungsfunktion (Flexibilität), die Rekrutierungsfunktion (Testen neuer Mitarbeiter) und die Reduktion von Fixkosten.
Was versteht man unter dem „Klebeeffekt“ bei der Leiharbeit?
Der Klebeeffekt bezeichnet die Chance eines Leiharbeitnehmers, nach der Überlassung fest vom Entleihunternehmen übernommen zu werden.
Wie unterscheidet sich die Leiharbeit in Deutschland und Großbritannien?
Der britische Markt gilt als stärker ausgedehnt und flexibler, während in Deutschland die rechtliche Regulierung (z.B. Gleichbehandlungsgrundsatz) traditionell enger gefasst war.
Führt Leiharbeit zur „Prekarisierung“ der Arbeit?
Kritiker weisen darauf hin, dass Leiharbeit oft mit geringerer Entlohnung, weniger Sicherheit und schlechteren Arbeitsbedingungen verbunden ist, was als prekarisierend empfunden wird.
Was ist der Gleichbehandlungsgrundsatz (Equal Treatment)?
Dieser Grundsatz besagt, dass Leiharbeitnehmer für die gleiche Arbeit die gleiche Vergütung und die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen erhalten sollten wie die Stammbelegschaft.
- Quote paper
- Alexander Hilger (Author), 2009, Leiharbeit als probates Flexibilisierungsinstrument des Arbeitsmarktes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144496