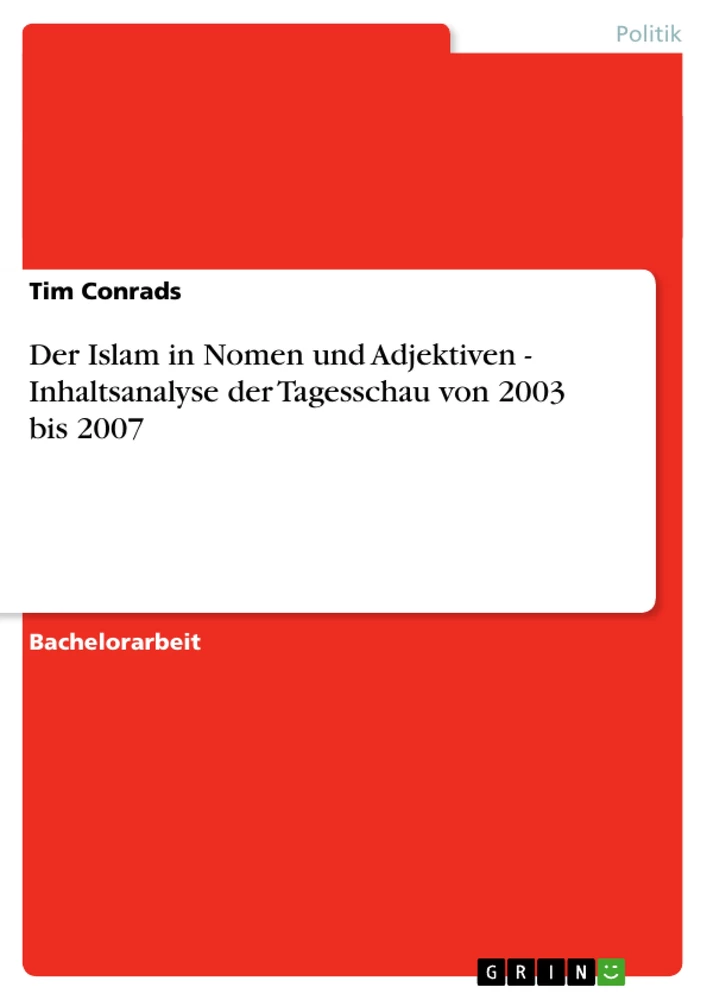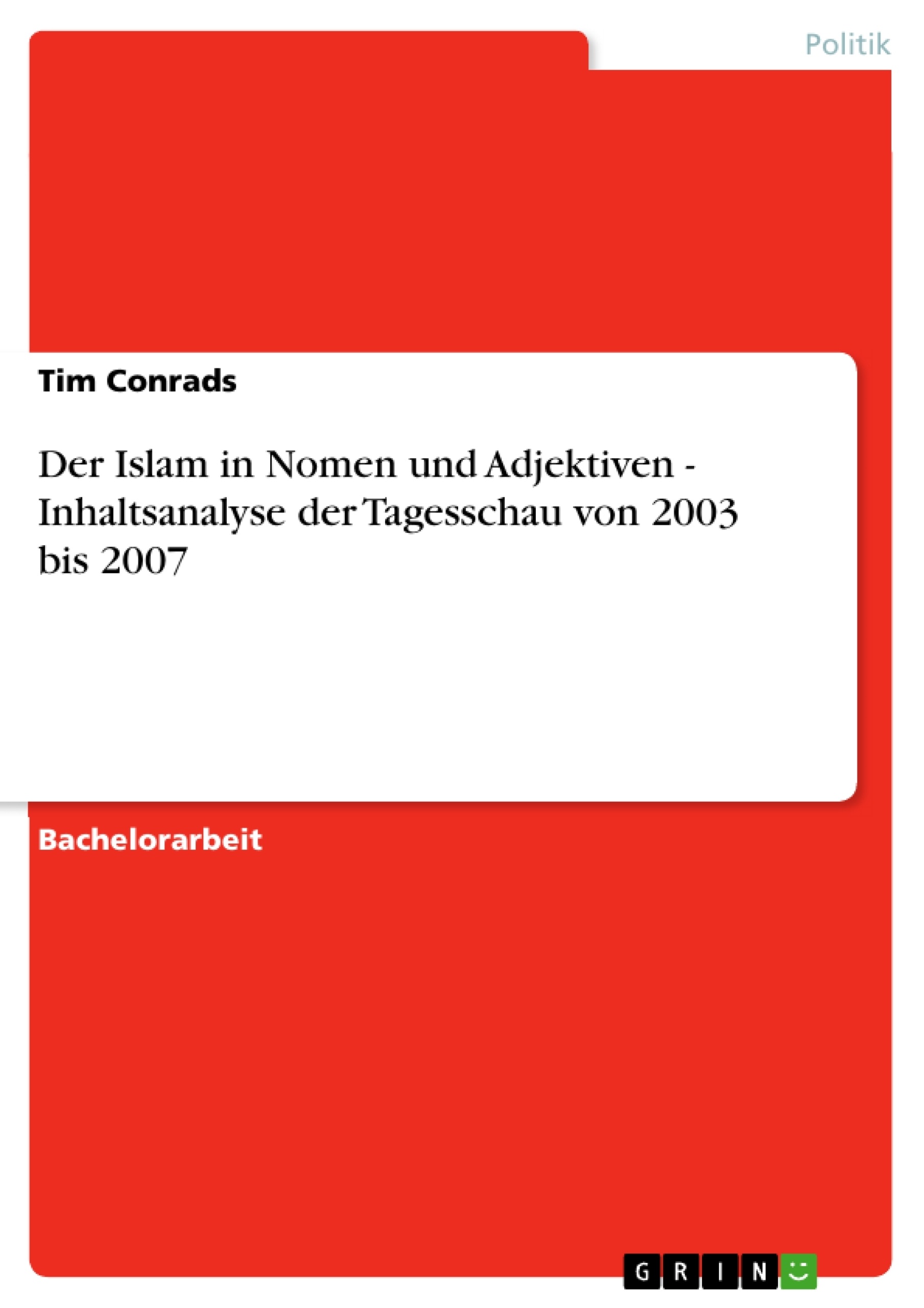Die Terroranschläge vom 11. September 2001 offenbarten mit einem Schlag der Welt einen neuen Feind. Waren in der Zeit des Kalten Krieges die beiden Supermächte Russland und Amerika der jeweilige Feind, konnte dieser „neue“ Feind nicht lokalisiert werden. Der internationale Terrorismus der Al Qaida1 hatte kein Heimatland, besaß keine Botschaften und keine Diplomaten. Die Furcht vor dem islamistischen Terror ergriff die westliche Welt.
Die Kriegserklärung George Bushs gegen den Terror im September 2001 besaß primär einen propagandistischen Wert, sekundär diente sie jedoch als eine allgemeine Kriegserklärung an Staaten, denen Verbindungen zu Al Qaida unterstellt wurden und auf deren Territorium angeblich Terroristen trainierten.
Das erste Ziel war schnell gefunden. Das afghanische Taliban-Regime, welches seit dem Jahr 1995 die dominanteste Fraktion innerhalb Afghanistans war, stellte mit einer islamisch-fundamentalistischen Regierungsform einen islamischen Gottesstaat dar. Das Regime wurde beschuldigt, sowohl Terroristen auszubilden, als auch direkt das Terrornetzwerk Al Qaida zu unterstützen. Mit der UN-Resolution 1368 beschlossen die Vereinten Nationen, alle erdenklichen Schritte zu unternehmen, um auf die Terroranschläge vom 11. September zu antworten und alle Formen des Terrorismus zu bekämpfen.[...]
Täglich gingen unzählige Informationen über Ereignisse im Irak über den Äther. Allein in den öffentlich-rechtlichen Medien ARD und ZDF wurde in der Zeit vom 10. März bis 13. April 2003 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr 9.825 Minuten lang über den Irak berichtet.
[...]
Aufgrund dieser Vermutung stellt sich die Frage, in welchem Maß bei der Berichterstattung über den Irak-Krieg eine subjektive Wertung eines Redakteurs einfloss. Sollte dies der Fall sein, so könnte durch Framing die Berichterstattung über den Irak negativ verzerrt worden sein.
Eine weitere Überlegung hierbei wäre, ob nicht durch die Widerspiegelung der Realität ein kritisches, pazifistisches Bild des Irak-Krieges gezeichnet werden müsste. Begründet werden kann dies mit der breiten gesellschaftlichen Ablehnung eines militärischen Eingreifens im Irak. Betrachtet man diese beiden Überlegungen, so drängt sich die Frage auf, inwieweit bei seriösen Nachrichtensendungen Ereignisse die den Islam oder den Irak betreffen objektiv und ohne Parteinahme dargestellt wurden.
Daraus ergibt sich die Hypothese: Wenn über den Irak oder den Islam berichtet wird, dann wird ein positives oder neutrales Bild vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissenschaftstheoretischer Bezug
- Forschungsdesign
- Die Inhaltsanalyse
- Formen der Inhaltsanalyse
- Die Valenz- und Bewertungsanalysen
- Formale Kategorie
- Inhaltliche Kategorien
- Positive Kategorien
- Negative Kategorien
- Bewertung von Kategorien und Gewichtung von Aussagen
- Die Inhaltsanalyse
- Das Untersuchungsmaterial
- Die ausgewählten Medien
- Auswahl des Untersuchungszeitraumes
- Sequenzanalyse am Beispiel von drei Sendungen
- Die Sendung vom 16. März 2003
- Die Sendung vom 25. März 2003
- Die Sendung vom 2. Mai 2003
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Allgemeine Ergebnisse
- Darstellungsformen
- Themenstruktur
- Ergebnisse der Bewertungsanalyse
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berichterstattung der Tagesschau über den Irakkrieg im Frühjahr 2003. Sie analysiert, inwiefern die Darstellung des Irakkrieges von subjektiven Wertungen beeinflusst wurde und ob ein Framing-Effekt, also eine eingeschränkte Darstellung eines Sachverhaltes, die Berichterstattung negativ verzerrt hat.
- Framing-Effekt in der Berichterstattung über den Irakkrieg
- Objektivität und subjektive Wertungen in Nachrichten
- Analyse der Darstellung des Irakkrieges in der Tagesschau
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Realität
- Die Wirkung der Medien auf die öffentliche Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar und führt in die Thematik der Berichterstattung über den Irakkrieg im Jahr 2003 ein. Sie beleuchtet die Vorgeschichte des Krieges und den politischen Kontext.
Kapitel 2 befasst sich mit dem wissenschaftstheoretischen Bezug der Arbeit. Hier wird der Begriff der Inhaltsanalyse definiert und die Methode der Inhaltsanalyse erläutert.
Kapitel 3 beschreibt das Forschungsdesign. Es werden die Formen der Inhaltsanalyse, die verwendeten Kategorien und die Bewertung der Ergebnisse vorgestellt.
Kapitel 4 beschreibt das Untersuchungsmaterial und die Auswahl der analysierten Sendungen der Tagesschau.
Kapitel 5 präsentiert die Sequenzanalyse von drei ausgewählten Sendungen der Tagesschau. Es werden die Ergebnisse der Analyse der Darstellungsformen, der Themenstruktur und der Bewertungsanalyse dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Medienanalyse, Inhaltsanalyse, Framing-Effekt, Irakkrieg, Tagesschau, Objektivität, subjektive Wertungen, politische Kommunikation und öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Was wurde in der Inhaltsanalyse der Tagesschau untersucht?
Untersucht wurde die Berichterstattung über den Irakkrieg und den Islam im Zeitraum von 2003 bis 2007, insbesondere hinsichtlich Objektivität und Framing.
Was versteht man unter dem „Framing-Effekt“?
Framing bezeichnet die eingeschränkte oder wertende Darstellung eines Sachverhaltes durch Medien, die die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflussen kann.
Welche Hypothese liegt der Arbeit zugrunde?
Die Hypothese lautet, dass bei Berichten über den Irak oder den Islam ein tendenziell positives oder neutrales Bild vermittelt wird.
Wie umfangreich war die Berichterstattung über den Irakkrieg 2003?
Allein zwischen März und April 2003 wurde in ARD und ZDF über 9.800 Minuten lang über den Irak berichtet.
Welche methodischen Werkzeuge wurden genutzt?
Die Arbeit nutzt Valenz- und Bewertungsanalysen sowie Sequenzanalysen spezifischer Sendungen, um positive und negative Kategorien zu gewichten.
- Arbeit zitieren
- Tim Conrads (Autor:in), 2009, Der Islam in Nomen und Adjektiven - Inhaltsanalyse der Tagesschau von 2003 bis 2007, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144512