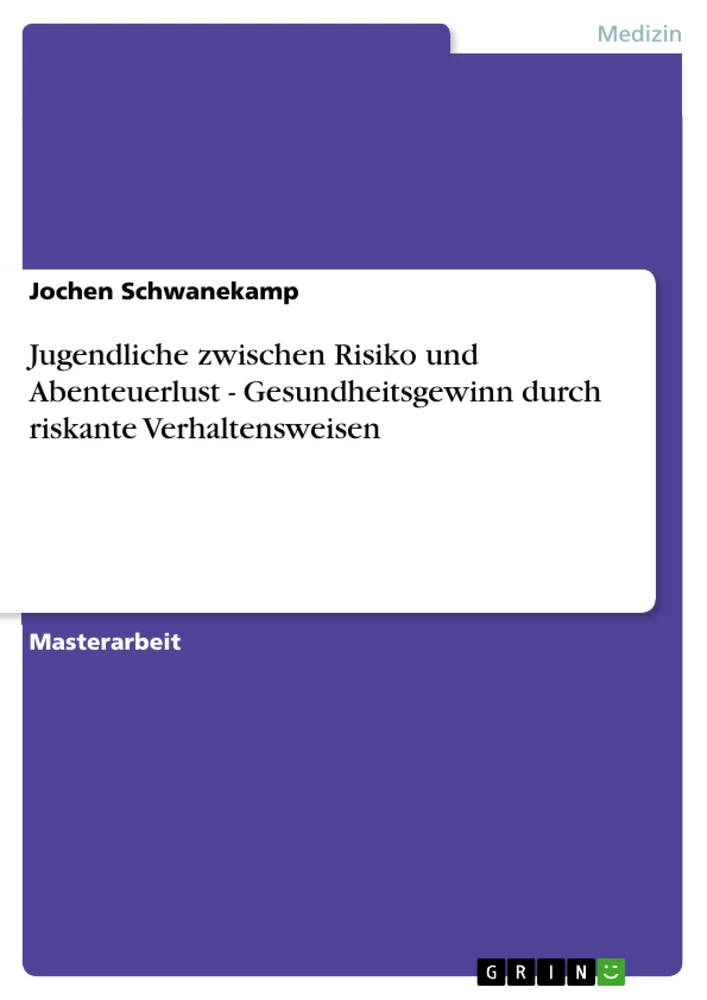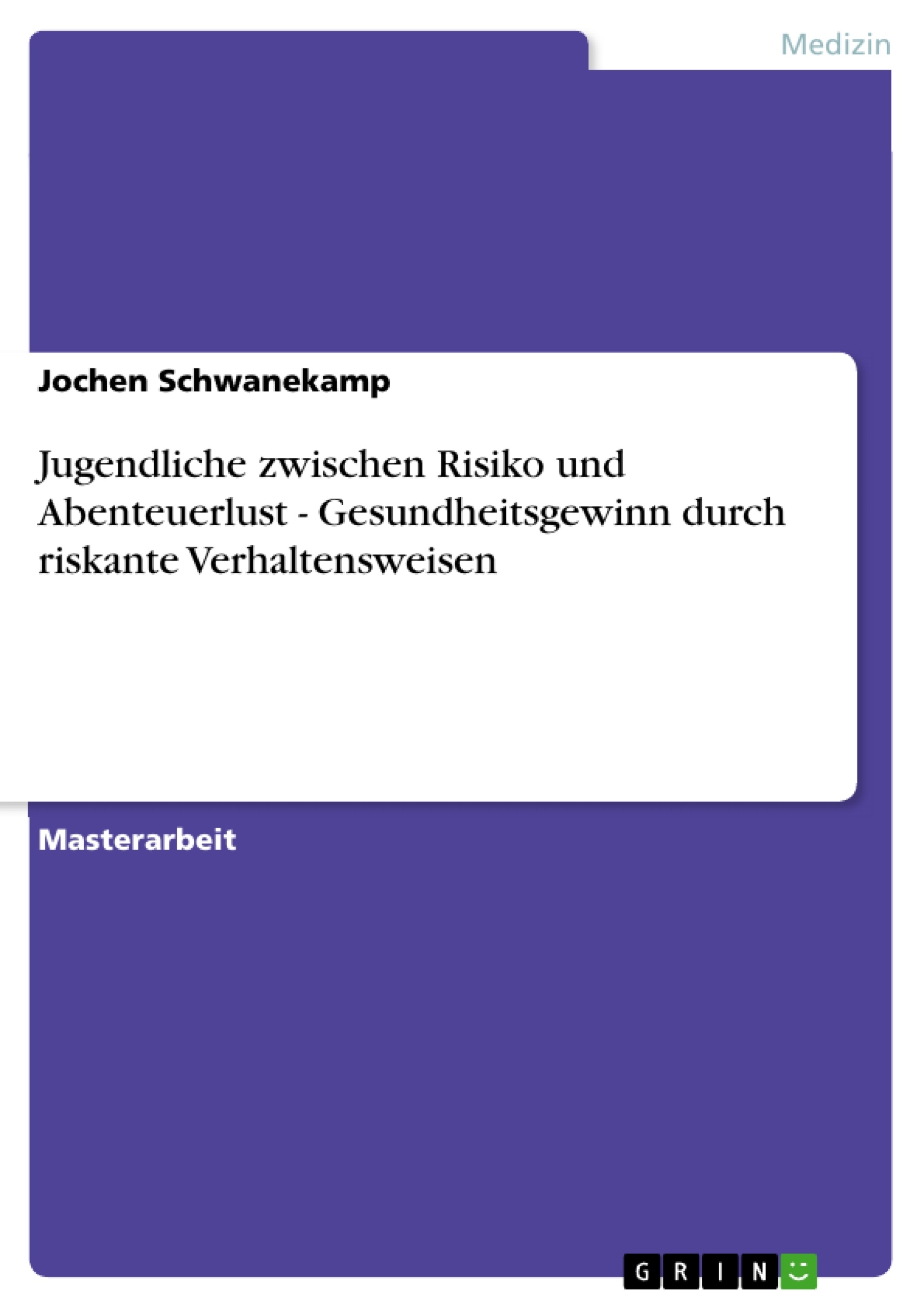Die Adoleszenz ist eine Phase, die für Jugendliche mit vielen
Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben verbunden ist. Riskante
Verhaltensweisen, insbesondere gesundheitliches Risikoverhalten ist ein normaler Bestandteil dieser Entwicklungsphase. Für einen Großteil der Jugendlichen sind riskante Verhaltensweisen Ausdruckeines natürlichen Ausprobier- und Neugierdeverhaltens, welches sich auf die Adoleszenz beschränkt und keinen negativen Einfluss auf die weiteren Entwicklungsprozesse hat. Im Gegenteil: Riskante Verhaltensweisen übernehmen eine Vielzahl von Funktionen für die Jugendlichen und es sind die gänzlich Abstinenten, die ein höheres Maß an Entwicklungsstörungen aufzeigen. Dennoch existieren unzählige Präventionsmaßnahmen, deren Ziel es ist, den Umgang aller Jugendlichen, speziell mit legalen oder illegalen Substanzen, verhindern, reduzieren oder beenden zu wollen. Dies passiert, da gesundheitliches Risikoverhalten ausschließlich als ein für die weitere Entwicklung negativ besetztes Kompensationsverhalten definiert wird. Die Erfolge der Prävention von gesundheitlichen Risikoverhaltensweisen Jugendlicher sind, gerade gemessen am Umfang und der politischen Legitimation der Maßnahmen, enttäuschend gering. Dringend notwendig und wesentlich erfolgversprechender scheint eine Form der Gesundheitsförderung zu sein, die sich durch befähigende Maßnahmen auf die Bildung von Schutzfaktoren, Ressourcen und einer Risikokompetenz im Umgang mit gesundheitlichem Risikoverhalten konzentriert. Das aktuell
vorherrschende Präventionsdogma beruht auf einer Defizit- und
normwertorientierten, stark biomedizinisch geprägten Sichtweise von Gesundheit und Krankheit und deren Bedingungen und Ursachen.
Betrachtet man jedoch die Gesundheit und das Risikoverhalten der
Jugendlichen aus einer ganzheitlichen salutogenetischen und
kulturhistorischen Perspektive, so wird den Funktionen und Vorteilen des Risikoverhaltens, wie Spaß, Genusserleben, Abenteuerlust, Identitätsbildung und Gruppenzugehörigkeitsgefühleine eine gleichberechtigte Rolle in der Bewertung für die Gesundheit der Jugendlichen zuteil.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Risikobegriff
- 2.1 Ursprung des Begriffs Risiko
- 2.2. Von Devianz zum Risikoverhalten
- 2.3. Normativität in den Gesundheitswissenschaften
- 2.4. Das Konstrukt Risiko
- 2.4.1 Karrieren sozialer Probleme
- 3. Formen von riskanten Verhaltensweisen im Jugendalter
- 4. Krankheits- und Gesundheitsmodelle
- 4.1 Das biomedizinische Krankheitsmodell
- 4.1.1 Das Risikofaktorenmodell
- 4.2. Das salutogenetische Gesundheitsmodell
- 4.3. Resilienz
- 5. Erklärungsmodelle für jugendliches Risikoverhalten
- 5.1. Das sozialisationstheoretische Belastungs-Bewältigungs-Modell
- 5.2 Funktionen von Risiko
- 5.3. Risikofaktoren als Schutzfaktoren?
- 6. Hilfsmaßnahmen für Jugendliche
- 6.1 Prävention oder Gesundheitsförderung?
- 6.2 Risikokompetenzen
- 7. Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Thema des jugendlichen Risikoverhaltens und untersucht die verschiedenen Perspektiven auf dieses Phänomen. Ziel ist es, die Funktionen und Vorteile des Risikoverhaltens in der Entwicklung von Jugendlichen aufzuzeigen und die Notwendigkeit einer salutogenetischen Perspektive auf Gesundheitsförderung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens zu beleuchten.
- Die Definition und Entwicklung des Risikobegriffs
- Die verschiedenen Formen von riskanten Verhaltensweisen im Jugendalter
- Die kritische Analyse von Krankheits- und Gesundheitsmodellen
- Die Erläuterung von Erklärungsmodellen für jugendliches Risikoverhalten
- Die Diskussion von Hilfsmaßnahmen für Jugendliche und die Bedeutung von Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des jugendlichen Risikoverhaltens ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung des Risikobegriffs und die Bedeutung von Normativität in den Gesundheitswissenschaften. In Kapitel 3 werden verschiedene Formen von riskanten Verhaltensweisen im Jugendalter vorgestellt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Krankheits- und Gesundheitsmodellen, insbesondere dem biomedizinischen Krankheitsmodell und dem salutogenetischen Gesundheitsmodell. Kapitel 5 diskutiert verschiedene Erklärungsmodelle für jugendliches Risikoverhalten, wie das sozialisationstheoretische Belastungs-Bewältigungs-Modell. Kapitel 6 beleuchtet die Bedeutung von Hilfsmaßnahmen für Jugendliche und die Frage, ob Prävention oder Gesundheitsförderung effektiver sind.
Schlüsselwörter
Jugendliches Risikoverhalten, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Risikokompetenz, Biomedizinisches Modell, Prävention, Entwicklungspsychologie, Normativität, Sozialisation, Adoleszenz.
Häufig gestellte Fragen
Ist Risikoverhalten bei Jugendlichen normal?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass riskante Verhaltensweisen ein normaler Bestandteil der Identitätsbildung und Neugierde in der Adoleszenz sind.
Was ist der „Salutogenese“-Ansatz?
Im Gegensatz zum Fokus auf Krankheiten (Pathogenese) fragt die Salutogenese, was Menschen gesund hält und welche Ressourcen sie zur Bewältigung nutzen.
Welche Funktionen erfüllt Risiko für Jugendliche?
Es dient dem Spaß, dem Genusserleben, der Abenteuerlust sowie der Stärkung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls.
Warum sind viele Präventionsmaßnahmen erfolglos?
Weil sie oft rein defizitorientiert sind und die positiven Funktionen des Risikoverhaltens für die Jugendlichen ignorieren.
Was versteht man unter „Risikokompetenz“?
Es ist die Fähigkeit, Risiken bewusst einzuschätzen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen, statt sie nur strikt zu verbieten.
- Citation du texte
- Jochen Schwanekamp (Auteur), 2010, Jugendliche zwischen Risiko und Abenteuerlust - Gesundheitsgewinn durch riskante Verhaltensweisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144517