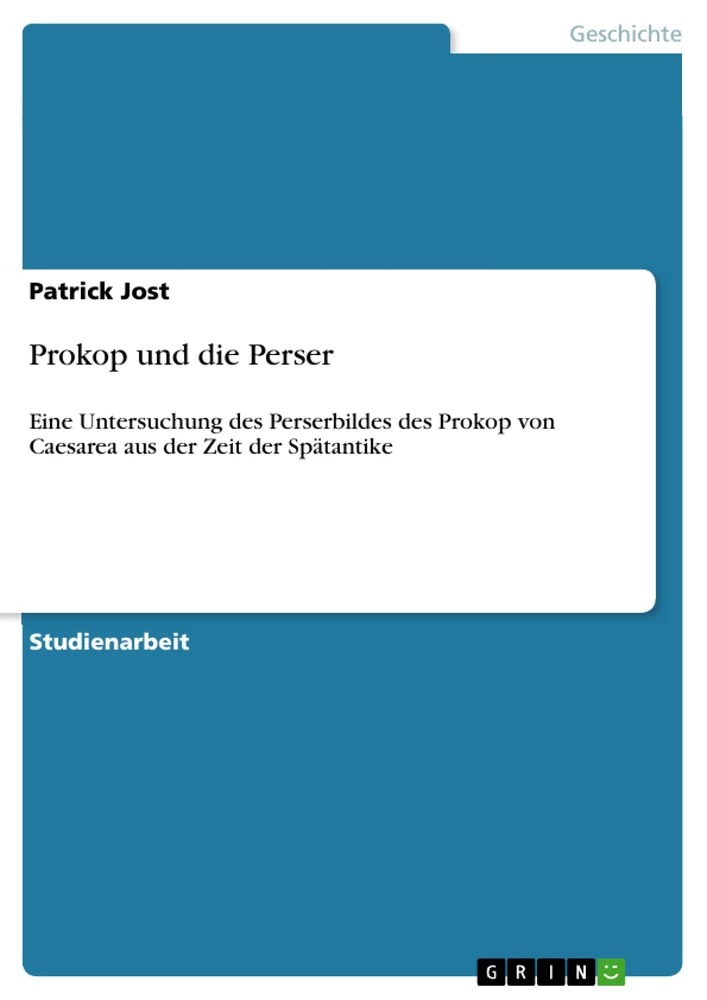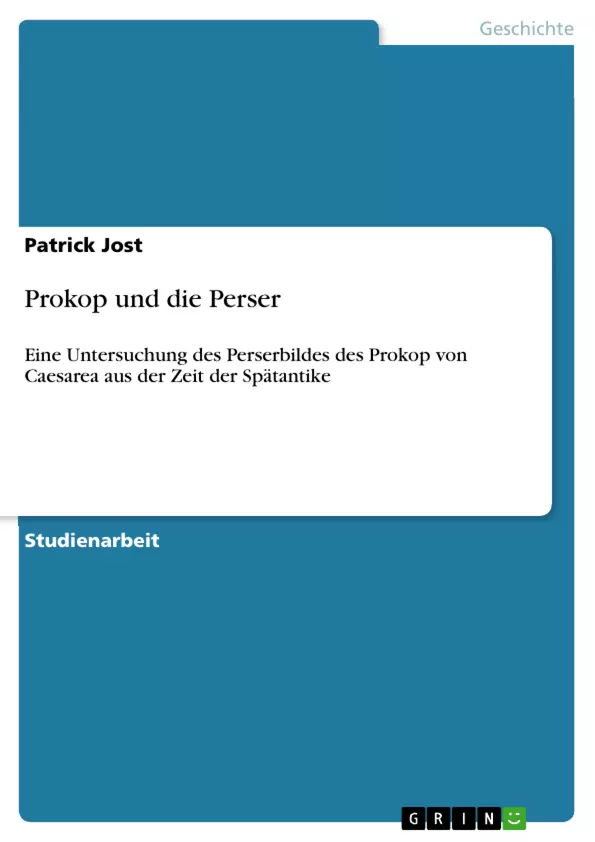Prokopius von Caesarea war einer der wichtigsten spätantiken Historiker des 6. Jahrhunderts . Er versuchte, die Geschehnisse seiner Umwelt in der umbruchsreichen Zeit der Herrschaft Justinians I. „dem Großen“ (527–565) literarisch festzuhalten. In der heutigen historiographischen Debatte herrscht selbstverständlich Konsens darüber, dass Prokop und andere spätantike Geschichtsschreiber kein objektives Bild ihrer zeitgenössischen Welt zeichnen konnten. Dass es also gewisse Einflüsse gegeben haben muss, welche die antike Historiografie beeinflussten, kann somit vorausgesetzt werden.
Aufzuweisen, welche Faktoren die Geschichtsschreibung des Prokop beeinflusst haben, soll das Ziel dieser Arbeit sein, wobei die Herausarbeitung an dem Beispiel der prokopischen Beschreibung des römisch-griechischen Rivalen, dem Sassanidenreich erfolgt. Um dieses Fremdenbild richtig einordnen, und somit die gesuchten Faktoren finden zu können, wird neben einer selektiven, gleichwohl aber repräsentativen Betrachtung römischer Sachkenntnis über das Perserreich, auch der Autor selbst Gegenstand der Untersuchung werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Faktoren für Prokops Perserbild
- I.1 Historizität
- I.2 Griechische Tradition
- I.3 Rolle des Christentums
- II Notio über „den Perser“
- II.1 Volk und Individuum
- II.2 Herrscher
- III Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, welche das Perserbild des spätantiken Historikers Prokop von Caesarea beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Analyse der prokopischen Beschreibung des Sassanidenreichs. Dabei wird neben der römischen Sachkenntnis über Persien auch die Rolle des Autors selbst beleuchtet.
- Einflussfaktoren auf Prokops Perserbild
- Analyse der prokopischen Darstellung des Sassanidenreichs
- Rolle der römischen Sachkenntnis
- Prokops eigene Perspektive und Subjektivität
- Der Einfluss der griechischen Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt Prokop von Caesarea als wichtigen spätantiken Historiker des 6. Jahrhunderts, der die Ereignisse unter Kaiser Justinian I. festhielt. Sie betont die Subjektivität spätantiker Geschichtsschreibung und benennt das Ziel der Arbeit: die Herausarbeitung der Faktoren, die Prokops Perserbild beeinflusst haben. Die Methode beinhaltet eine Betrachtung römischer Kenntnisse über das Perserreich sowie eine Analyse von Prokops eigener Rolle. Die Bedeutung des Barbarentopos, bereits bei Herodot präsent, wird hervorgehoben. Die Arbeit konzentriert sich auf historiographische Aspekte und geht nur am Rande auf die Orientalismusdebatte ein.
I Faktoren für Prokops Perserbild: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die Prokops Perserbild beeinflusst haben. Es beginnt mit der Feststellung, dass Prokop kein neutraler Beobachter war und seine Subjektivität zu berücksichtigen ist, ohne sein Werk deswegen pauschal abzuwerten. Es wird der Aspekt der bewussten oder unbewussten Auswahl von Informationen durch Historiker behandelt und auf Prokops Wahrheitsanspruch eingegangen, der als kontextverpflichtet interpretiert wird. Prokops persönliche Erfahrungen durch seine Zeit an der syrischen Grenze werden als weitere Einflussgröße diskutiert. Seine Recherchen werden als meist gut, wenngleich nicht immer neutral, eingeschätzt. Die Methode der "Autopsie", also die Darstellung persönlicher Erfahrungen, wird im Kontext der antiken Geschichtsschreibung eingeordnet.
II Notio über „den Perser“: [Da der Text keine Kapitel II.1 und II.2 enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden. Es fehlt der entsprechende Textteil im bereitgestellten Dokument.]
Schlüsselwörter
Prokop von Caesarea, Perserbild, Spätantike, Sassanidenreich, Historiografie, Subjektivität, Barbarentopos, Griechische Tradition, Römische Sachkenntnis, Objektivität, Wahrheitsanspruch.
Häufig gestellte Fragen zu Prokops Perserbild
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Faktoren, welche das Perserbild des spätantiken Historikers Prokop von Caesarea beeinflusst haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der prokopischen Beschreibung des Sassanidenreichs und berücksichtigt dabei sowohl die römische Sachkenntnis über Persien als auch die Rolle des Autors selbst.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss verschiedener Faktoren auf Prokops Perserbild, darunter die historische Situation, die griechische Tradition, die Rolle des Christentums, Prokops persönliche Erfahrungen und seine Methode der Geschichtsschreibung. Sie analysiert Prokops Darstellung des Sassanidenreichs und untersucht die Frage der Objektivität und Subjektivität in seiner Darstellung. Der Barbarentopos und die Bedeutung der römischen Sachkenntnis werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Faktoren, welche Prokops Perserbild beeinflussten, und ein Kapitel über Prokops Vorstellung von „dem Perser“. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt Prokop sowie das Ziel der Arbeit. Kapitel I analysiert die Einflüsse auf Prokops Perserbild, einschließlich seiner persönlichen Erfahrungen und seiner Methode. Kapitel II (leider unvollständig im vorliegenden Text) behandelt vermutlich die prokopische Vorstellung von Persern als Volk und Individuen sowie als Herrscher. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine historiographische Methode, die die römische Sachkenntnis über Persien und die Rolle Prokops als Autor analysiert. Sie berücksichtigt die Subjektivität spätantiker Geschichtsschreibung und untersucht die bewusste oder unbewusste Auswahl von Informationen durch Historiker. Die "Autopsie", also die Darstellung persönlicher Erfahrungen, wird im Kontext der antiken Geschichtsschreibung eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prokop von Caesarea, Perserbild, Spätantike, Sassanidenreich, Historiografie, Subjektivität, Barbarentopos, Griechische Tradition, Römische Sachkenntnis, Objektivität, Wahrheitsanspruch.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe fehlt im vorliegenden Text. Es wird jedoch auf Prokops eigene Schriften verwiesen und die griechische und römische Tradition wird als Einflussfaktor genannt.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, der bereitgestellte Text enthält Zusammenfassungen der Einleitung und des ersten Kapitels. Eine Zusammenfassung des zweiten Kapitels fehlt aufgrund unvollständiger Daten.
Wie wird der Wahrheitsanspruch Prokops bewertet?
Prokops Wahrheitsanspruch wird als kontextverpflichtet interpretiert. Seine Subjektivität als Autor wird explizit berücksichtigt, ohne sein Werk deswegen abzuwerten. Seine Recherchen werden als meist gut, aber nicht immer neutral eingeschätzt.
- Arbeit zitieren
- Patrick Jost (Autor:in), 2009, Prokop und die Perser, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144570