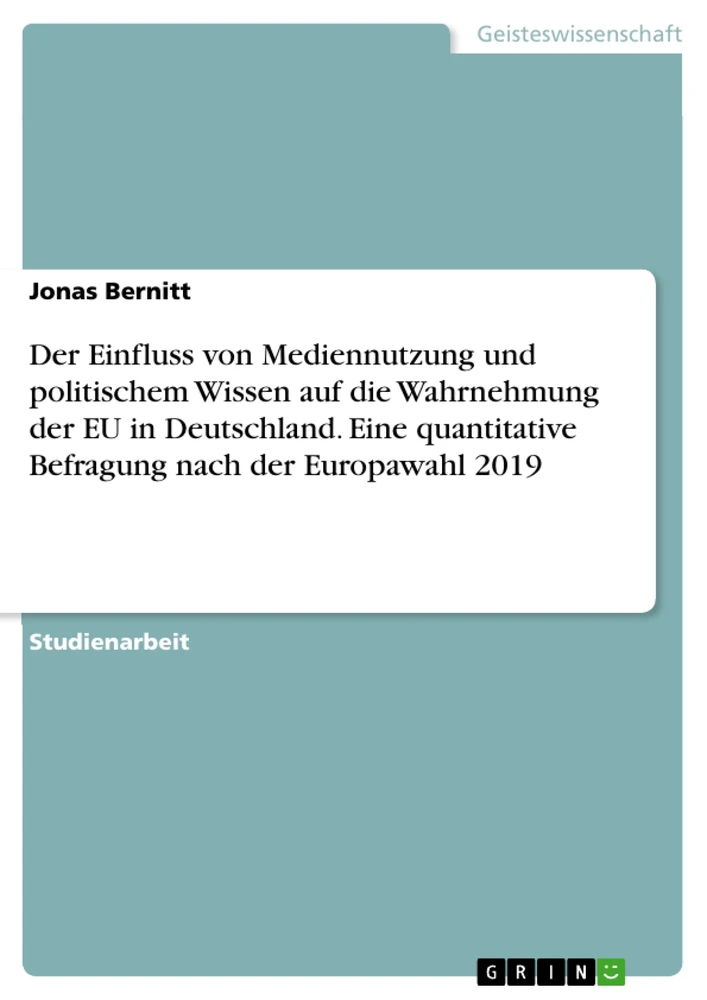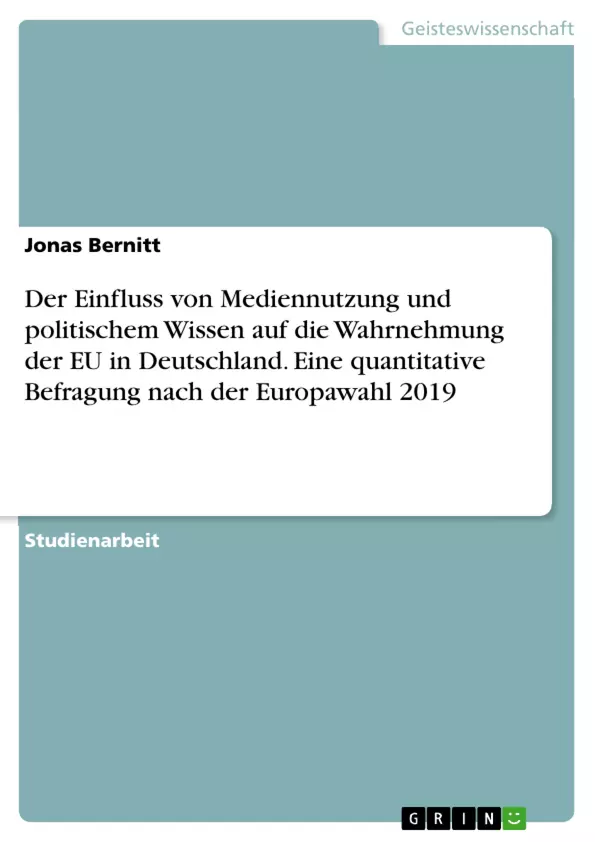Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mediennutzung, politischem Wissen und der Wahrnehmung der Europäischen Union (EU) in Deutschland. Basierend auf vorherigen Forschungsergebnissen zu politischen Themenbereichen wie Immigration und Wirtschaftspolitik sowie der Bedeutung von Medien für die Meinungsbildung, richtet sich das Interesse auf die Fragestellung: "Inwieweit beeinflusst das spezifische politische Wissen in Verbindung mit der Mediennutzung die Perzeption der EU in Deutschland?" Die Arbeit analysiert die Art der Mediennutzung und das politische Wissen der Befragten, um deren Einfluss auf die Wahrnehmung der EU zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, wie sich die individuelle Mediennutzung und das politische Wissen auf die Einstellungen gegenüber der EU auswirken. Die Arbeit folgt einer methodischen Umsetzung, einschließlich Konzeptspezifikation und Datenauswertung, und schließt mit einem Fazit, das die Erkenntnisse zusammenfasst und mögliche Implikationen diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen und Forschungsstand
- Methodik
- Auswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von politischem Wissen in Verbindung mit Mediennutzung auf die Wahrnehmung der Europäischen Union in Deutschland. Sie betrachtet insbesondere die Entwicklung nach der Europawahl 2019 und analysiert, wie Medienkonsum die Bildung politischer Meinungen beeinflusst.
- Die Auswirkungen des politischen Wissens auf die Wahrnehmung der EU
- Die Rolle verschiedener Medienformen im Prozess der politischen Meinungsbildung
- Der Einfluss von sozialer Interaktion und Medienkommunikation auf die Rezeption der EU
- Die Verbindung zwischen politischem Interesse und Mediennutzung
- Der Einfluss des individuellen Medienkonsums auf die politische Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Dieses Kapitel beleuchtet die steigende Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 in Deutschland im Vergleich zu 2014, unterstreicht aber gleichzeitig den Rückgang der Wahlbeteiligung im Vergleich zu 1979. Es werden aktuelle Befunde des Eurobarometers zu den größten Problemen der EU aus deutscher und europäischer Sicht präsentiert, insbesondere zum Thema Immigration und Klimawandel. Das Kapitel zeigt die Relevanz des Zusammenhangs zwischen spezifischen Themenbereichen und der Unterstützung gegenüber Europa auf und stellt die Frage nach dem Einfluss moderner Medien auf die Wahrnehmung der EU.
2. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand
Dieses Kapitel beleuchtet den symbolischen Interaktionismus und die Bedeutung der Medienkommunikation als Form der para-sozialen Interaktion. Es werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die die Verbindung zwischen Mediennutzung und der Zustimmung gegenüber Europa erforschen, insbesondere das Konzept der „Cognitive Mobilization“ von Inglehart (1970) und die Ergebnisse von Karp et al. (2003) zum Zusammenhang zwischen politischem Wissen und der Zufriedenheit mit der EU. Des Weiteren wird das Konzept der „politischen Involvierung“ von Constantin Schäfer (2019) beschrieben und die Studie von Strombäck & Shehata (2010) zu aktiven und passiven Medienkonsummustypen sowie deren Einfluss auf das politische Interesse und die Informationswahl der Menschen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche Politisches Wissen, Mediennutzung, Wahrnehmung der EU, Europawahl 2019, Eurobarometer, Symbolischer Interaktionismus, Cognitive Mobilization, Politische Involvierung, Informationsbeschaffung, politische Meinungsbildung, Soziale Medien, Traditionelle Medien, Politische Teilhabe, Europa-Integration, Hypermedialität.
- Quote paper
- Jonas Bernitt (Author), 2020, Der Einfluss von Mediennutzung und politischem Wissen auf die Wahrnehmung der EU in Deutschland. Eine quantitative Befragung nach der Europawahl 2019, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1446758