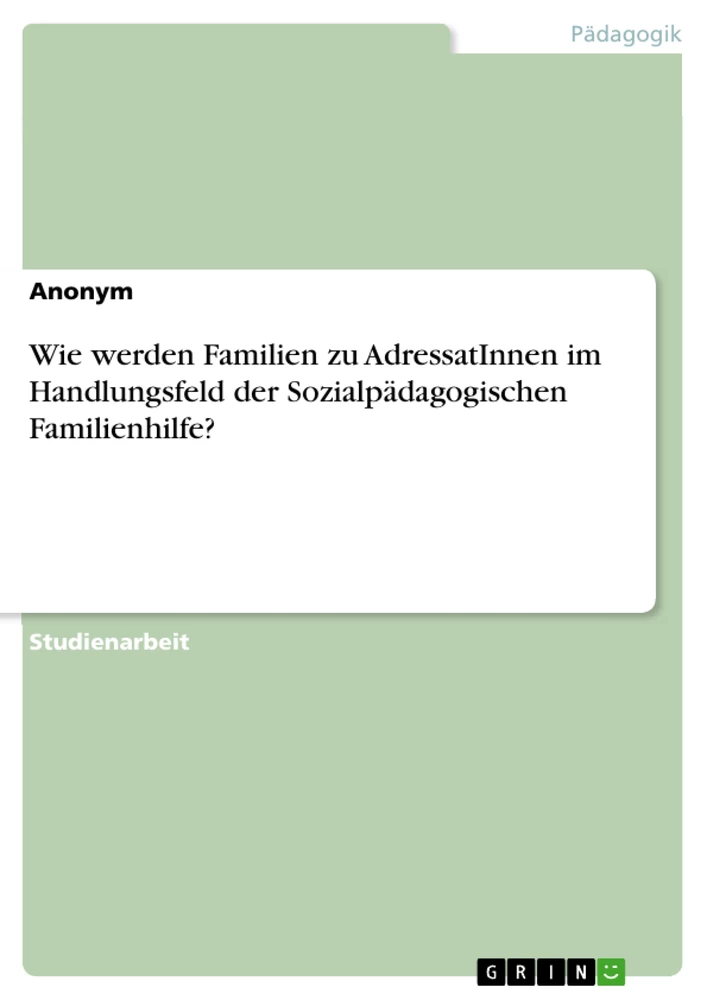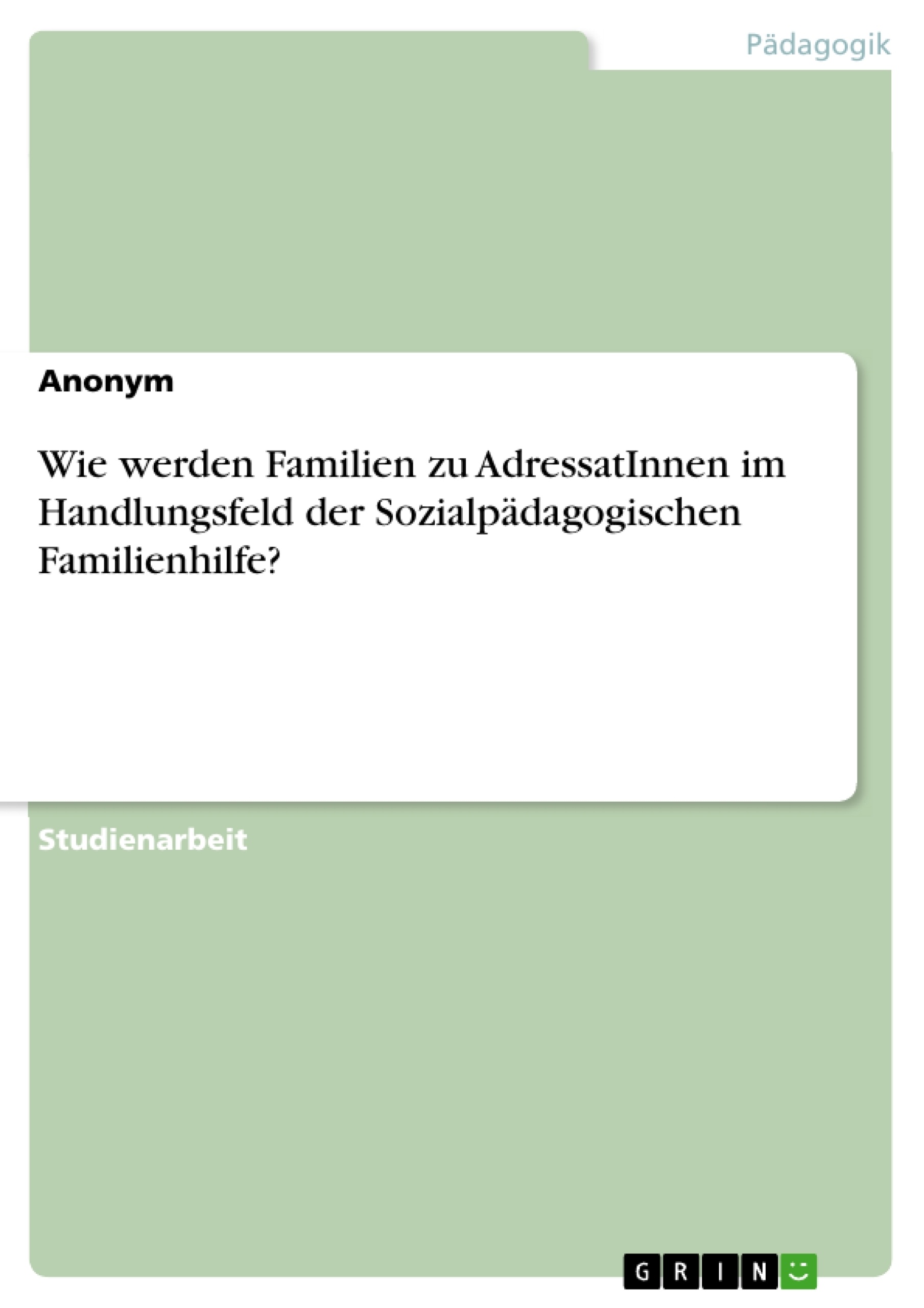In einer Zeit, die durch eine zunehmende Vielfalt in den Strukturen, Ethnien und soziokulturellen Kontexten familialer Lebensweisen geprägt ist, sowie durch wachsende soziale Ungleichheiten und Heterogenität der Lebenslagen von Familien, steigen die Anforderungen und Erwartungen an Familien unaufhaltsam. Die Diskussion um elterliche Verantwortung in Bezug auf Erziehung und Bildung ihrer Kinder verlagert sich zunehmend aus dem privaten Bereich hin zur öffentlichen Debatte. Elternschaft wird nicht nur als natürliche Rolle, sondern auch als herausfordernde Aufgabe betrachtet, die gesellschaftlich diskutiert und bewertet wird. Diese Dynamiken können zu Verunsicherung und Überforderung bei Familien führen.
In diesem Kontext spielt die Soziale Arbeit eine entscheidende Rolle, indem sie Unterstützung und Beratung für Familien bereitstellt. Eine der prominentesten Maßnahmen in diesem Bereich ist die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH). Doch wie genau werden Familien zu Adressaten dieser Unterstützungsmaßnahmen? Diese Frage bildet den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit.
Um diesen Prozess der Adressatenkonstruktion zu verstehen, ist es entscheidend, die Perspektive nach Bitzan und Bolay (2011) zu beleuchten, welche den Prozess auf drei verschiedenen Ebenen untersucht: der Makroebene, der Mesoebene und der Mikroebene. Angesichts der steigenden Bedeutung dieser Thematik in der Sozialen Arbeit ist es unabdingbar, dass Fachkräfte sich der Mechanismen der Adressatenkonstruktion bewusst sind, um problematische Zuweisungen zu vermeiden und angemessen zu handeln.
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher: "Wie werden Familien zu Adressaten im Handlungsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe?" Um dieser Frage nachzugehen, wird zunächst eine theoretische Klärung der Adressatenkonstruktion vorgenommen. Dabei werden die grundlegenden Begriffe der Adressierung erläutert und die Perspektive von Bitzan und Bolay (2017) im Kontext von Familien im Rahmen der SPFH dargestellt.
Anschließend wird der Prozess der Adressatenkonstruktion auf Familien im Handlungsfeld der SPFH übertragen. Diese Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse, die einen Beitrag zum besseren Verständnis der Adressatenkonstruktion in der Sozialen Arbeit leisten soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil
- Zum Begriff der AdressatInnen
- Die Relationale Adressatenkonstruktion
- Makroebene
- Mesoebene
- Mikroebene
- Hauptteil
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- Familien
- Makroebene bezogen auf SPFH
- Mesoebene bezogen auf SPFH
- Mikroebene bezogen auf SPFH
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Konstruktion von Familien als Adressaten im Handlungsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Die Arbeit fokussiert dabei auf den Prozess der Adressatenkonstruktion nach Bitzan und Bolay (2011), der auf drei Ebenen – Makro-, Meso- und Mikroebene – betrachtet wird.
- Analyse des Konzepts der Adressatenkonstruktion im Kontext der SPFH
- Untersuchung der Einflüsse von gesellschaftlichen, institutionellen und interaktionellen Faktoren auf die Konstruktion von Familien als Adressaten
- Bedeutung der „responsibilisierenden“ Entwicklungen im Sozialstaat für die Konstruktion von Familien als Adressaten
- Bewertung der Rolle der Sozialen Arbeit in der Adressatenkonstruktion und der „Normalisierungsaufgaben“
- Identifizierung potenzieller Problembereiche und Herausforderungen in der Adressatenkonstruktion von Familien im Rahmen der SPFH
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das klassische Verständnis von Familie in den Kontext gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und verdeutlicht die Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Familien. Die Arbeit stellt die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) als zentrale Hilfestellung vor und erklärt die Notwendigkeit, den Prozess der Adressatenkonstruktion zu verstehen. Die Arbeit basiert auf dem Konzept der Relationalen Adressatenkonstruktion von Bitzan und Bolay (2011), das auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet wird.
Im Theorieteil wird der Begriff der AdressatInnen im Kontext der Sozialen Arbeit beleuchtet, mit Fokus auf die „Doppelperspektive“ der Lebensweltorientierung nach Thiersch. Der Theorieteil erklärt die Relationale Adressatenkonstruktion, die von einem „Wechselspiel“ der „gegenseitigen Formung (Adressierung und Readressierung) unter unterschiedlichen Machtmöglichkeiten“ ausgeht. Die Arbeit stellt die drei Ebenen der Relationalen Adressatenkonstruktion – Makro-, Meso- und Mikroebene – vor.
Der Hauptteil der Arbeit überträgt den zuvor dargestellten Prozess der Adressatenkonstruktion auf Familien im Handlungsfeld der SPFH. Hierbei werden die Einflüsse der Makro-, Meso- und Mikroebene auf die Konstruktion von Familien als Adressaten der SPFH analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Konstruktion von Familien als Adressaten im Handlungsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Zentral sind dabei die Begriffe der „Relationalen Adressatenkonstruktion“, „Makroebene“, „Mesoebene“, „Mikroebene“, „Responsibilisierung“, „Normalisierungsaufgaben“ und „Lebensweltorientierung“. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Einflüssen von gesellschaftlichen, institutionellen und interaktionellen Faktoren auf die Adressatenkonstruktion und analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Prozess der Adressatenherstellung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Wie werden Familien zu AdressatInnen im Handlungsfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1447003