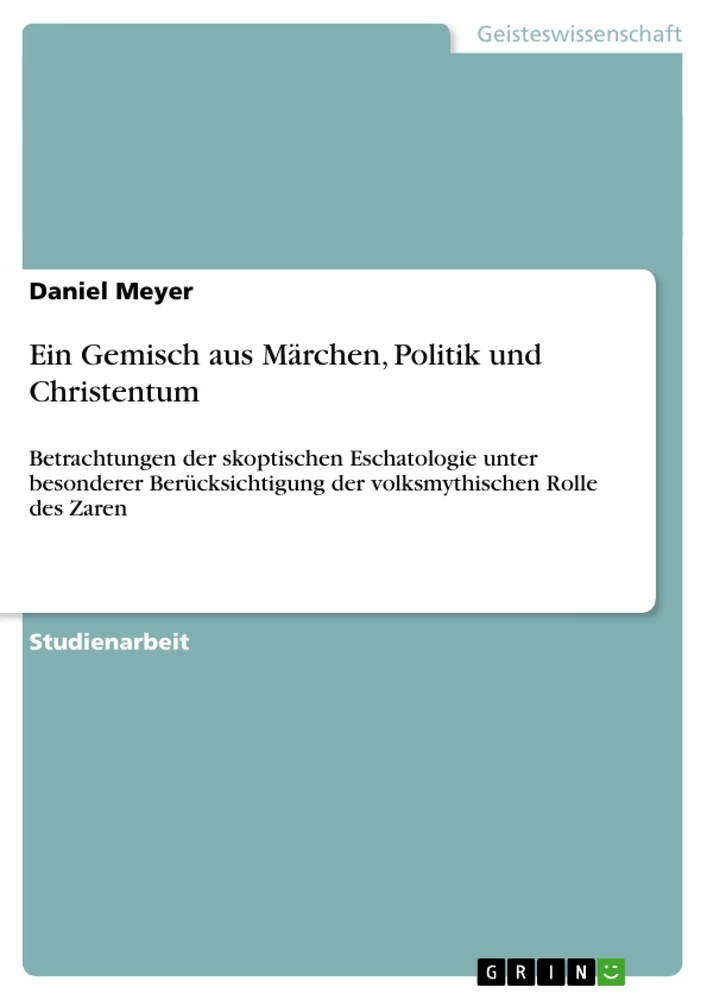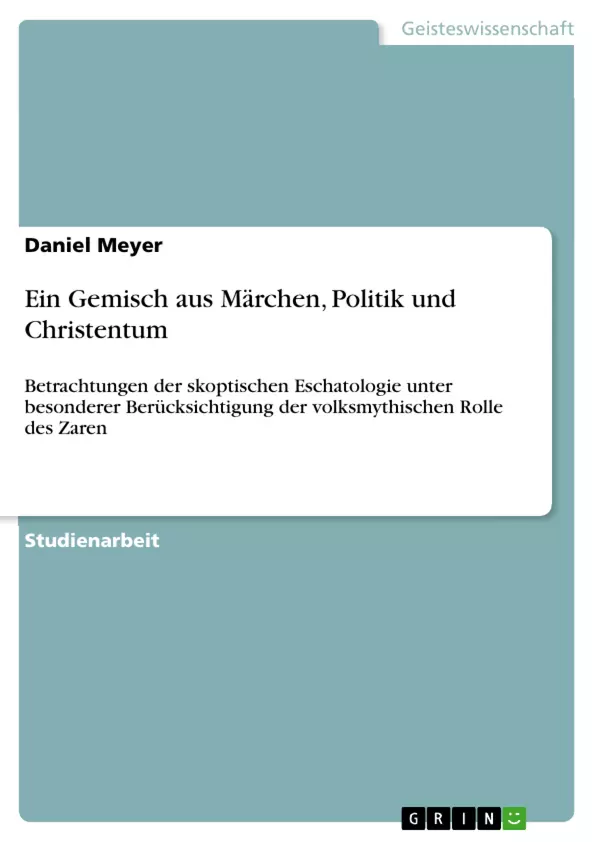„Auf diesem fürchterlichen Drachen muß ich sitzen für meine Geilheit und Lüsternheit nach
schamlosen Genüssen, und er martert mich mit unaussprechlicher Marter, er brennt mit
höllischem Feuer meine geheimen Glieder und mein ganzes Eingeweide zur Strafe für meine
bösen und vielen verruchten Taten.“
Es war einmal vor langer Zeit, da kamen zwei Mönche in ein kleines Dorf. Die Bewohner dieses
Dorfes lebten fromm und ließen sich nur selten etwas zu Schulden kommen. Ihr Dasein, obwohl
hart und beschwerlich, war einfach und demütig – demütig vor der Herrlichkeit und der
allgegenwärtigen Liebe Gottes. Doch wie überall in der Welt trafen die beiden Mönche auch hier
die Sünde an. Ein Weib, das Unzucht mit Blutsverwandten getrieben und sich den schamlosesten
leiblichen Vergnügungen hingegeben hatte, konnte mit ihrer Last nicht mehr leben und vertraute
sich deshalb einem der Mönche an. Doch ihre Vergehen waren so groß, dass sie ihre schlimmsten
Taten verschwieg. Der Mönch, unwissend über den Betrug des Weibes, sprach sie nach altem
Ritus ihrer Sünden frei und legte ihr die Buße auf. Doch kaum hatten die beiden Geistlichen das
Dorf verlassen, beschlich sie ein ungutes Gefühl. „Wahrlich, Bruder, sie hat eine Sünde
verschwiegen, laß uns zurückpilgern, Bruder, und sie zur Reue bekehren.“ Doch als sie in das
Dorf zurückgekehrt waren, fanden sie das Weib tot. Das Wehklagen der Mönche war so groß,
dass sie drei Tage großen Kummer hatten und zu Gott beteten, er möge der Seele dieser armen
Frau seine unendliche Güte zuteil werden lassen. Wie in einem Traum erschien den Mönchen die
tote Frau. Ein schreckliches Bild bot sich den beiden dar – das Weib litt Qualen. Sie war umringt
von Riesenschlangen, Fledermäusen, saß auf einem Drachen und ihr Leib war übersät mit
Wunden. Auf das Drängen der Mönche berichtete sie von ihrem Schicksal. Dieses hatte sie
verdient, weil sie die größte Sünde aus Scham verschwiegen hatte.
Diese und ähnliche Erzählungen bilden den Grundtenor der russischen Folklore. Oftmals geht es
darum, dass ein Mensch – der den Geboten Gottes zuwider gehandelt hat – nach seinem Tode mit
den größten Qualen bestraft wird. Der Auszug aus „Die Höllenqualen der Sünderin“ ist daher bei
weitem kein Einzelfall. Er steht Patron für eine ganze Reihe von Erzählungen [..]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Strafe für Geilheit und Lüsternheit – Die Skopzen im Kontext ihrer Zeit
- Einleitung
- 2. Die Basis der skoptischen Eschatologie – Konglomerat aus Märchen, politischen Unruhen und christlichem Glauben
- 2.1. Es war einmal ein Zar, der….. - Das russische Volk und seine Hoffnungen auf einen märchenhaften Retter
- 2.2. Die Idealisierung des Zarewitschs Petr Fedorovič – Von Ivanovič Pugačëv bis Kondratij Selivanov
- 2.3. Ein weiterer Prätendent oder die letzte Offenbarung Christi? – Die Gestalt des Kondratij Selivanov
- 3. Die Eschatologie der Skopzen - Zwischen Personenkult und Endzeit
- 3.1. Der Gottessohn in Petersburg und die 144.000 Lämmer – Voraussetzungen für das Eintreten der Endzeit
- 3.2. Paradies und Hölle – Zwei irdische Urteile im Jüngsten Gericht
- 3.3. Das Jüngste Gericht und der darauffolgende Zustand auf Erden
- 4. Ein Geheimnis, umgeben von einem Mysterium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die eschatologische Lehre der Skopzen im Kontext des russischen Volksglaubens und der politischen Unruhen des 18. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Rolle des Zaren im skoptischen Weltbild und analysiert, wie Kondratij Selivanov bestehende Mythen und religiöse Vorstellungen aufgriff und in seine eigene Eschatologie integrierte.
- Die Rolle der russischen Folklore und des Volksglaubens in der Entwicklung der skoptischen Eschatologie
- Die Idealisierung des Zaren im russischen Volksglauben und deren Instrumentalisierung durch Selivanov
- Die Verbindung von christlichem Glauben, politischen Unruhen und märchenhaften Elementen in der skoptischen Lehre
- Die eschatologischen Vorstellungen der Skopzen und ihre Bedeutung im Kontext der Sektengeschichte
- Kondratij Selivanov als zentrale Figur und seine Selbstinszenierung als Prophet, Christus und Zar.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Strafe für Geilheit und Lüsternheit – Die Skopzen im Kontext ihrer Zeit: Das Kapitel beginnt mit einer russischen Folkloreerzählung, die die grausame Bestrafung leiblicher Sünden im Jenseits schildert. Diese Erzählung dient als Einführung in die Denkweise des russischen Volkes, die stark von der Angst vor körperlicher Sünde geprägt war. Der Fokus liegt auf der Darstellung leiblicher Sünden und ihrer Konsequenzen im Jenseits, im Kontext der russischen Folklore. Der Text führt dann die Skopzen ein, eine Sekte, die diese Angst vor leiblicher Sünde auf die Spitze trieb und Kastration als Mittel zur Erlösung von der Ursünde sah. Die Einführung der Skopzen und ihrer Praxis wird hier als Ausgangspunkt für die Untersuchung ihrer eschatologischen Lehre gelegt, welche im weiteren Verlauf der Arbeit erörtert wird.
2. Die Basis der skoptischen Eschatologie – Konglomerat aus Märchen, politischen Unruhen und christlichem Glauben: Dieses Kapitel untersucht die historischen und sozialen Umstände, die zur Entstehung der Skopzen-Sekte beitrugen. Es beschreibt die gesellschaftlichen und religiösen Spannungen im 17. Jahrhundert in Russland, die durch den Zerfall der religiösen Einheit, den Niedergang traditionellen Frömmigkeitsverständnisses und die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die Kirche gekennzeichnet waren. Diese Unruhen und das daraus resultierende Misstrauen gegenüber der Obrigkeit und der Kirche schufen einen Nährboden für neue religiöse Bewegungen wie die Skopzen. Das Kapitel betont, dass die skoptische Lehre ein komplexes Gefüge aus Volksglauben, politischer Unzufriedenheit und christlicher Theologie darstellte, und weist auf die Schwierigkeiten hin, diese heterogene Ideologie vollständig zu entschlüsseln.
Schlüsselwörter
Skopzen, Eschatologie, russischer Volksglauben, Kondratij Selivanov, Zar Peter III., Kastration, religiöse Sekte, Endzeitvorstellungen, leibliche Sünde, russische Folklore, politische Unruhen, orthodoxes Christentum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Eschatologie der Skopzen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die eschatologische Lehre der Skopzen, einer russischen Sekte des 18. Jahrhunderts, im Kontext des russischen Volksglaubens und der politischen Unruhen dieser Zeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle des Zaren im skoptischen Weltbild und der Integration bestehender Mythen und religiöser Vorstellungen durch Kondratij Selivanov in die skoptische Eschatologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der russischen Folklore und des Volksglaubens, die Idealisierung des Zaren im russischen Volksglauben und deren Instrumentalisierung durch Selivanov, die Verbindung von christlichem Glauben, politischen Unruhen und märchenhaften Elementen in der skoptischen Lehre, die eschatologischen Vorstellungen der Skopzen und deren Bedeutung im Kontext der Sektengeschichte sowie Kondratij Selivanov als zentrale Figur und seine Selbstinszenierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Skopzen im Kontext ihrer Zeit und die Strafe für leibliche Sünden. Kapitel 2 untersucht die Basis der skoptischen Eschatologie als Konglomerat aus Märchen, politischen Unruhen und christlichem Glauben. Kapitel 3 befasst sich mit der Eschatologie der Skopzen zwischen Personenkult und Endzeit. Kapitel 4 ist kürzer und lässt den Titel "Ein Geheimnis, umgeben von einem Mysterium" offen.
Wer war Kondratij Selivanov?
Kondratij Selivanov war eine zentrale Figur in der Skopzen-Bewegung. Die Arbeit analysiert seine Rolle als Prophet, Christus und Zar und wie er bestehende Mythen und religiöse Vorstellungen in die skoptische Eschatologie integrierte.
Welche Rolle spielte der Zar im skoptischen Weltbild?
Der Zar spielte eine wichtige Rolle im skoptischen Weltbild. Die Arbeit beleuchtet, wie die Idealisierung des Zaren im russischen Volksglauben von Selivanov instrumentalisiert wurde und in seine eschatologische Lehre eingeflossen ist.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist in der vollständigen Arbeit aufgeführt. Die Arbeit stützt sich auf historische Dokumente, religiöse Texte und die Analyse der russischen Folklore.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Skopzen, Eschatologie, russischer Volksglauben, Kondratij Selivanov, Zar Peter III., Kastration, religiöse Sekte, Endzeitvorstellungen, leibliche Sünde, russische Folklore, politische Unruhen, orthodoxes Christentum.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten gedacht, die sich mit der Geschichte religiöser Sekten, der russischen Geschichte, der Eschatologie und dem russischen Volksglauben befassen.
Wie wird die eschatologische Lehre der Skopzen dargestellt?
Die eschatologische Lehre der Skopzen wird als komplexes Gefüge aus Volksglauben, politischer Unzufriedenheit und christlicher Theologie dargestellt. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Elemente und ihren Zusammenfluss in der skoptischen Endzeitvorstellung.
- Quote paper
- Daniel Meyer (Author), 2009, Ein Gemisch aus Märchen, Politik und Christentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144756