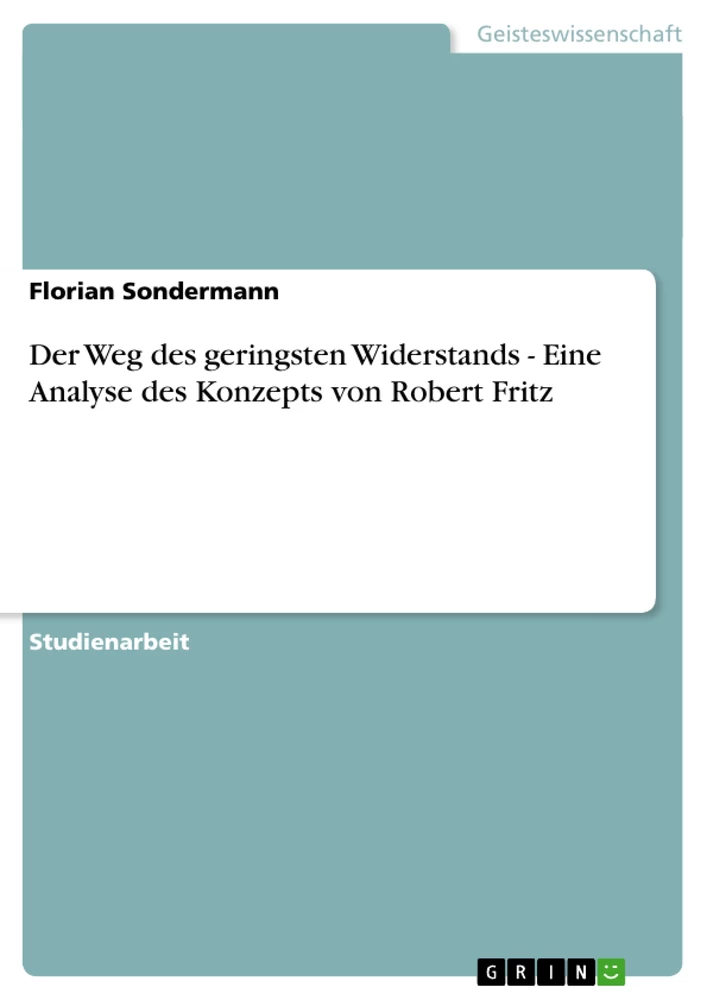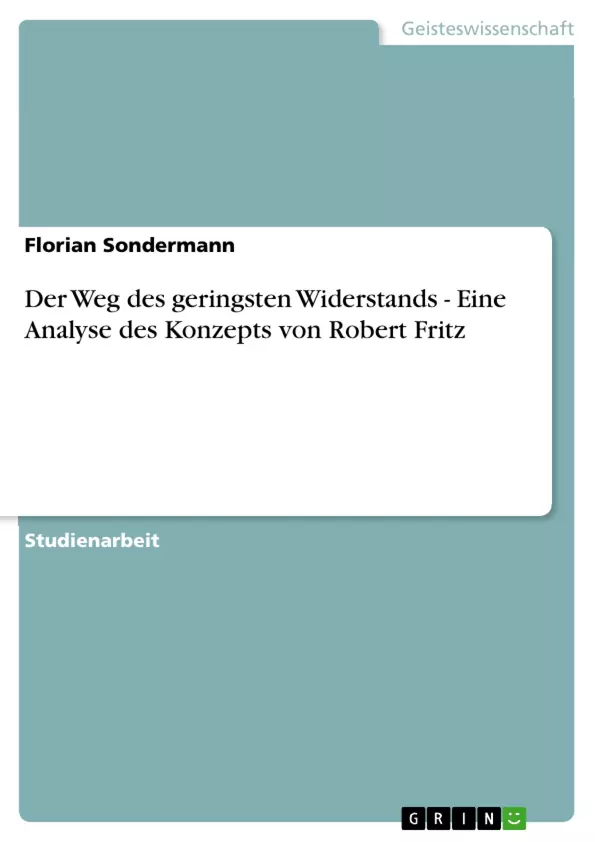Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Seminars zu Change Management und Organisationsentwicklung an der Universität Duisburg-Essen im Fach Soziale Arbeit. Sie stellt einen Ansatz der Organisationsentwicklung vor, der von Robert Fritz unter dem Titel „Der Weg des geringsten Widerstands“ bereits in den 1980er Jahren entwickelt wurde, und bemüht sich diesen Ansatz mit gängigen Konzepten von Change Management zu vergleichen und zu vereinbaren. Hierzu wird in einem ersten Schritt die Theorie des Fritzschen Denkansatzes aufbereitet: Es wird erläutert, was der Unterschied ist zwischen strukturellem Konflikt und struktureller Spannung. Die daraus abgeleiteten Prinzipien der strukturellen Dynamik sind das Gerüst mithilfe dessen eine Organisation ziel- und lösungsorientiert neu konstruiert werden kann. Zweitens erfolgt der Versuch, die analysierten Prinzipien der strukturellen Dynamik mit den Change Management - Konzepten von Kurt Lewin und Edgar Schein zu vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gegenüberzustellen. Abschließend wagt der Autor anstelle eines Fazits einen Ausblick: Die dargelegten Modelle und Schemata sollen in ein größeres Verständnis abstrahiert und im Licht eines systemtheoretischen Denkens interpretiert werden.
Inhalt
1. Einleitung
„Das haben wir schon immer so gemacht!“, oder alternativ: „Das war aber noch nie so!“ sind Sätze die jeder schon mal gehört hat. Sie sind charakteristisch für Organisationen, die sich nicht wandeln wollen, die Veränderung ablehnen. Prinzipiell ist daran nichts auszusetzen: Organisationen sind von Natur aus träge und auf Kontinuität ausgerichtet, dass ist nötig um Erfahrungswissen zu produzieren, Sicherheit zu schaffen und gleichbleibend gute Qualität zu gewährleisten.
Dennoch ist es manchmal nötig Veränderungen durchzuführen, um das Ziel einer Organisation auch unter gewandelten Bedingungen von Umwelt, Politik, Gesellschaft, und so fort, weiter zu verfolgen und erreichen zu können.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Seminars zu Change Management und Organisationsentwicklung an der Universität Duisburg-Essen im Fach Soziale Arbeit. Sie stellt einen Ansatz der Organisationsentwicklung vor, der von Robert Fritz unter dem Titel „Der Weg des geringsten Widerstands“ bereits in den 1980er Jahren entwickelt wurde, und bemüht sich diesen Ansatz mit gängigen Konzepten von Change Management zu vergleichen und zu vereinbaren.
Hierzu wird in einem ersten Schritt die Theorie des Fritzschen Denkansatzes aufbereitet: Es wird erläutert, was der Unterschied ist zwischen strukturellem Konflikt und struktureller Spannung. Die daraus abgeleiteten Prinzipien der strukturellen Dynamik sind das Gerüst mithilfe dessen eine Organisation ziel- und lösungsorientiert neu konstruiert werden kann. Zweitens erfolgt der Versuch, die analysierten Prinzipien der strukturellen Dynamik mit den Change Management - Konzepten von Kurt Lewin und Edgar Schein zu vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten gegenüberzustellen.
Abschließend wagt der Autor anstelle eines Fazits einen Ausblick: Die dargelegten Modelle und Schemata sollen in ein größeres Verständnis abstrahiert und im Licht eines systemtheoretischen Denkens interpretiert werden.
2. Der Weg des geringsten Widerstands
Legt man einen großen Stein in einen Bach, so fließt das Wasser nicht durch ihn hindurch, nicht über ihn hinweg, sondern um ihn herum. Es sucht sich seinen Weg. Lässt man einen Ball auf einen unebenen Boden fallen, so rollt er stets bergab. Er käme nie auf die Idee bergauf zu rollen.
Solche scheinbar simplen physikalischen Beobachtungen lassen sich von der Ebene der Naturgesetze abstrahieren. Sie zeigen, dass jede Bewegung automatisch in die Richtung stattfindet, in der am wenigsten Widerstand herrscht. Robert Fritz formuliert dazu drei grundlegende Einsichten:
1. Energie nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands.
2. Die grundlegende Struktur einer Sache bestimmt den Weg des geringsten Widerstands.
3. Wir k ö nnen den Weg des geringsten Widerstands selbst bestimmen, indem wir neue Strukturen schaffen. (Fritz 2000:21f)
Hier wird ein Set formaler Axiome definiert, auf denen aufbauend Fritz ein Regelwerk aus 9 Grundsätzen schlussfolgert. Zentrales Motiv ist dabei das Verständnis der Bewegung, Aktion und Wandlung von Organisationen. Er unterscheidet diese Bewegung in die Kategorien „Fortschritt“ und „Oszillation“ (Fritz 2000:36).
2.1 Struktureller Fortschritt
Fortschritt, so Fritz, entsteht in einem Unternehmen durch strukturelle Spannung. Gemeint ist damit die Diskrepanz zwischen dem aktuellen und dem angestrebten Zustand. Der Weg des geringsten Widerstandes führt in diesem Fall hin zur Auflösung der Spannung: der aktuelle Zustand wird weiterentwickelt, bis er dem angestrebten Zustand entspricht. Damit eine solche Spannung entsteht, muss jedoch die richtige Struktur im Unternehmen vorhanden sein: „Wenn eine Organisation die richtigen Grundstrukturen für einenfortschreitenden Weg des geringsten Widerstandes aufbaut, kann sie sich kontinuierlich von einem Ziel zum nächsten voranbewegen.“ (Fritz 2000:36, Hervorhebung im Original) Mit Struktur ist im Fall der Organisationen die Herangehensweise und Methodik der Weiterentwicklung gemeint. Sie wird vereinfacht in einem Top-Down-Schema dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Methodik des strukturellen Fortschritts (vgl. Fritz 2000:57)
Fritz nennt diese schematische Darstellung „structural tension charting“ und erläutert: „Bei diesem Planungsprozess wird das Ermitteln der eigenen Hauptziele zum Motor, der uns dazu antreibt, die bestehende Realität zu definieren und ein Handlungskonzept für die Erreichung dieser Ziele zu entwickeln.“ (Fritz 2000:65).
Nach einer groben Vordefinition wird der Handlungsplan ausdifferenziert und in kleinstmögliche Schritte unterteilt. Diese werden dann ebenfalls mit einem „structural tension chart“ versehen, so dass für jede nötige Veränderung eine entsprechende Spannung erzeugt wird.
Auf diese Weise soll es gelingen, selbst größte Veränderungen erfolgreich umzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Soz.arb./Soz.päd. (FH) Florian Sondermann (Autor:in), 2009, Der Weg des geringsten Widerstands - Eine Analyse des Konzepts von Robert Fritz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144776