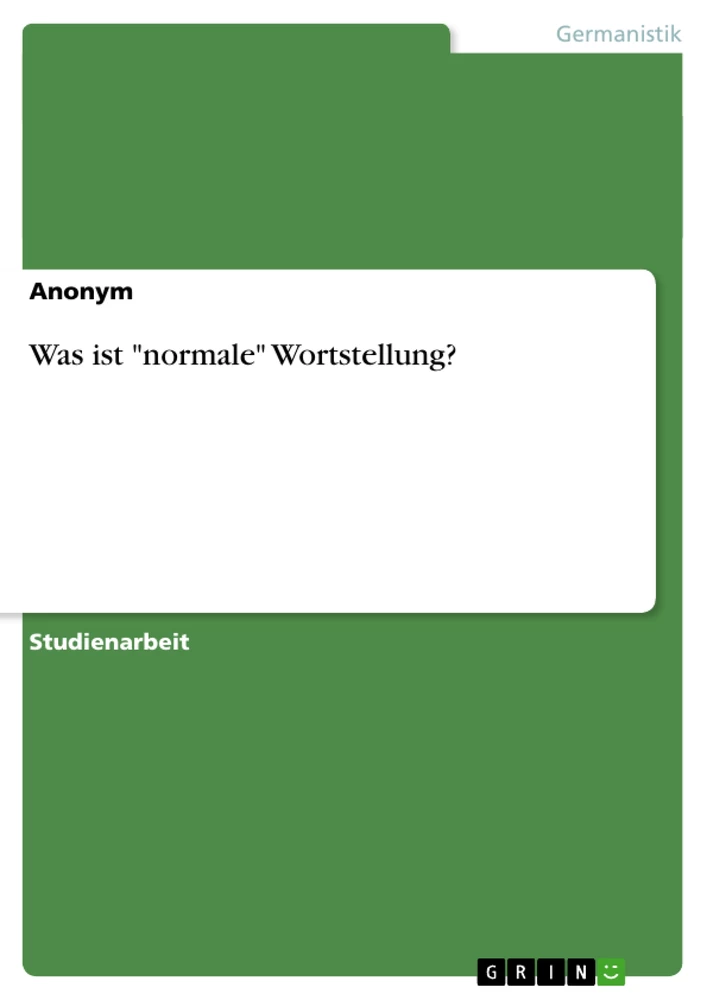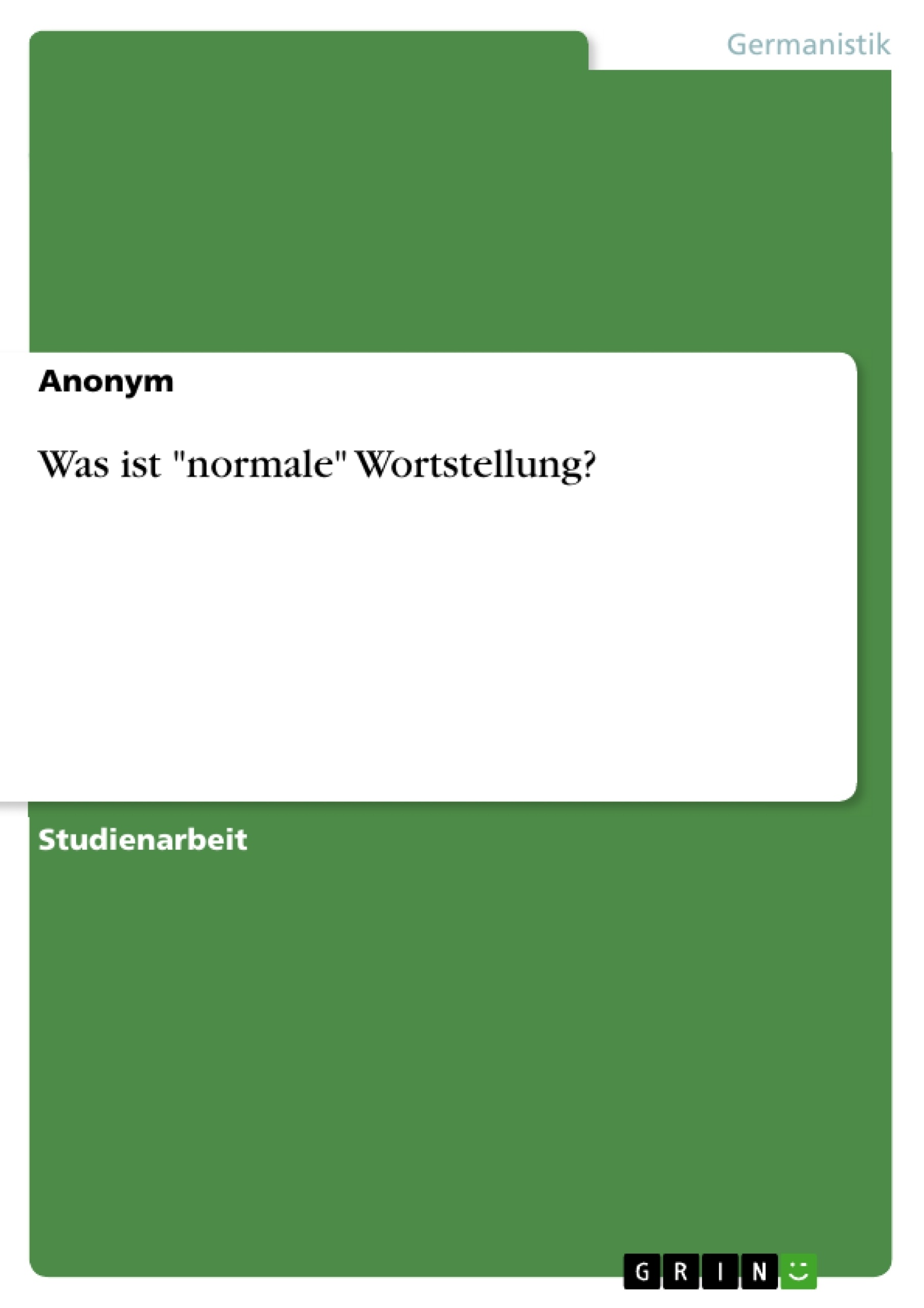In der linguistischen Forschungsliteratur der letzten Jahrzehnte existieren zahlreiche Diskussionen über die Frage, was eine ‚normale Wortstellung‘ in Sätzen ausmacht. Dennoch folgt aus den verschiedenen Forschungsansätzen keine umfassende Lösung des Problems und so betonen auch Altmann/Hofmann (2004: 109-112), dass die Erforschung des Begriffes ein allzeit interessantes Thema sei. Die Frage nach einer‚ normalen Wortstellung‘ im deutschen Satzbau ergibt sich daraus, dass nur einige Konstituenten festen Stellungsregelungen unterliegen, etwa die Prädikatskonstituenten. Im Mittelfeld jedoch ist die Abfolge der Konstituenten verhältnismäßig ungeregelt. Dadurch kann ein Satz verschiedene Wortstellungen und Betonungen im Mittelfeld des Satzes aufweisen und es ergeben sich Wortstellungen, welche markiert sind, also von der‚ normalen Wortstellung‘ abweichen. Worum es sich bei ‚nicht-normalen‘ und‚ normalen
Wortstellungen‘ handelt, muss also notwendigerweise durchblickt werden, um einem Satz eine ‚normale‘ Satzgliedabfolge zuschreiben zu können. In der Forschungsliteratur zu diesem Thema gibt es zwei Ansätze, die sich grundlegend unterscheiden und von Hofmann (1994: 16-23) übersichtlich zusammengefasst werden. Einerseits wird u.a. von Jacobs (1988) angenommen, dass man nicht von einer ‚normalen Wortstellung‘ ausgehen kann und somit auch keine umfassende Definition geliefert werden muss. Andererseits ist u.a. Tilman Höhle (1982) der Ansicht, dass ‚normale Wortstellung‘ mithilfe spezifischer Kriterien und in Abhängigkeit von der Intonation im Satz festgelegt werden kann. Diese Strömung unterscheidet sich wiederum in den pragmatischen und den strukturellen Ansatz. Während Höhle eine pragmatische Definition liefert, geht zum Beispiel Lenerz (1977) von einer strukturellen Definition aus. In dieser Arbeit wird lediglich die pragmatische Herangehensweise von Höhle (1982) eine grundlegende Rolle spielen. Höhle (1982: 76) bringt die ‚normale Wortstellung‘ eines Satzes mit einer ‚normalen Betonung‘ in Verbindung. Sein Anliegen ist es, die Begrifflichkeiten ‚normale Betonung‘ und ‚normale Wortstellung‘ im Hinblick auf ihre sprachwissenschaftliche Relevanz zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick
- Ziel der Arbeit
- Satzstruktur im Deutschen
- Die Topologie des deutschen Satzes
- Stellungsfaktor im Mittelfeld
- ,Normale Betonung' im Deutschen
- Was ist,normale Betonung'?
- Topik und Fokus
- Topik
- Fokus
- Fokusprojektion
- Zusammenhang zwischen Fokus und Betonung
- Wortstellung im Mittelfeld
- Was ist,normale Wortstellung'?
- Der Einfluss,normaler Betonungʻ auf,normale Wortstellung‘
- Zusammenfassung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, das Konzept der „normalen Wortstellung“ mithilfe der Theorie der „normalen Betonung“ zu erklären. Sie basiert auf der These, dass ein Satz eine „normale Wortstellung“ aufweist, wenn seine Betonung normal ist und er in den meisten Kontexten ohne Einschränkungen verwendbar ist.
- Definition des Begriffs „normale Wortstellung“
- Bedeutung der „normalen Betonung“ für die Wortstellung
- Unterscheidung zwischen „struktureller“ und „stilistischer Normalität“
- Analyse des Einflusses von Topik und Fokus auf die Wortstellung
- Zusammenhang zwischen Betonung und Wortstellung im Mittelfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Forschungsliteratur zum Thema „normale Wortstellung“ und beschreibt das Ziel der Arbeit. Kapitel 2 erklärt die grundlegende Satzstruktur des Deutschen und die Bedeutung des Mittelfelds für die Wortstellung. Kapitel 3 behandelt das Konzept der „normalen Betonung“, inklusive der Unterscheidung zwischen Topik und Fokus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen „normale Wortstellung“, „normale Betonung“, „Topik“, „Fokus“, „Fokusprojektion“ und die Unterscheidung zwischen „struktureller“ und „stilistischer Normalität“ im Kontext des Deutschen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer "normalen Wortstellung"?
Eine normale Wortstellung ist eine Satzgliedabfolge, die in den meisten Kontexten ohne Einschränkungen verwendbar ist und mit einer normalen Betonung einhergeht.
Wie hängen Betonung und Wortstellung zusammen?
Nach Tilman Höhle kann die normale Wortstellung mithilfe der normalen Betonung definiert werden; weicht die Betonung ab, gilt die Wortstellung oft als markiert.
Was ist der Unterschied zwischen Topik und Fokus?
Das Topik ist der Teil des Satzes, über den eine Aussage gemacht wird, während der Fokus die neue oder besonders hervorgehobene Information darstellt.
Warum ist das Mittelfeld im deutschen Satz so flexibel?
Im Gegensatz zu den Prädikatskonstituenten unterliegen die Elemente im Mittelfeld weniger festen Regeln, was verschiedene Abfolgen und Betonungen ermöglicht.
Was bedeutet "Fokusprojektion"?
Fokusprojektion beschreibt das Phänomen, dass die Betonung eines einzelnen Elements dazu führen kann, dass eine größere Einheit (z.B. die ganze VP) als im Fokus stehend interpretiert wird.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2007, Was ist "normale" Wortstellung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144789