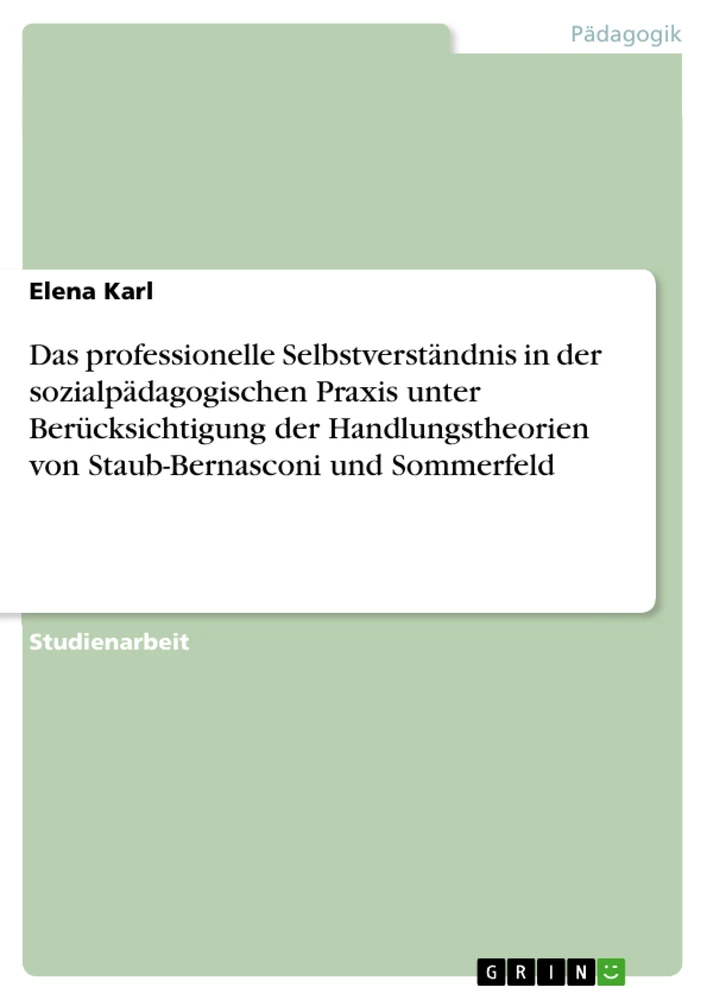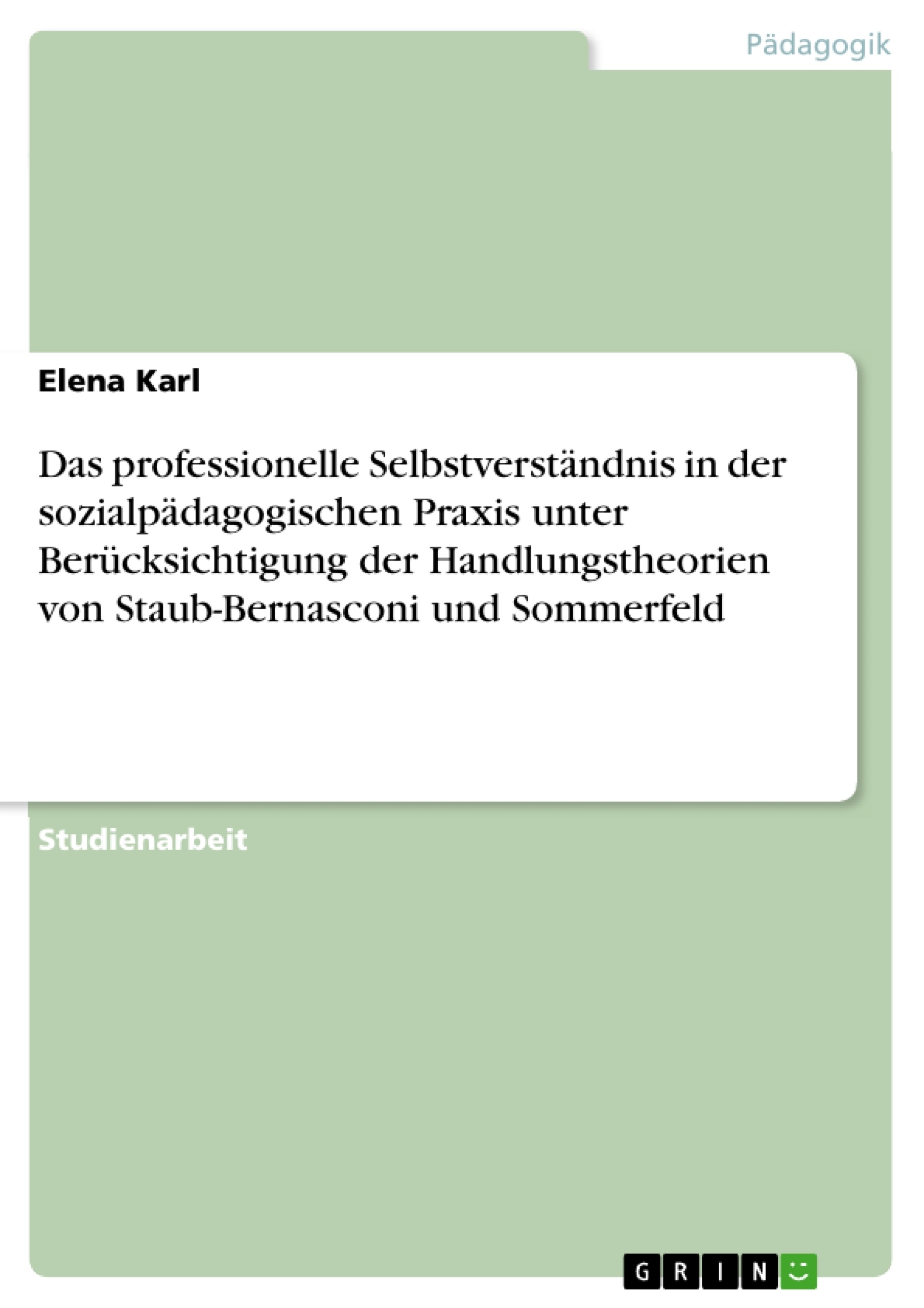Die Beschäftigung mit der Profession Soziale Arbeit und ihrem Auftrag in der Gesellschaft wird als eine komplexe und herausfordernde Aufgabe angesehen. Diese Disziplin, einst aus sozialen Bewegungen entstanden und von einer Vielzahl an Perspektiven und Ansprüchen geprägt, bietet eine facettenreiche Landschaft von Zielsetzungen, Methoden und Herangehensweisen. Trotz ihrer Bedeutung und ihres Einflusses auf das gesellschaftliche Gefüge bleibt die Anerkennung und Wertschätzung der Sozialen Arbeit oft hinter ihren tatsächlichen Erfordernissen zurück.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundlegende Frage nach einem einheitlichen professionellen Selbstverständnis innerhalb der Sozialen Arbeit. Wie sehen sich die Fachkräfte selbst? Welche Werte, Ziele und Handlungskompetenzen prägen ihr berufliches Handeln? Diese Fragen sind von zentraler Bedeutung für die Gestaltung der Praxis und dienen gleichzeitig als Leitfaden für die Ausbildung angehender Fachkräfte.
Die Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses wird als ein fortlaufender Prozess angesehen, der von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt wird, darunter persönliche Dispositionen, theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen. Eine entscheidende Rolle wird dabei auch den theoretischen Grundlagen zugewiesen, die das Verständnis von Sozialer Arbeit maßgeblich beeinflussen.
In dieser Arbeit wird das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte näher beleuchtet, wobei insbesondere auf die Handlungstheorien von Silvia Staub-Bernasconi und Peter Sommerfeld eingegangen wird. Durch einen Vergleich dieser Ansätze soll ein tieferes Verständnis dafür entwickelt werden, wie sich das professionelle Selbstverständnis in der Sozialen Arbeit formt und ausdrückt. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der Gegenstand sozialer Arbeit, das erforderliche Wissen und die professionellen Handlungsweisen betrachtet.
Indem mit diesen Fragen auseinandergesetzt wird, trägt die Arbeit dazu bei, das Selbstverständnis und die berufliche Identität in der Sozialen Arbeit besser zu verstehen und somit auch die Qualität und Effektivität sozialpädagogischer Interventionen zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte
- 2.1 Gegenstand sozialer Arbeit
- 2.2 Wissen und Kompetenz
- 2.3 Habitus und Identität
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten dieses Selbstverständnisses zu beleuchten und den Einfluss theoretischer Konzepte auf die Praxis zu analysieren. Dabei wird insbesondere der Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze im Fokus stehen.
- Professionelles Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte
- Der Gegenstand der Sozialen Arbeit
- Notwendige Wissen und Kompetenzen sozialpädagogischer Fachkräfte
- Einfluss theoretischer Konzepte auf die Praxis
- Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze (z.B. Staub-Bernasconi vs. Sommerfeld)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen bei der Definition Sozialer Arbeit als Profession. Sie hebt die Vielfältigkeit der Zielvorstellungen, Methoden und Auftraggeber hervor und betont die Bedeutung eines klaren professionellen Selbstverständnisses angesichts der oft mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung. Die Autorin kritisiert die andauernde Identitätssuche der Sozialen Arbeit und die fehlende Fokussierung auf Theoriebildung und Wissensbasis. Sie führt aus, dass ein solches Selbstverständnis essentiell für die Praxisgestaltung und die Ausbildung ist und erläutert die Notwendigkeit wissenschaftlich fundierten, ethisch korrekten und menschenrechtskonformen Handelns.
2. Das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Begriff des professionellen Selbstverständnisses und dessen Komplexität. Es wird erläutert, wie das Selbstverständnis das Handeln der Fachkräfte und deren Interaktion mit den Hilfeempfängern beeinflusst, in Bezugnahme auf Normen und Werte. Die Unsicherheit des Selbstbildes der Sozialen Arbeit als Disziplin aufgrund fehlender einheitlicher Definition und Wissensbasis wird diskutiert. Die Bedeutung der Herausbildung einer beruflichen Identität und der Entwicklung eines "Tripelmandats" (Trägerauftrag, Klientenwunsch und ethischer Kodex) für die professionelle Wertordnung wird hervorgehoben. Schließlich werden die konzeptuellen Vorentscheidungen verschiedener Theorien zur Sozialen Arbeit als essentiell für die Herausbildung eines professionellen Selbstverständnisses vorgestellt und ein Vergleich verschiedener Theorien angekündigt.
Schlüsselwörter
Professionelles Selbstverständnis, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Handlungstheorie, Wissensbasis, Kompetenz, Identität, Staub-Bernasconi, Sommerfeld, Integration, Lebensführung, Ethik, Moral, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Professionelles Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Facetten des professionellen Selbstverständnisses und dem Einfluss theoretischer Konzepte auf die Praxis der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Hauptkapitel zum professionellen Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte mit Unterkapiteln zu Gegenstand der Sozialen Arbeit, Wissen und Kompetenz sowie Habitus und Identität, und abschließend ein Fazit.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text zielt darauf ab, das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte zu untersuchen und die verschiedenen Facetten dieses Selbstverständnisses zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Einflusses theoretischer Konzepte auf die Praxis und dem Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind das professionelle Selbstverständnis sozialpädagogischer Fachkräfte, der Gegenstand der Sozialen Arbeit, notwendiges Wissen und Kompetenzen, der Einfluss theoretischer Konzepte auf die Praxis und der Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze (z.B. Staub-Bernasconi vs. Sommerfeld).
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung thematisiert die Herausforderungen bei der Definition Sozialer Arbeit als Profession, die Vielfältigkeit der Zielvorstellungen und Methoden, die Bedeutung eines klaren professionellen Selbstverständnisses und die Notwendigkeit wissenschaftlich fundierten, ethisch korrekten und menschenrechtskonformen Handelns. Kritisiert wird die andauernde Identitätssuche und die fehlende Fokussierung auf Theoriebildung und Wissensbasis.
Worum geht es im Hauptkapitel über das professionelle Selbstverständnis?
Das Hauptkapitel befasst sich mit dem Begriff des professionellen Selbstverständnisses und seiner Komplexität. Es analysiert den Einfluss des Selbstverständnisses auf das Handeln der Fachkräfte und deren Interaktion mit Klienten. Die Unsicherheit des Selbstbildes der Sozialen Arbeit aufgrund fehlender einheitlicher Definition und Wissensbasis wird diskutiert. Die Bedeutung der beruflichen Identität und die Entwicklung eines "Tripelmandats" (Trägerauftrag, Klientenwunsch und ethischer Kodex) werden hervorgehoben. Schließlich werden verschiedene Theorien zur Sozialen Arbeit vorgestellt und ein Vergleich angekündigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Professionelles Selbstverständnis, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Handlungstheorie, Wissensbasis, Kompetenz, Identität, Staub-Bernasconi, Sommerfeld, Integration, Lebensführung, Ethik, Moral, Menschenrechte.
Welche Theorien werden verglichen?
Der Text kündigt einen Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze an, wobei Staub-Bernasconi und Sommerfeld als Beispiele genannt werden.
- Arbeit zitieren
- Elena Karl (Autor:in), 2020, Das professionelle Selbstverständnis in der sozialpädagogischen Praxis unter Berücksichtigung der Handlungstheorien von Staub-Bernasconi und Sommerfeld, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1448904