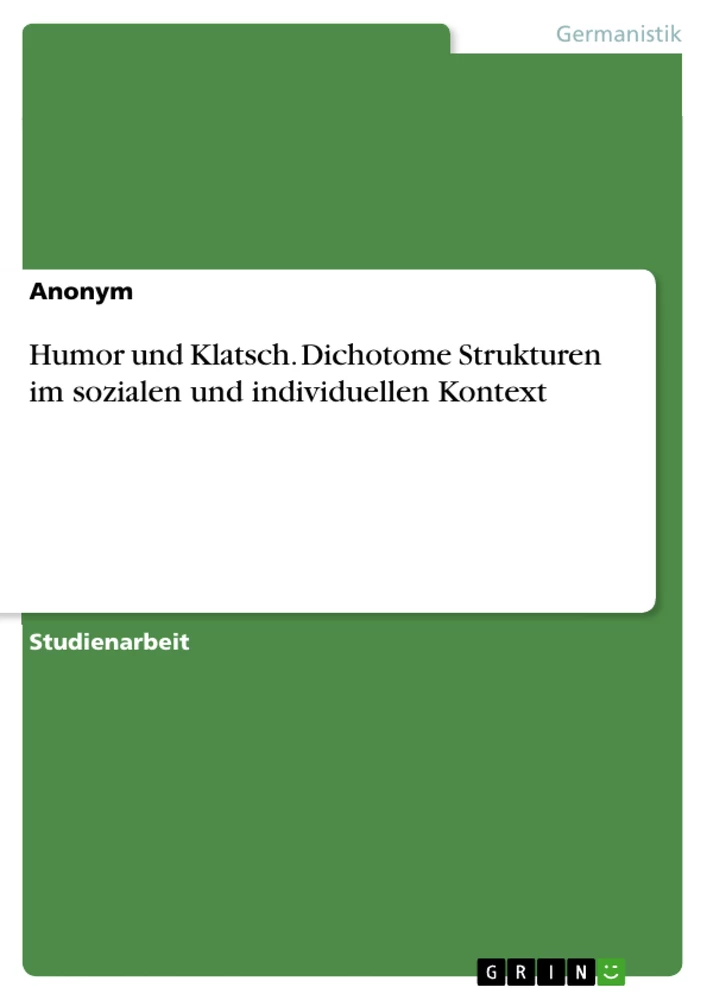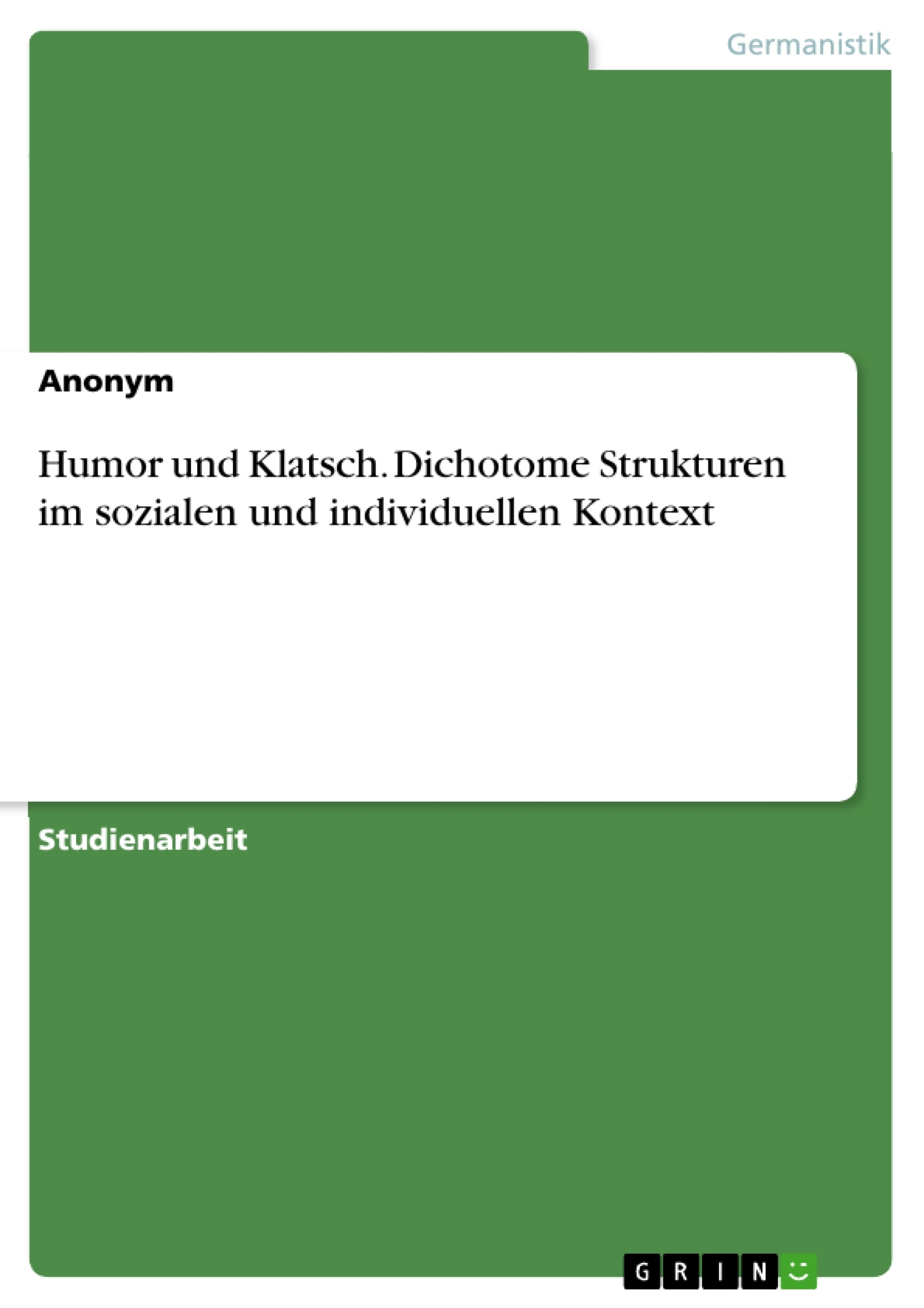In dieser Arbeit sollen die Überschneidungen von Klatsch und Humor hinsichtlich des sozialen und individuellen Kontextes herausgearbeitet werden, um so die Funktionsweise sowie die konstitutiven Bedingungen transparent erscheinen zu lassen.
Dafür wird zunächst der Forschungsstand der linguistischen Humorforschung reflektiert und in die Fragestellung dieser Arbeit eingeordnet sowie eine Begriffsdefinition von Klatsch bemüht. Anschließend werden zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Klatsch und Humor herausgearbeitet, die Aufschluss über konstitutive soziale und individuelle Kontexte, Bedingungen, Funktionsweisen und Effekte geben. Abschließend sollen charakteristische Eigenschaften von Klatsch auf die vier Maxime des Giceschen Kooperationsprinzips angewendet werden, um zu überprüfen, ob – wie bei Humor – Maxime verletzt werden und somit die dichotome Struktur von Klatsch und Humor in einem weiteren Punkt bestärkt wird und ferner die Gegenüberstellung einen legitimen Vorgang darstellt.
Bekanntlich variiert der Sinn für Humor oder für das, was als witzig empfunden wird, stark. So finden Kinder meist andere Witze lustig als Erwachsene. Auch interkulturell oder durch unterschiedliche religiöse Überzeugungen können Witze oder Humor vollkommen anders interpretiert werden, wie es bspw. die drastischen Reaktionen bzgl. der Karikaturen der französischen Satirezeitschrift ‚Charlie Hebdo‘ zeigen.
Es scheint also ein gewisser sozialer Kontext sowie die individuelle Konstitution einer Person in entscheidendem Maße dazu beizutragen, was als witzig empfunden wird und was nicht.
Hinsichtlich des sozialen Kontextes verweist Tony Veale auf Parallelen zwischen Humor und Klatschkonversationen, führt diese Überlegungen jedoch noch nicht differenziert genug aus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Humor und Klatsch
- Reflexive Betrachtung linguistischer Humorforschung
- Begriffsdefinition Klatsch
- Dichotome Strukturen von Humor und Klatsch
- Zentrale Unterscheidungskriterien
- Gesellschaftliche Resonanz
- Genese
- Sozialer Kontext
- Individueller und emotionaler Kontext
- Grices Kooperationsprinzip und Klatsch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Überschneidungen von Klatsch und Humor hinsichtlich des sozialen und individuellen Kontextes, um deren Funktionsweise und konstitutive Bedingungen transparent zu machen. Dabei wird der Forschungsstand der linguistischen Humorforschung reflektiert und in die Fragestellung der Arbeit eingeordnet. Weiterhin wird eine Begriffsdefinition von Klatsch herangezogen.
- Zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Klatsch und Humor
- Konstitutive soziale und individuelle Kontexte, Bedingungen und Funktionsweisen
- Effekte von Klatsch und Humor
- Anwendung der Maxime des Giceschen Kooperationsprinzips auf charakteristische Eigenschaften von Klatsch
- Bestätigung der dichotomen Struktur von Klatsch und Humor
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt fest, dass neben der offensichtlichen Lustgewinnung weitere Faktoren für die Entstehung von Humor verantwortlich sind, da der Sinn für Humor stark variiert. Der soziale Kontext und die individuelle Konstitution einer Person beeinflussen maßgeblich, was als witzig empfunden wird.
Humor und Klatsch
Reflexive Betrachtung linguistischer Humorforschung
Die Kapitel erläutert zentrale Erklärungsmodelle für die Entstehung von Humor, wie z.B. Inkongruenz, Degradation/Aggression und Entspannung. Es werden Analysemodelle wie die SSTH und die GTVH diskutiert und deren Grenzen aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer kontextbezogenen Analyse von Humor und die Relevanz der Griceschen Theorie konversationaler Implikaturen werden hervorgehoben.
Begriffsdefinition Klatsch
Das Kapitel definiert Klatsch als indiskreten Informationsaustausch über eine oder mehrere dritte Parteien in deren Abwesenheit. Es werden die Bewertungen von Handlungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften von Mitmenschen sowie die negative Konnotation von Klatsch in den meisten Gesellschaften beleuchtet. Die Bedeutung des sozialen Kontextes und der Klatschtriade (Klatschproduzierende, Klatschrezipierende und Objekte) wird betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Humor und Klatsch, deren soziale und individuelle Kontexte, die Gricesche Theorie konversationaler Implikaturen, zentrale Unterscheidungskriterien, gesellschaftliche Resonanz, Genese, sozialer Kontext, individueller und emotionaler Kontext, sowie die Klatschtriade.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Humor und Klatsch. Dichotome Strukturen im sozialen und individuellen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1449039