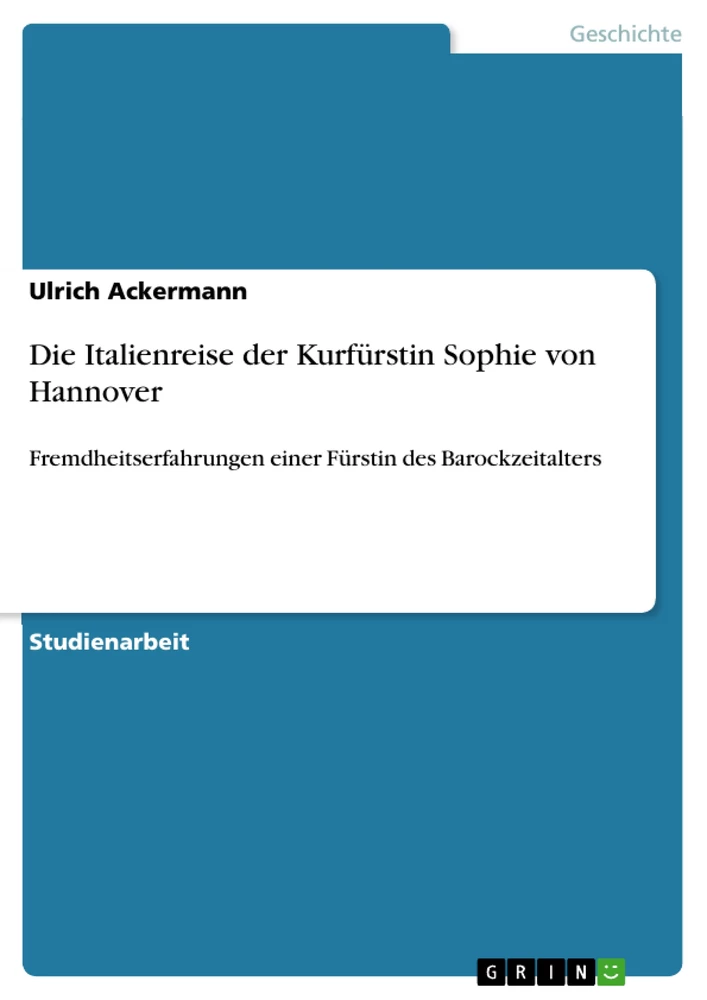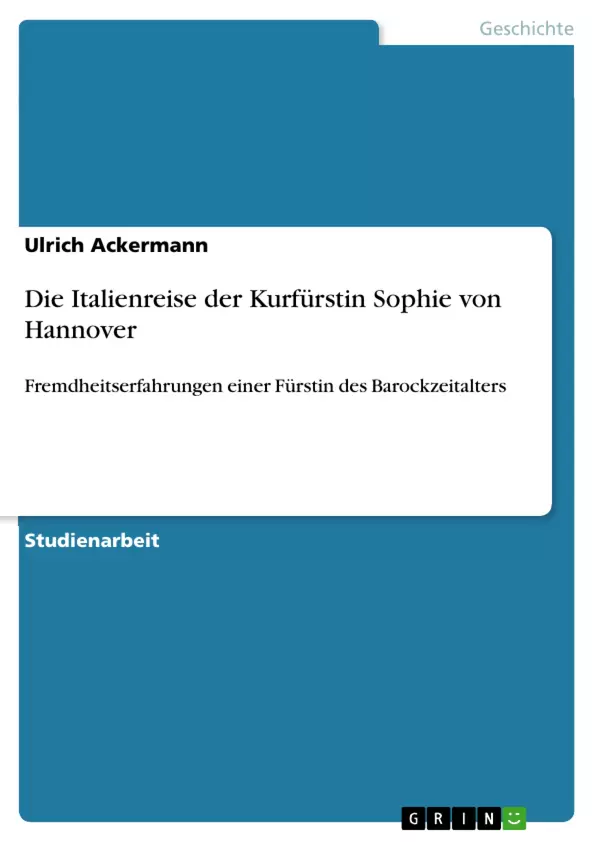In dieser Arbeit soll am Beispiel der Auslandsreise der Herzogin Sophie von Hannover nach Italien 1664/65, das typische Leben einer höhergestellten, aristokratischen Fürstin im absolutistischen Barockzeitalter dargestellt werden.
So möchte ich an einigen Beispielen aus von ihr gemachten Beobachtungen, z.B. die Rolle der Frau unter Berücksichtigung der spezifischen ständischen Bedingungen, dem Umfeld des europäischen Hochadels, näher beleuchtet werden. Hierfür werden unterschiedliche Aspekte wie höfische Zeremonien, das fürstliche Eheverständnis, Erziehung oder machtpolitische Zusammenhänge an der Spitze der absolutistischen Ständegesellschaft untersucht. Hierbei soll auf die damalige Verteilung der Geschlechterrollen im vorgegebenen Kontext, und den damals üblichen, standesbedingten, demonstrativen Konsum von Luxusgütern eingegangen werden.
Unter der besonderen Berücksichtigung, dass es sich bei der Reise um eine Frauenreise handelt, versuche ich die Aspekte zu analysieren, die unter Sophies ganz persönlichem Eindruck als reisende Ehegattin eines absolutistischen Fürsten, als ‚merkwürdig’ festgehalten wurden.
Auf die Reise soll im Gesamtkontext von Sophies Biographie eingegangen werden. Die Auslöser für das schriftliches Festhalten ihrer Erlebnisse in der Fremde sollen begutachtet werden, wobei die der Untersuchung zu Grunde liegenden Quellen näher beurteilt werden sollen.
Auch die rein ‚technischen’ Aspekte wie der im Einzelnen zu nennende Reiseanlass, die Reiseroute, die Wahl der Unterkünfte und ähnliches versuche ich in den Gesamtzusammen-hang mit einfließen zu lassen.
Einleitend soll beschrieben werden, wer Sophie von Hannover überhaupt war, und welche Rolle sie auf dem damaligen ‚internationalen Parkett des europäischen Hofadels’ spielte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Wer war Sophie von Hannover? Biographische Eckdaten im Leben einer Kurfürstin des Barockzeitalters
- 2. zur Quellenlage: Sophie von Hannovers Memoiren
- 2.1.1. zur Textgattung
- 2.1.2. Anteil der Reisebeschreibungen an den Gesamtmemoiren
- 3. Die Italienreise 1664/65
- 3.1. Reiseanlass
- 3.2. Reiseroute und Strapazen
- 3.3. Eine „Inkognito-Reise“
- 3.4. Unterkunft
- 3.5. Kunst und Kultur
- 3.6. Kuriositäten
- 3.7. Landschaft, Klima und Gesundheit
- 3.8. Gesellschaft
- 3.9. Religion
- 3.10. Mentalität
- III. Zusammenfassung
- IV. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Leben einer höhergestellten Aristokratin im absolutistischen Barockzeitalter anhand der Italienreise der Herzogin Sophie von Hannover in den Jahren 1664/65. Anhand ihrer Beobachtungen werden Aspekte wie die Rolle der Frau im europäischen Hochadel, höfische Zeremonien, das fürstliche Eheverständnis, Erziehung und machtpolitische Zusammenhänge beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Perspektive Sophies als reisende Ehegattin eines absolutistischen Fürsten.
- Die Rolle der Frau im europäischen Hochadel des 17. Jahrhunderts
- Das Leben und die Erfahrungen einer Kurfürstin im Barockzeitalter
- Analyse der Memoiren der Herzogin Sophie von Hannover als Quelle
- Die Italienreise als Spiegel der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse
- Aspekte des demonstrativen Konsums von Luxusgütern im Kontext des Standes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, das typische Leben einer höhergestellten, aristokratischen Fürstin im absolutistischen Barockzeitalter anhand der Italienreise der Herzogin Sophie von Hannover (1664/65) darzustellen. Es wird angekündigt, dass verschiedene Aspekte wie die Rolle der Frau, höfische Zeremonien, das fürstliche Eheverständnis und machtpolitische Zusammenhänge untersucht werden. Die Reise wird im Kontext von Sophies Biographie betrachtet, und die Quellenlage wird kurz angesprochen. Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit vor.
II.1. Wer war Sophie von Hannover? Biographische Eckdaten im Leben einer Kurfürstin des Barockzeitalters: Dieses Kapitel skizziert die Biographie der Herzogin Sophie von Hannover, von ihrer Geburt in Den Haag bis zum Tod ihres Ehemannes. Es werden wichtige Stationen ihres Lebens hervorgehoben, wie ihre Kindheit, ihre Heirat mit Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, die Geburt ihrer Kinder und ihre Rolle am Hof. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Privilegien ihres Lebens als hochrangige Adlige im absolutistischen Kontext. Es wird auf ihre Memoiren als Quelle verwiesen und Zitate eingefügt, um ihre persönliche Sichtweise zu illustrieren. Die Ereignisse werden chronologisch dargestellt und bieten einen umfassenden Überblick über Sophies Leben vor und während ihrer Italienreise.
Schlüsselwörter
Sophie von Hannover, Italienreise, Barockzeitalter, Absolutismus, Memoiren, Frauenrolle, Hochadel, höfische Kultur, Reisebericht, demonstrativer Konsum.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Sophie von Hannovers Italienreise 1664/65"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Leben der Herzogin Sophie von Hannover im 17. Jahrhundert, insbesondere ihre Italienreise von 1664/65. Anhand ihrer Memoiren werden die Rolle der Frau im europäischen Hochadel, höfische Zeremonien, das fürstliche Eheverständnis, Erziehung und machtpolitische Zusammenhänge analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf Sophies Perspektive als reisende Ehefrau eines absolutistischen Fürsten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist die Italienreisebeschreibung der Herzogin Sophie von Hannover in ihren Memoiren. Die Arbeit analysiert die Memoiren hinsichtlich ihrer Textgattung und ihren Anteil an den Gesamtmemoiren. Die Arbeit beschreibt die Quellenlage und den methodischen Ansatz der Analyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Rolle der Frau im europäischen Hochadel des 17. Jahrhunderts; das Leben und die Erfahrungen einer Kurfürstin im Barockzeitalter; die Analyse der Memoiren der Herzogin Sophie von Hannover als Quelle; die Italienreise als Spiegel der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse; Aspekte des demonstrativen Konsums von Luxusgütern im Kontext des Standes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert: Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung und Literaturangaben. Der Hauptteil befasst sich mit der Biographie Sophie von Hannovers, einer detaillierten Analyse der Italienreise (Reiseanlass, Reiseroute, Unterkunft, Kunst und Kultur, Kuriositäten, Landschaft, Klima, Gesundheit, Gesellschaft, Religion und Mentalität) und der Einordnung der Reise in den historischen Kontext.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert Einblicke in das Leben einer hochrangigen Aristokratin im absolutistischen Barockzeitalter. Sie analysiert die Italienreise als einen Spiegel der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und beleuchtet die Rolle der Frau im europäischen Hochadel aus der Perspektive der Herzogin Sophie von Hannover. Die gewonnenen Erkenntnisse basieren auf der detaillierten Analyse ihrer Memoiren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sophie von Hannover, Italienreise, Barockzeitalter, Absolutismus, Memoiren, Frauenrolle, Hochadel, höfische Kultur, Reisebericht, demonstrativer Konsum.
Welche Aspekte der Italienreise werden im Detail untersucht?
Die Italienreise wird umfassend untersucht, einschliesslich des Reiseanlasses, der Reiseroute und Strapazen, der Reise als "Inkognito-Reise", der Unterkunft, Kunst und Kultur, Kuriositäten, Landschaft, Klima und Gesundheit, der Gesellschaft, Religion und der Mentalität der Zeit.
Wie wird die Biographie Sophie von Hannovers dargestellt?
Die Biographie Sophie von Hannovers wird von ihrer Geburt bis zum Tod ihres Ehemannes chronologisch dargestellt. Wichtige Stationen ihres Lebens, Herausforderungen und Privilegien ihres Lebens als hochrangige Adlige werden beleuchtet. Die Darstellung stützt sich auf ihre Memoiren und bietet einen umfassenden Überblick über ihr Leben vor und während ihrer Italienreise.
- Citation du texte
- Ulrich Ackermann (Auteur), 2004, Die Italienreise der Kurfürstin Sophie von Hannover, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144968