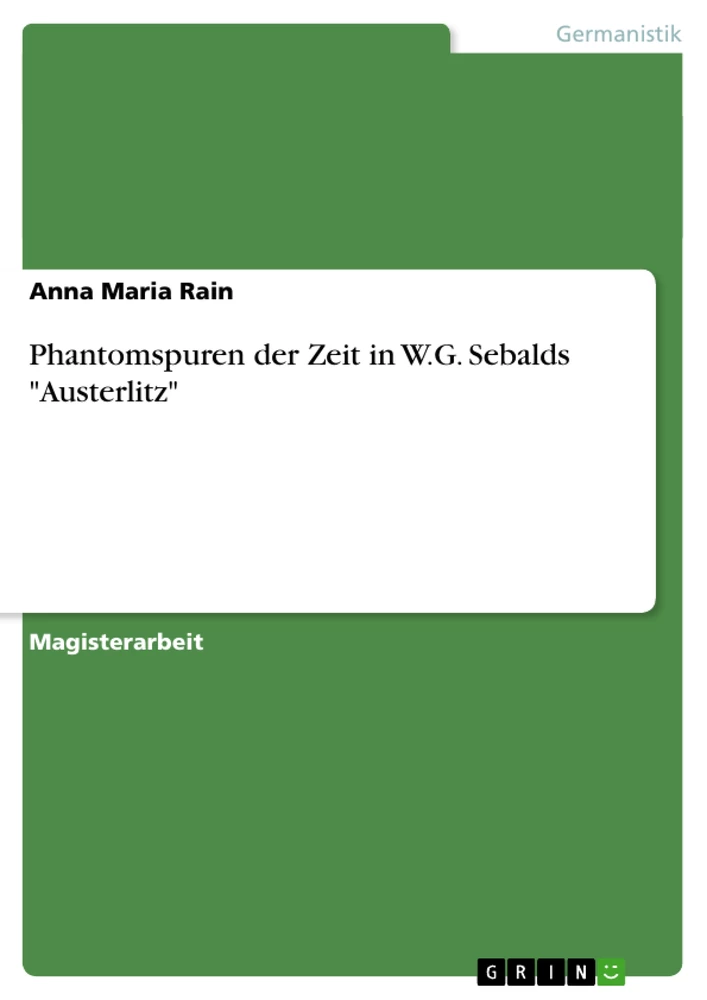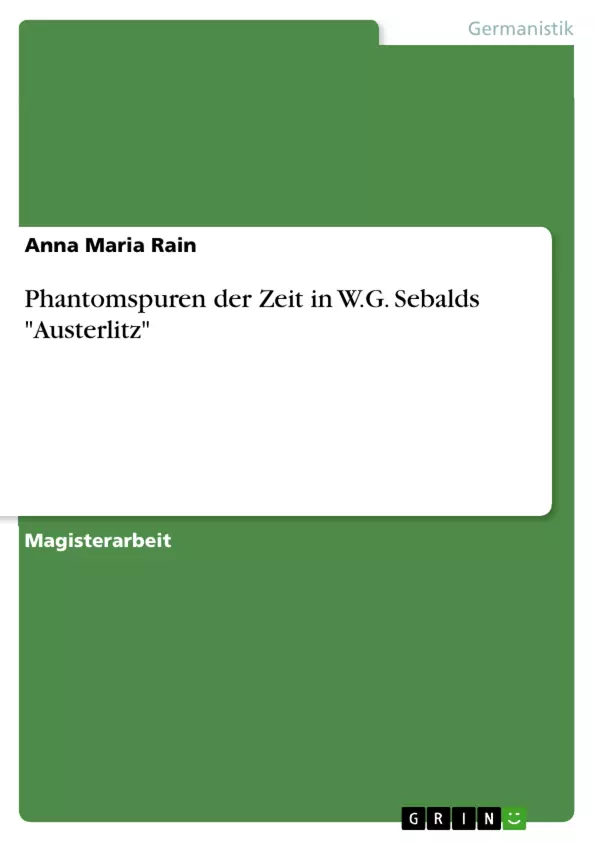1 Einleitung
But these are the memories of an adult. Curiously enough, the events are remembered
and seem to have been experienced in a way that was far beyond
the normal capacity for recall in a young child of my age. It is as though this
process of witnessing is of an event that happened on another level, and was
not part of the mainstream of the conscious life of a little boy.1
Im dritten Kapitel von Testimony2 schlägt Dori Laub vor, den Holocaust als ein Ereignis zu
betrachten, das die Bedingung der Möglichkeit von Zeugenschaft (und also Zeugenschaft
selbst) zu eliminieren suchte. Dies geschah nicht nur durch die programmatische Ermordung
der Zeugen der Verbrechen, sondern zuallererst durch die „inhärent nicht-assimilierbare
Struktur des Erlebnisses bei den Überlebenden“,3 die jegliche Zeugenschaft von vornherein
ausschloss. Die schiere Anwesenheit in einem Geschehen wie dem Holocaust hob die Möglichkeit
von Zeugenschaft augenblicklich auf,4 wie dies für schwere Traumen mit anschließender
Amnesie allgemein gilt. Aber: „the ‘not telling’ of the story serves as a perpetuation of its
tyranny.“5
Damit sind die Schwierigkeiten des Erzählens dieser Geschichte und ihrer (gegebenenfalls)
literarischen Vermittlung schon angedeutet: Es soll etwas erzählt oder geschrieben werden,
das im Grunde nicht gewusst werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Konzepte von Zeit
- Die grausame Gottheit Zeit und die Metaphysik der Geschichte
- Eine Topografie der Zeit: Bahnhöfe
- Leben in einem anderen (Zeit-) Modus
- Zwischenbetrachtung
- Familienähnlichkeiten
- Sprache und Wissen
- Architektur
- Zwei Beispiele: Das Eichhörnchen und das Archiv
- Das Gedächtnis der Dinge – das Eichhörnchen, „veverka“
- Die Bibliothèque Nationale
- Medien der Erinnerung – Fotografie und Film
- Fotografien
- Film
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert W. G. Sebalds Roman Austerlitz mit dem Fokus auf das Trauma des Protagonisten und dessen Auswirkungen auf seine Erinnerung und Identität. Die Arbeit untersucht, wie sich das Trauma durch "Phantomspuren" in Austerlitz' Leben manifestiert und in welcher Weise Zeit als zentrales Element die Interaktion mit der Vergangenheit beeinflusst.
- Konzepte von Zeit und Trauma in der Literatur
- Die Rolle des Holocaust als prägendes Trauma
- Die Auswirkungen des Traumas auf Erinnerung und Identität
- Die Funktion von Architektur und Medien in der Darstellung des Traumas
- Die Bedeutung von "Phantomspuren" für die Rekonstruktion der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es klassische und moderne Traumatheorien vorstellt und die Bedeutung des Holocaust im Kontext des Romans Austerlitz diskutiert. Kapitel zwei analysiert verschiedene Konzepte von Zeit in Austerlitz und untersucht, wie Zeit als ein dominantes Element die Erfahrungen des Protagonisten beeinflusst. Kapitel drei befasst sich mit dem Einfluss des Traumas auf das Gedächtnis und die Identität von Austerlitz und analysiert, wie sich diese Themen in der Architektur und den Medien des Romans widerspiegeln. In Kapitel vier werden verschiedene Beispiele aus dem Roman untersucht, um die Rolle von "Phantomspuren" als Beweis für die Präsenz des Traumas und die Verzerrung der Wahrnehmung zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Trauma, Erinnerung, Zeit, Identität, Holocaust, Architektur, Medien, "Phantomspuren", Literaturwissenschaft, W. G. Sebald und Austerlitz. Sie analysiert die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext des Romans und untersucht, wie sich diese Themen in der Literatur niederschlagen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Phantomspuren“ in Sebalds Austerlitz?
Es sind unbewusste Erinnerungsfragmente oder traumatische Reste, die sich in der Wahrnehmung des Protagonisten manifestieren, ohne dass er sie zunächst einordnen kann.
Welche Rolle spielt das Trauma des Holocaust im Roman?
Der Holocaust wird als Ereignis dargestellt, das die Zeugenschaft verunmöglichte und bei Überlebenden wie Austerlitz zu einer tiefen Amnesie und Identitätskrise führte.
Wie wird Zeit in Austerlitz thematisiert?
Zeit wird nicht linear, sondern topografisch (z.B. durch Bahnhöfe) und als „grausame Gottheit“ dargestellt, die das Leben in verschiedenen Modi überlagert.
Welche Funktion haben Medien wie Fotografie und Film?
Sie dienen als Medien der Erinnerung, die versuchen, das Unaussprechliche festzuhalten, aber oft auch die Brüchigkeit der Rekonstruktion von Vergangenheit zeigen.
Warum ist Architektur in Sebalds Werk so bedeutend?
Gebäude wie Bahnhöfe oder die Bibliothèque Nationale fungieren als steinerne Gedächtnisorte, die historische Schichten und traumatische Geschichte bewahren.
- Quote paper
- Anna Maria Rain (Author), 2008, Phantomspuren der Zeit in W.G. Sebalds "Austerlitz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145187