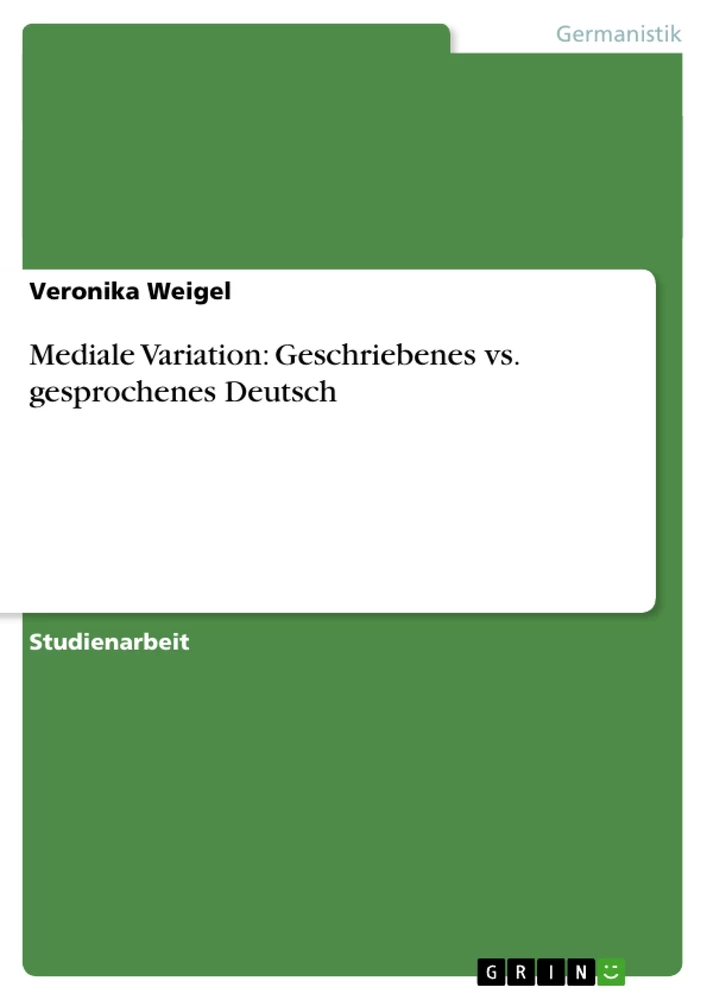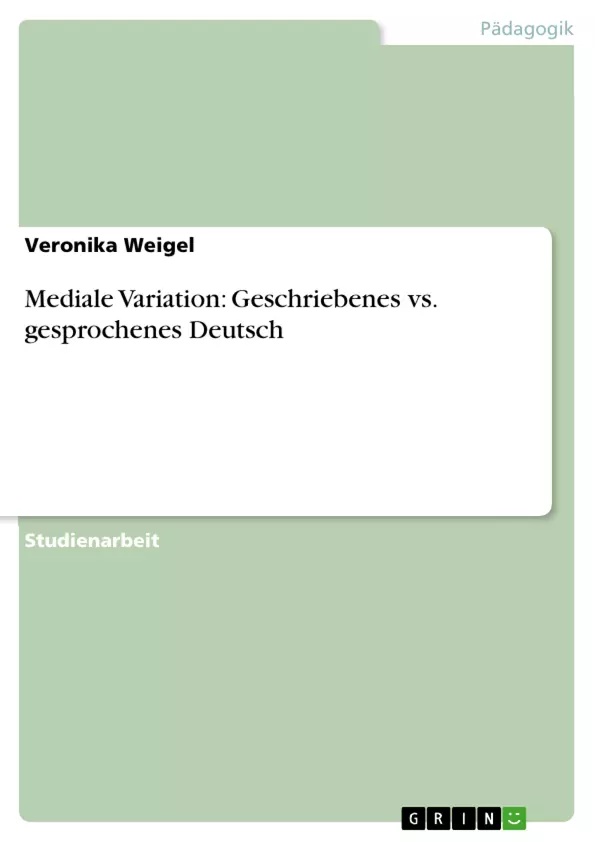Die Verständigung in einer Sprache zwischen Sender und Empfänger kann mündlich als auch schriftlich erfolgen. Vorraussetzung für die schriftliche Verständigung in einer Sprache ist aber, dass die Sprache auch eine Schrift besitzt. Dementsprechend ist eine Sprache einerseits eine gesprochene Sprache und als Lautsprache sozusagen ein akusti-sches Phänomen bekannt und andererseits ist die Sprache eine geschriebene Sprache und damit auch ein visuelles Phänomen. Bezieht man sich auf die Dauer der Sprache, wird alleine zwischen dem Akustischem und Visuellem ein Unterschied sichtbar. So dauert die akustische Sprache nur so lange wie ihre Schallwelle, wogegen die visuelle Sprache die Eigenschaft besitzt der Sprache eine sehr lange Dauer zu verleihen und diese auch räumlich zu verbreiten.
In der nachstehenden Arbeit werde ich die mediale Variation zwischen gesprochenen und geschriebenen Deutsch darstellen. Demnach setze ich mich zunächst mit den Grundsätzlichen Unterschieden der beiden Begriffe auseinander und gehe danach auf einzelne wichtige Aspekte ein, die den Unterschied und Vergleich differenzierter beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schriftlichkeit und Mündlichkeit
- 2.1 Medium der Sprache
- 2.2 Konzeption der Sprache
- 3. Grundlegende Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache
- 3.1 Grundlegende Charakteristika gesprochener Sprache vs. geschriebener Sprache
- 3.2 Das Arbeitsgedächtnis
- 3.3 Die Anwesenheit von Sprecher und Hörer
- 3.4 Variabilität und Normiertheit der Sprache
- 4. Eigenschaften geschriebener und gesprochener Sprache
- 4.1 Textuelle und pragmatische Ebene
- 4.2 Syntaktische Ebene
- 4.3 Lexikalische Ebene
- 4.4 Phonetische Ebene
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mediale Variation zwischen geschriebenem und gesprochenem Deutsch. Das Hauptziel ist es, die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Sprachformen herauszuarbeiten und wichtige Aspekte zu beleuchten, die einen differenzierten Vergleich ermöglichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der sprachlichen Mittel und Kommunikationsstrukturen, die für die jeweilige Sprachform charakteristisch sind.
- Unterschiede zwischen dem Medium der sprachlichen Realisierung (phonisch vs. graphisch)
- Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit und ihre Auswirkungen auf die sprachliche Gestaltung
- Analyse grundlegender Charakteristika gesprochener und geschriebener Sprache
- Vergleich der sprachlichen Ebenen (syntaktisch, lexikalisch, phonetisch)
- Der Einfluss von Faktoren wie Arbeitsgedächtnis, Anwesenheit der Kommunikationspartner und Variabilität der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der medialen Variation zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch ein. Sie hebt die grundlegende Unterscheidung zwischen der akustischen und visuellen Natur der Sprache hervor und kündigt die nachfolgende Auseinandersetzung mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Formen an. Die Arbeit positioniert sich als Analyse der medialen Variation, welche die folgenden Kapitel detailliert untersuchen werden.
2. Schriftlichkeit und Mündlichkeit: Dieses Kapitel differenziert zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, indem es die Unterscheidung in das Medium der sprachlichen Realisierung (phonisch, graphisch, gestisch) und die prägende Konzeption der Äußerung einführt. Es beleuchtet den Austausch der Medien (mündlich zu schriftlich und umgekehrt) und die Beziehung zwischen Schreiber/Sprecher und Leser/Hörer. Das Kapitel hebt die Bedeutung der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit für die sprachliche Variation hervor, betont die prinzipielle Unabhängigkeit von Medium und Konzeption und skizziert die wichtigsten Parameter für konzeptionell mündliche und schriftliche Kommunikation.
3. Grundlegende Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der grundlegenden Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Es untersucht charakteristische Merkmale beider Formen, die Rolle des Arbeitsgedächtnisses, den Einfluss der Anwesenheit von Sprecher und Hörer, sowie Aspekte der Variabilität und Normiertheit der Sprache. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung relevanter Aspekte, um die spezifischen Eigenheiten der beiden Kommunikationsformen herauszustellen und zu vergleichen. Die Analyse der verschiedenen Parameter veranschaulicht, wie die verschiedenen kommunikativen Situationen die Gestaltung der Sprache beeinflussen.
4. Eigenschaften geschriebener und gesprochener Sprache: Dieses Kapitel untersucht detailliert die Eigenschaften gesprochener und geschriebener Sprache auf verschiedenen sprachlichen Ebenen: der textuell-pragmatischen, syntaktischen, lexikalischen und phonetischen Ebene. Es vergleicht die jeweiligen Charakteristika, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Sprachformen zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis der medialen Variation zu vermitteln. Der Kapitel analysiert, wie sich die Wahl der Sprachebene auf den Stil und die Bedeutung der Aussage auswirkt.
Schlüsselwörter
Mediale Variation, gesprochenes Deutsch, geschriebenes Deutsch, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprachmedium, Konzeptionelle Mündlichkeit, Konzeptionelle Schriftlichkeit, Kommunikationssituation, Arbeitsgedächtnis, Sprachliche Ebenen (syntaktisch, lexikalisch, phonetisch), Variabilität, Normiertheit.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Mediale Variation zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die mediale Variation zwischen gesprochenem und geschriebenem Deutsch. Ihr Hauptziel ist es, die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachformen herauszuarbeiten und wichtige Aspekte zu beleuchten, die einen differenzierten Vergleich ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Analyse der sprachlichen Mittel und Kommunikationsstrukturen, die für die jeweilige Sprachform charakteristisch sind.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Unterschiede im Medium der sprachlichen Realisierung (phonisch vs. graphisch), konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit und deren Auswirkungen auf die sprachliche Gestaltung, Analyse grundlegender Charakteristika gesprochener und geschriebener Sprache, Vergleich der sprachlichen Ebenen (syntaktisch, lexikalisch, phonetisch) und den Einfluss von Faktoren wie Arbeitsgedächtnis, Anwesenheit der Kommunikationspartner und Variabilität der Sprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus folgenden Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema und die grundlegende Unterscheidung zwischen akustischer und visueller Natur der Sprache. Kapitel 2 (Schriftlichkeit und Mündlichkeit): Differenzierung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit anhand des Mediums der sprachlichen Realisierung und der prägenden Konzeption der Äußerung. Behandlung des Austauschs der Medien und der Beziehung zwischen Schreiber/Sprecher und Leser/Hörer. Kapitel 3 (Grundlegende Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache): Vertiefte Analyse der grundlegenden Unterschiede, einschließlich der Rolle des Arbeitsgedächtnisses, des Einflusses der Anwesenheit von Sprecher und Hörer, sowie Aspekte der Variabilität und Normiertheit. Kapitel 4 (Eigenschaften geschriebener und gesprochener Sprache): Detaillierte Untersuchung der Eigenschaften auf verschiedenen sprachlichen Ebenen (textuell-pragmatisch, syntaktisch, lexikalisch, phonetisch) und Vergleich der Charakteristika. Kapitel 5 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse. Kapitel 6 (Literaturverzeichnis): Auflistung der verwendeten Literatur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mediale Variation, gesprochenes Deutsch, geschriebenes Deutsch, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprachmedium, Konzeptionelle Mündlichkeit, Konzeptionelle Schriftlichkeit, Kommunikationssituation, Arbeitsgedächtnis, Sprachliche Ebenen (syntaktisch, lexikalisch, phonetisch), Variabilität, Normiertheit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und einem Literaturverzeichnis. Dies ermöglicht eine strukturierte und übersichtliche Darstellung der Thematik.
- Arbeit zitieren
- Veronika Weigel (Autor:in), 2007, Mediale Variation: Geschriebenes vs. gesprochenes Deutsch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145236