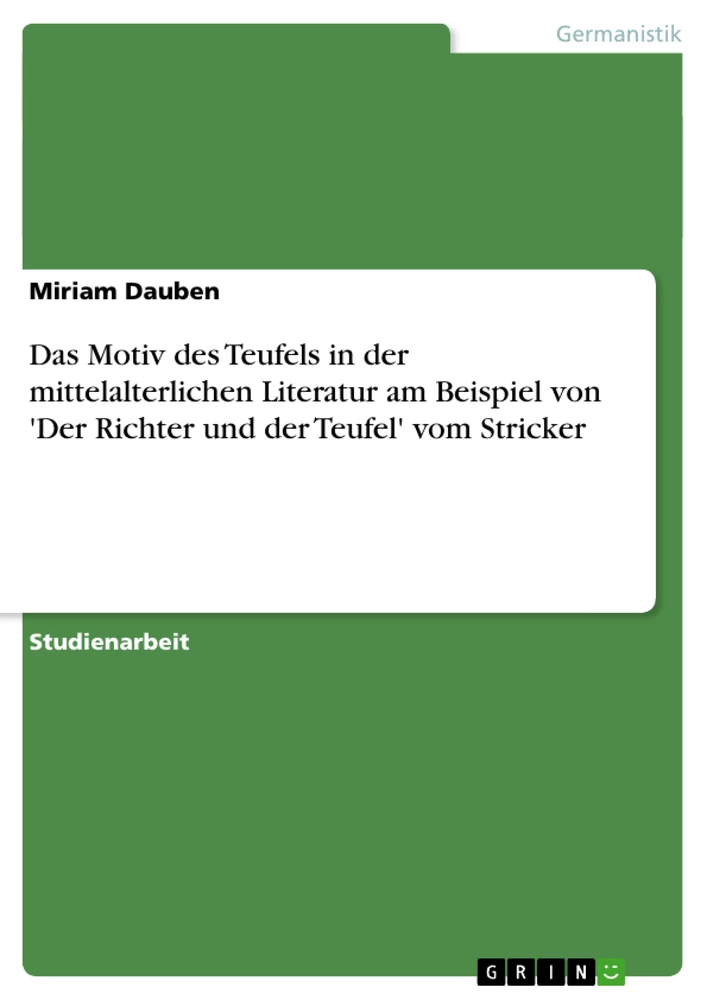1. Einleitung
Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich anhand der Stricker-Märe ‚Der Richter und der Teufel’ das Motiv des Teufels in der mittelalterlichen Literatur darstellen. Der Schwerpunkt soll daher auf der Konzeption des Teufels liegen, doch vor dem Hintergrund der Märe ‚Der Richter und der Teufel’ ist es unabdingbar auch auf die ungewöhnliche Gestaltung der Richterfigur einzugehen. Um erklären zu können, weshalb der Stricker den beiden genannten Figuren ihre spezifischen Züge verliehen hat, werde mithilfe der Werke ‚Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter’ von Julius Wilhelm von Planck und ‚Höfische Kultur’ von Joachim Bumke; insbesondere das Kapitel ‚Recht’; die Verknüpfung von Rechtsprechung und Theologie im Mittelalter darstellen und erläutern welche Anforderungen an den mittelalterlichen Richter gestellt wurden und diese schließlich mit dem tatsächlichen Verhalten des Richters in der Märe vergleichen. Da die Literatur einer bestimmten Zeit diese immer in einem gewissen Maße widerspiegelt, sei es bezogen auf das Motiv oder die Struktur des Textes, ist es für das Verständnis des Textes und dessen Interpretation unerlässlich die Umstände zu kennen, die den Autor, in diesem Fall also den Stricker, bei seinem Werk beeinflusst haben. Daher werde ich einen kurzen Überblick über die für die Interpretation bedeutsamen Ereignisse während des 13. Jahrhunderts, also der Schaffensperiode des Strickers, geben. In diesem Kontext drängt sich auch die Frage auf, warum die Vorstellung der Hölle und des Teufels gerade im Mittelalter ihren Höhepunkt erreicht. Um diese Frage klären zu können, werde ich auf die historischen Gründe für die Entstehung von Höllenvisionen und den Glauben an den Teufel eingehen. [...]Für die Untersuchung eines Motivs ist es außerdem wichtig die Ent-wicklung der Stoffgeschichte zu betrachten. Dazu werde ich mich sowohl des Textes als auch insbesondere des Kommentars von Lutz Röhrich in seinem Werk ‚Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiterleben in Literatur und Volksdichtung bis zur Gegenwart’ bedienen. Den mittelhochdeutschen Text mit neuhochdeutscher Ü-bersetzung entnehme ich ‚Erzählungen, Fabeln, Reden’ vom Stricker, werde ihn mit Hilfe des ‚Mittelhochdeutschen Taschenwörterbuchs’ von Matthias Lexer analysieren und ihn im Rahmen meiner Interpretation mit den Ergebnissen der bereits vorgestellten Punkte verknüpfen, um abschließend ein Fazit zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RICHTER UND TEUFEL IM MITTELALTER
- 2.1 DER TEUFEL
- 2.2 DER RICHTER IM RAHMEN VON GÖTTLICHER UND WELTLICHER RECHTSPRECHUNG
- 3. „DER RICHTER UND DER TEUFEL“
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Motiv des Teufels in der mittelalterlichen Literatur am Beispiel der Stricker-Märe „Der Richter und der Teufel“. Im Fokus steht die Konzeption des Teufels, wobei auch die Gestaltung der Richterfigur berücksichtigt wird. Um die spezifischen Züge der Figuren zu erklären, wird die Verknüpfung von Rechtsprechung und Theologie im Mittelalter beleuchtet.
- Die Darstellung des Teufels in der mittelalterlichen Literatur
- Die Rolle des Teufels im christlichen Kontext
- Die Bedeutung des Rechts und der Rechtsprechung im Mittelalter
- Die Darstellung von Richterfiguren in mittelalterlichen Texten
- Die historische und kulturelle Einbettung der Märe „Der Richter und der Teufel“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird der Teufel als Figur im Mittelalter dargestellt, seine Funktion im christlichen Kontext sowie seine Rolle in der Literatur beleuchtet. Das zweite Kapitel behandelt außerdem die Rolle des Richters im Mittelalter, seine Aufgaben und die spezifischen Herausforderungen im Rahmen von göttlicher und weltlicher Rechtsprechung. Im dritten Kapitel wird die Märe „Der Richter und der Teufel“ analysiert und im Kontext der vorhergehenden Kapitel interpretiert.
Schlüsselwörter
Teufel, mittelalterliche Literatur, Rechtsprechung, Theologie, Märe, Richter, Höllenvision, Stricker, „Der Richter und der Teufel“, Rechtsgeschichte.
- Citar trabajo
- Miriam Dauben (Autor), 2009, Das Motiv des Teufels in der mittelalterlichen Literatur am Beispiel von 'Der Richter und der Teufel' vom Stricker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145289