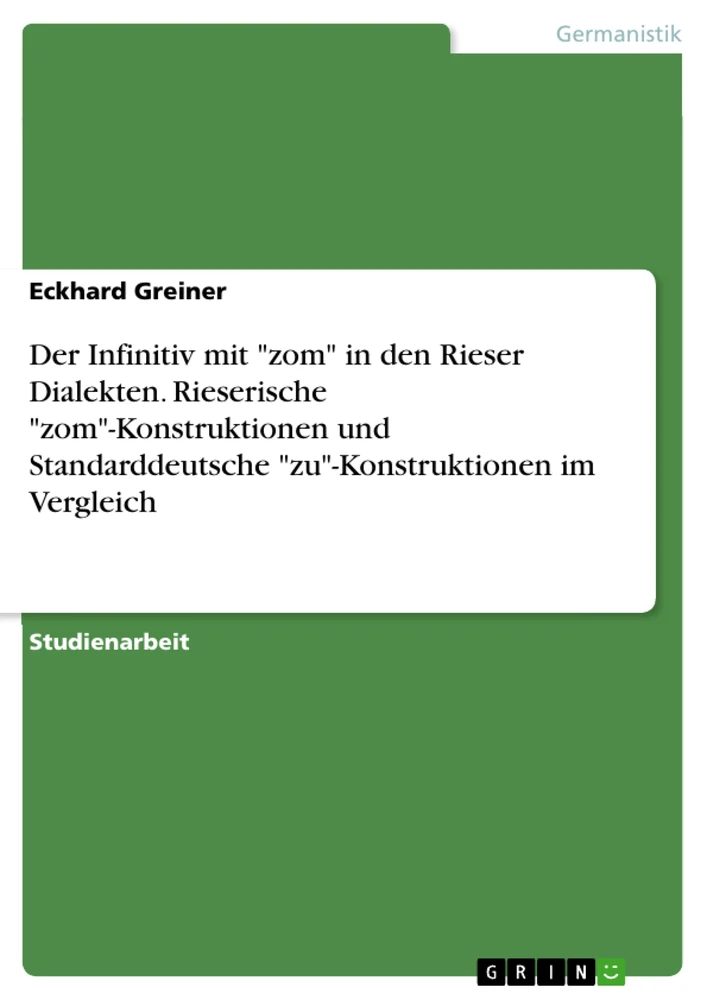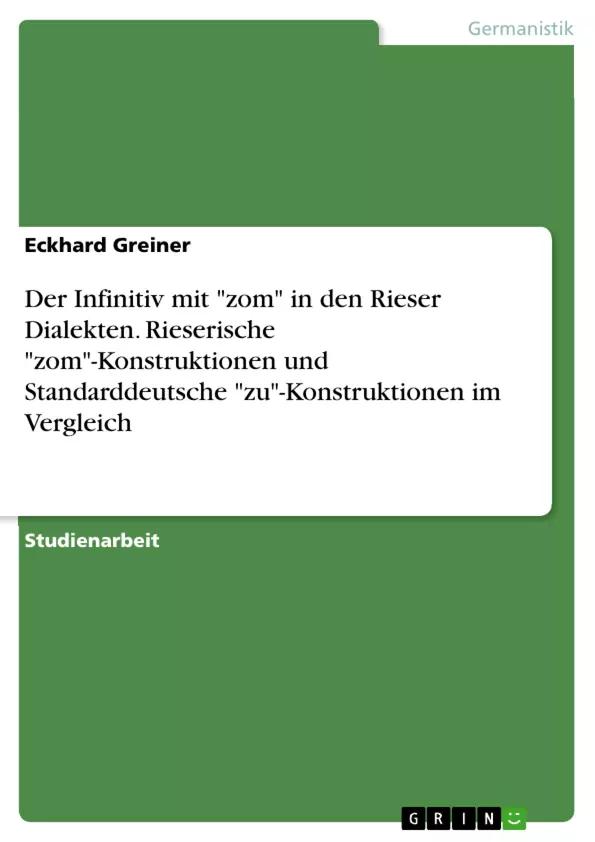Diese Arbeit befasst sich mit dem syntaktischen Phänomen des Infinitivs mit "zom" in den Rieser Dialekten. Während für die Morphologie und die Phonologie schon bei oberflächlicher Betrachtung große Unterschiede zwischen den Rieser Dialekten und dem Standarddeutschen deutlich werden, wie zum Beispiel im "Bayrischen Sprachatlas" von Hinderling/König gezeigt wird, gilt dies für die Syntax nicht in diesem Maße.
Diese Arbeit greift ein syntaktisches Phänomen heraus und versucht Parallelen und Unterschiede zum Standarddeutschen herauszuarbeiten und diese dann vergleichend mit Hilfe der Head-Driven Phrase Structure Grammer (HPSG) zu analysieren. Zunächst wird dafür der Forschungsgegenstand definiert und auf die speziellen Probleme dieses Themas eingegangen. Daraufhin werden unterschiedlichen Verbtypen, die beim "zom"-Infinitiv in den Rieser Dialekten auftreten, und die Besonderheiten im Vergleich mit dem Standarddeutschen untersucht. Die Arbeit schließt mit einem Fazit. Die Ausgangsthese ist, dass es zwischen der rieserischen "zom"-Konstruktion und der standarddeutschen "zu"-Konstruktion sehr viele Parallelen gibt und nur vereinzelt Unterschiede gefunden werden können.
Inhalt
1 Einleitung
Diese Arbeit befasst sich mit dem syntaktischen Phänomen des Infinitivs mit zom in den Rieser Dialekten. Während für die Morphologie und die Phonologie schon bei oberflächlicher Betrachtung große Unterschiede zwischen den Rieser Dialekten und dem Standarddeutschen deutlich werden, wie zum Beispiel im Bayrischen Sprachatlas von Hinderling/König (Hrsg.) (1935-2011) gezeigt wird, gilt dies für die Syntax nicht in diesem Maße.
Diese Arbeit greift ein syntaktisches Phänomen heraus und versucht Parallelen und Unterschiede zum Standarddeutschen herauszuarbeiten und diese dann vergleichend mit Hilfe der Head-Driven Phrase Structure Grammer (HPSG) zu analysieren.
Zunächst wird dafür der Forschungsgegenstand definiert und auf die speziellen Proble-me dieses Themas eingegangen. Daraufhin werden unterschiedlichen Verbtypen, die beim zom-Infinitiv in den Rieser Dialekten auftreten, und die Besonderheiten im Ver-gleich mit dem Standarddeutschen untersucht. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Die Ausgangsthese ist, dass es zwischen der rieserischen zom-Konstruktion und der standarddeutschen zu -Konstruktion sehr viele Parallelen gibt und nur vereinzelt Unter-schiede gefunden werden können.
2 Die Rieser Dialekte und die Probleme ihrer Erforschung
Eine genaue Abgrenzung des Rieserischen1 zu den umliegenden Dialekten wurde von Greiner in der Hausarbeit „Das Vokalsystem der Rieser Dialekte und die Entwick-lung vom Mittelhochdeutschen bis in die Gegenwart“ (2016) vorgenommen.
König/Renn (2007) zählen das Rieserische zu den ostschwäbischen Dialekten. Es wird hauptsächlich im geographisch abgeschlossenen Gebiet des Meteoritenkrater Nördlinger Ries im Norden des bayerischen Regierungsbezirk Schwaben gesprochen.
Ein Problem bei Untersuchungen zum Rieserischen stellt dar, dass es nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, auf die man sich stützen könnte. Die, die es gibt, befassen sich kaum mit dem Bereich Syntax, sondern hauptsächlich mit der Phonologie, der Morphologie oder der Lexik. In einigen Punkten scheint das benach-barte Bairisch dem Rieserischen nahe zu sein, weswegen im Folgenden teilweise auf Untersuchungen des Bairischen zurückgegriffen wurde.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Untersuchung des Rieserischen ist der große Einfluss des Standarddeutschen auf den Dialekt. In manchen Fällen ist es schwierig zu unterscheiden, ob eine Konstruktion im Dialekt schon länger möglich ist, oder ob sie erst in jüngster Zeit durch die Übernahme standarddeutscher Konstruktionen gebräuch-lich wurde.
Für die Verifizierung der Grammatikalität der Rieser Beispiele wurde das Urteil dreier Rieser Muttersprachler eingeholt und nur bei Übereinstimmung wurden sie in dieser Arbeit aufgenommen.
3 Konstruktionen mit zom und Infinitiv im Rieserischen
Die im Standarddeutschen übliche Konstruktion mit zu und Infinitiv gibt es ur-sprünglich im Rieserischen nicht. Wie es Bayer (1993) in seinem Aufsatz „Zum in Ba-varian and Scrambling“ für das Bairische beschreibt, hat auch das Rieserische ver-schiedene Ersatzkonstruktionen. Neben einer Konstruktion mit der Subjunktion dass und finitem Satz und einer Konstruktion mit Präposition und nominalisiertem Verb ist eine der Gebräuchlichsten die Konstruktion mit zom und Infinitiv. Diese Konstruktion zeigt verschiedene Eigenschaften, die in vielen Fällen eine Analogie mit der Standard-deutschen zu -Konstruktion nahelegen. Zur genaueren Untersuchung werden im Fol-genden die unterschiedlichen Arten von Verben, die im Standarddeutschen mit zu-Infi- nitvkonstrukion auftreten, in ihrer rieserischen Form in Bezug auf die Konstruktions-möglichkeiten mit zom und Infinitiv untersucht und Gemeinsamkeiten und Unterschie-de zum Standarddeutschen herausgearbeitet. Dabei orientiert sich diese Arbeit in ihrer Struktur an Müller (2013a), Kap. 16.
3.1 Subjektanhebungsverben
Für die Subjektanhebungsverben soll zunächst das Verb scheinen betrachtet werden. Hier zeigt sich schon der erste interessante Unterschied, denn scheinen gibt es im Rie-serischen als Anhebungsverb gar nicht.
(1) weil Dieter morgen Claudia zu treffen scheint.
(2) weil dr Dieter morga scheints d'Claudia drifft.
Satz (1) würde im Rieserischen wie (2) lauten. Das Rieserische kennt in diesem Zu-sammenhang keine Infinitivkonstruktion. Das Wort scheints ist wohl eine Zusammen-ziehung aus scheint und dem klitischen Pronomen -s ( für es), aber es wird nicht ver¬bal, sondern adverbial verwendet. Das infinite Verb des standarddeutschen Satzes wird zum finiten Verb und scheints fungiert als eigene Konstituente, die an jeder Stelle im Mittelfeld oder im Falle eines HS auch im Vorfeld stehen kann, wie Bsp. (3)-(6) zei¬gen.
(3) weil scheints dr Dieter morga d'Claudia drifft.
(4) weil dr Dieter scheints morga d'Claudia drifft.
(5) weil dr Dieter morga d'Claudia scheints drifft.
(6) Scheints drifft dr Dieter morga d'Claudia.
Die Analyse für das Rieserische sieht somit aus wie ein standarddeutscher Satz mit scheinbar.
Abb.1
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Ein Sonderfall unter den Subjektanhebungsverben sind im Standarddeutschen die Phasenverben. Diese gibt es auch im Rieserischen und sie konstruieren in vielen Fällen analog zur standarddeutschen Konstruktion.
(7) weil das Mädchen gar nicht mehr mit der neuen Puppe zu spielen aufhört.
(8) weil ds'Mädle gar nemme mit dr nuia Doll zom spiela aufherd.
Diese Konstruktion zeigt alle Eigenschaften, die sie auch im Standarddeutschen hat. So ist der Skopus von gar nemme sowohl weit als auch eng möglich. Dieser Satz hat also zwei Lesarten: Bei weitem Skopus bedeutet er, dass das Mädchen gar nicht mehr aufhört zu spielen, bei engem Skopus, dass das Mädchen aufhört, gar nicht mehr zu spielen. Auch sind Permutationen im Mittelfeld möglich.
(9) weil mit dr nuia Doll ds Mädle gar nemme zom spiela aufheard.
Schließlich können analog zum Standarddeutschen Phasenverben auch inkohärent konstruieren.
(10) weil ds Mädle gar nemme aufheard mit dr nuia Doll zom spiela.
(11) weil ds Mädle mit dr nuia Doll zom spiela gar nemme aufheard.
(12) weil mit dr nuia Doll zom spiela ds Mädle gar nemme aufheard.
Dabei ist sowohl die Extraposition (Bsp. 10) wie auch die Intraposition des Infinitivs (Bsp. 11 und 12) möglich. Auch betten die Phasenverben Prädikate mit expletivem Subjekt (Bsp. 13 und 14) ein, was die Einordnung der Phasenverben als Anhebungs-verben rechtfertigt.
(13) weil's dann wia wild zom schneia agfant hod. weil es dann wie wild zu schneien begonnen hat.
(14) weil's dann agfangt hod, wia wild zom schneia.
Ein Beispiel für die Einbettung einer subjektlosen Konstruktion kann hier nicht ange-führt werden, weil es diese im Rieserischen nicht zu geben scheint.
Die bisherigen Daten zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Phasenverben eine Analyse genauso aussehen würde wie im Standarddeutschen, nämlich mit SUBJ- Merkmal für das infinite Verb, das das Subjekt enthält, während dieses in der SUB-CAT-Liste nicht auftaucht (Abb. 2).
Abb. 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Allerdings gibt es für Phasenverben im Rieserischen auch Daten, die sich vom Standarddeutschen unterscheiden. Zum einen betrifft dies Partikelverben, zum an-deren Konstruktionen mit NPs, die nur aus dem Nomen bestehen.
Zunächst zu den Partikelverben.
(15) weil Josef gar nicht aufhört herum zu schreien.
Für Beispiel (15) gibt es mehrere Möglichkeiten einer Übertragung ins Rieserische. Im folgenden werden nur die beiden Konstruktionen mit zom diskutiert. Zum einen gibt es eine, die analog zum Standarddeutschen analysiert werden kann (16) + (Abb. 3).
(16) weil dr Josef gar ned aufheard rom zom blerra.
Abb. 3:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Interessant ist die zweite Variante: .
(17) weildrJosefgar net zomromblerra aufheard.
weil Josef gar nicht zu herumschreien aufhört.
Beide Möglichkeiten wurden von verschiedenen Rieser Muttersprachlern für gramma-tisch gehalten.
Wie ist nun die zweite Variante zu analysieren. Eine Analyse entsprechend der ersten ist hier nicht möglich, weil dann innerhalb der Infintivform zwischen zom und blerra der Partikel rom steht. Hier könnte ein Blick in die Etymologie des Infinitivs mit zu und zom hilfreich sein. Bayer (1993) schreibt in seinem Aufsatz zur bairischen zum - Konstruktion über die historische Entwicklung:
,,,..., the infinitives of Indoeuropean and Germanic in particular seem to have been verbal nouns rather than verbs in the strict sense... In this situation it is not surprising that the I-heads of infinital sentences. ... and German zu are ho¬monyms of the respective prepositions. In Middle High German one can clear¬ly see that ze assigns dative case to the gerund.“ (S.51)
Dies ist für die Analyse interessant, da einiges darauf hindeutet, dass es sich bei dieser zom-Konstruktion um eine PP handelt. Dies ist zum einen die Tatsache, dass der Parti-kel des Partikelverbs inkorporiert wird, wie das auch bei substantivierten Verben der Fall ist. Zum anderen ist im zom mehr noch als im standarddeutschen zu der Ursprung als Präposition sichtbar. Wie Bayer (1993) für das bairische zum schreibt, ist wohl auch das rieserische zom ursprünglich eine Zusammenziehung der Präposition zu/zo und des Artikel dem/deam in seiner klitischen Form 'm. Die entsprechende Analyse der PP und die Einbettung in den Satz sieht so aus:
Abb. 4:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Bei beiden zom-Konstruktionen hielten Muttersprachler sowohl eine Stellung im Mit-telfeld als auch im Nachfeld für grammatisch.
(18) weil dr Josef gar ned rom zom blerra aufheard.
(19) weildrJosefgar net aufheard zomromblerra.
Ähnliches wie bei den Partikelverben zeigt sich bei Infinitiven mit einem Nomen ohne Determinierer als Argument. Auch hier gibt es die Möglichkeit analog zum Stan-darddeutschen Infinitiv zu konstruieren (Bsp. 21 und 24) oder aber mit einer Inkorpo-ration des Nomens (Bsp. 22 und 25)
(20) weil ich begonnen habe Klavier zu spielen.
(21) weife agfangt hab Klavier zom spiela. .
(22) weife zom Klavier spiela agfangt hab
(23) weil Hans Zigarre zu rauchen aufgehört hat.
(24) Weil dr Hans aufgheard hod Zigarr zom rocha.
(25) Weil dr Hans zom Zigarr rocha aufgheard hod.
Die Analyse beider Konstruktionen sieht dann ähnlich aus wie bei den Partikelver-ben, wobei es für die Infinitivkonstruktion eine Analyse für die inkohärente (Abb. 5) und eine für die kohärente Variante (Abb. 6) gibt. In der inkohärenten Variante wird das infinite Verb direkt mit dem Akkusativ-Objekt gesättigt, während es in der kohä-renten Variante als SUBCAT-Merkmal an die finite Verbform weitergereicht wird.
Abb. 5:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abb.7 zeigt schließlich die Analyse der alternativen rieserischen Variante mit PP:
Abb. 7:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine offene Frage ist, wie denn im Rieserischen ein Konstruktion mit zom und ein-fachem Verb ohne Argumente (26) analysiert wird .
(26) weil dr Fritz zom äggra agfangt hod.
(27) weil Fritz zu pflügen begonnen hat.
(28) weil dr Fritz agfangt hod zom äggra.
Es ist sowohl eine Analyse als PP analog zu Abb. 7 möglich als auch eine Analyse als Infinitiv-Konstruktion analog zu Abb. 6. Entsprechend der in Fußnote 4 (S. 9) an-gesprochenen Stellungspräferenzen würde das Sprachgefühl des Autors für die Stel¬lung in Bsp. (26) eine Analyse als PP bevorzugen, für die Stellung in Bsp. (28) eine Analyse als nicht kohärente Infinitivkonstruktion.
3.2 Objektanhebungsverben
Objektanhebungsverben werden in dieser Arbeit nicht behandelt, weil sie mit Infini-tiven ohne zom bzw. zu gebildet werden.
3.3 Subjektkontrollverben
Bei den Subjektkontrollverben unterscheidet sich die Konstruktion des Rieserischen nicht vom Standarddeutschen.
(29) weil Hans die Schweine zu füttern vergessen hat
(30) weil dr Hans d'Sai zom fiadra vergessa hod
(31) weil dr Hans vergessa hod d'Sai zom fiadra
(32) weil d'Sai zom fiadra dr Hans vergessa hod
(33) weild'Sai drHans zomfiadra vergessa hod
(34) Denk daran deine Brotzeit zu essen
(35) Denk dra dei Broadzeit zum essa
(36) Hans versucht schon den ganzen Tag in der Werkstatt den Hammer zu fin¬den.
(37) Dr'Hans vrsuacht scho da ganza Dag en dr Werkstatt da Hamer zom fenda.
Das Einbetten von Verben mit expletivem Subjekt ist wie im Standarddeutschen un¬grammatisch.
(38) *weil'r ned zom grausa versucht hod.
(39) *wo dr Herrgott Geld zom regna versprocha hod.
Auch die für die Phasenverben mögliche Alternativkonstruktion mit einer PP ist bei den Subjektkontrollverben ungrammatisch.
(40) *weil dr Klaus zom auframa vergessa hod.
(41) *weil d'Sophie zom Milch hola versprocha hod.
Eine beispielhafte Analyse sieht somit so aus:
Abb. 8:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.4 Objektkontrollverben
Für die Objektkontrollverben sind die gefundenen Daten widersprüchlich. Hier soll dies an Hand von folgenden drei Verben gezeigt werden: aloida (Standarddeutsch: an-leiten), verbiada (Standarddeutsch: verbieten) und saga (Standarddeutsch: sagen) im Sinne von befehlen oder auffordern.
Für aloida gibt es dieselben Möglichkeiten wie bei den Phasenverben: Die Kon-struktion mit zom analog zum standarddeutschen zu-Infinitiv und bei Partikelverben sowie Verben mit nominalem Argument ohne Determinierer die Anbindung als PP
(42) Maria hat den Peter angeleitet Holz zu spalten.
(43) D'Maria hod da Peder agloit Holz zom hacka.
(44) D'Maria hod da Peder zom Holz hacka agloit.
Verbiada und saga werden im Rieserischen bevorzugt nicht mit Infinitiv sondern mit einem dass-Satz gebildet. Doch in Kombination mit verbiada sind auch Infinitiv-konstruktionen möglich, jedoch nur wie im Standarddeutschen auch (47). Wie bei den Subjektkontrollverben ist jedoch die Kombination mit einer PP mit Nominalisierung. ungrammatisch (48).
(45) Mutter hat mir verboten herum zu schreien.
(46) d'Muadr hod mr verboda, dass e romlärm.
(47) d'Muadr hod mr verboda rom zom lärma.
(48) *d'Muadr hod mr zom Rumlärma verboda.
Bei saga zeigt sich eine andere Situation. Sämtliche Konstruktionen mit Infinitiv sind ungrammatisch (52),(55) oder zumindest sehr zweifelhaft (50),(54).
(49) Der Vater hat dem Sohn befohlen, in die Kirche zu gehen.
(50) ?Dr Vader hod em Bua gsagd, en d'Kirch zom ganga.
(51) Dr Vadr hod em Bua gsagd, dass'r en d'Kirch ganga soll.
(52) * Dr Pfarr hod dr Maria zom Klavier spiela gsagd.
(53) Der Bauer hat mir befohlen hinauf zu gehen.
(54) ?dr Baur hod mr gsagd nauf zom ganga.
(55) *dr Baur hod mr zom Naufganga gsagd.
(56) Dr Baur hod mr gsagd, dass e naufganga soll.
Bei saga handelt es sich wohl um einen Sonderfall, was mit der Semantik zusam-menhängt. Das standarddeutsche Wort befehlen gibt es ursprünglich im Rieserischen nicht. Um dasselbe auszudrücken wird am ehesten saga verwendet. Allerdings muss, um saga im Sinne von befehlen von saga im Sinne von sprechen abzugrenzen, im dass -Satz solla eingefügt werden. Eine ähnliche Ergänzung gibt es für zom-Konstrukti¬onen nicht.
Für alle andere Objektkontrollverben ist eine Konstruktion mit Infinitiv und zom möglich. Nur für die Konstruktion mit einer PP mit zom gibt es unterschiedliche Er-gebnisse. Dies liegt vermutlich daran, dass bestimmte Verben diese PP als Argument annehmen können, andere nicht.
4 Fazit
Diese Arbeit konnte die Phänomene, die im Zusammenhang mit dem zom-Infintiv auf-treten, nur oberflächlich untersuchen. Aus dem untersuchten Material kann aber die eingangs aufgestellte These, dass das Standarddeutsche und das Rieserische den zu/ zom-Infinitiv überwiegend analog konstruieren, durchaus bestätigt werden. Allerdings konnte mit der PP-Konstruktion ein beachtlicher Unterschied gefunden werden. Die These, dass dieser Unterschied sprachhistorische Ursachen hat und im Rieserischen die Entwicklung von der PP-Konstruktion, wie sie im Mittelhochdeutschen vorlag, zur standarddeutschen Infinitivkonstruktion noch nicht vollständig abgeschlossen ist, müsste durch diachronen Untersuchungen verifiziert werden. Keinen Eingang in diese Untersuchung fanden auch die alternativen Konstruktionen zum zom-Infinitiv, die im Rieserischen nach dem subjektiven Empfinden des Autors sehr viel häufiger vorge-nommen werden als im Standarddeutschen, was zusätzlich einen deutlichen Unter-schied darstellen würde. Doch dies müsste in einer eigenen Untersuchung festgestellt werden.
5 Literaturverzeichnis
Bayer, Josef (1993): Zum in Bavarian and Scrambling; in Abraham, Werner; Bayer, Josef (Hg.): Dialektsyntax. Linguistische Berichte Sonderheft, vol 5. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Bußmann, Hadumod (Hg.) (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft (4. durchgese-hene und bibliographisch ergänzte Aufl.), Kröner-Verlag, Stuttgart.
Greiner, Eckhard (2016): Das Vokalsystem der Rieser Dialekte und die Entwick-lung vom Mittelhochdeutschen bis in die Gegenwart, Hausarbeit im Seminar „Historische Phonologie“, Humboldt-Universität zu Berlin
Hinderling, Robert/ König, Werner [Hrsg.] (1935-2011): Bayerischer Sprachatlas. Regionalteil 1; Bd. 2 (1996); Bd. 3 (1997); Bd. 4 (1998); Bd. 5 (1999), Winter Verlag, Heidelberg.
Kiss, Tibor (1995): Infinite Komplementation: neue Studien zum Verbum infinitum, De Gruyter, Berlin.
König, Werner/ Renn, Manfred (2007): Kleiner Sprachatlas von Bayrisch-Schwa-ben, Wißner Verlag, Augsburg.
Müller, Stefan (2013): Head-Driven Phrase Structure Grammer - Eine Einführung (3. überarbeitete Auflage), Stauffenburg Verlag, Tübingen.
Müller, Stefan (2013): Grammatiktheorie (2. überarbeitete Auflage), Stauffenburg Verlag, Tübingen.
Nübling, Damaris (1993): Synthesetendenzen im Alemannischen: Die Klitisierung von Artikel und Personalpronomen; in Schupp, Volker (Hg.): Allemannisch in der Regio. Beiträge zur 10. Arbeitstagung alemannischer Dialektologen, Tübingen.
Schmidt, Friedrich G.G. (1898): Die Rieser Mundart, Lindauer Verlag, München.
Steger, Hartmut (1999): Wörterbuch der RieserMundarten, Verlag Steinmeier, Nördlingen
- Arbeit zitieren
- Eckhard Greiner (Autor:in), 2018, Der Infinitiv mit "zom" in den Rieser Dialekten. Rieserische "zom"-Konstruktionen und Standarddeutsche "zu"-Konstruktionen im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1453192