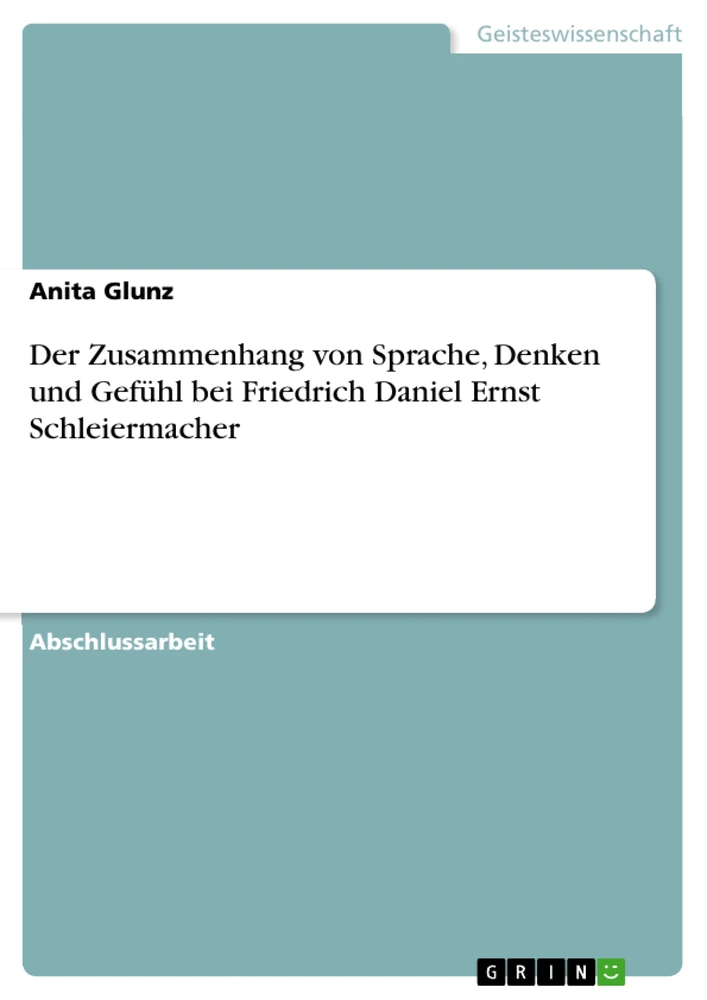Die Zulassungsarbeit zum ersten Staatsexamen setzt sich mit der Personenontologie von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher auseinander und analysiert aus theologischer und sprachphilosophischer Sicht den Zusammenhang von Sprache, Denken und Gefühl in Schleiermachers Anthropologie.
Aus philologischer Sicht wurden Schleiermachers sprachphilosophische Texte analysiert und zu einer Theorie zusammengefasst, deren Grundstein die Gleichsetzung von Sprache und Denken entspricht. Damit schien das Thema in seinem gesamten Umfang erschöpft und wurde mit Lob und Kritik ad acta gelegt. Diese Arbeit möchte zeigen, dass bei einer rein auf diesen Texten beruhenden Analyse Schleiermachers Sprachphilosophie der entscheidende Aspekt verloren gegangen ist. Denn wenn man seine ganzen Aussagen auf dem Hintergrund der Glaubenslehre liest und interpretiert erweitert sich der Zirkel des Verstehens und man nimmt seine Thesen in einem neuen Licht war. Demzufolge ist Schleiermacher nur auf der Basis der ontologischen Definition des unmittelbaren Selbstbewusstseins in seiner Bestimmtheit des absoluten Abhängigkeitsgefühls zu verstehen, auf der jedwede Untersuchung menschlicher Tätigkeiten, wie das Denken und Sprechen fußt. Der Unterschied im Verständnis der Schleiermacherschen Sprachphilosophie wird hier herausgearbeitet und zeigt wie Schleiermacher vom Glauben zum Denken bzw. Sprechen kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Methode und Verortung im System der Wissenschaften bei Schleiermacher
- 1.1 Methode und Verortung im System der Wissenschaften bei Schleiermacher
- 2. Schleiermachers Zeichentheorie - Semiotik als Schematisierungsprozess
- 2.1 Sinneswahrnehmung und Bewusstsein
- 2.2 Organisch-intellektuelle Duplizität
- 2.3 Subjektive und objektive Bewusstseinsäußerungen.
- 2.4 Abgrenzung zur Tiersprache.
- 3. Zusammenhang von Sprache und Denken
- 3.1 Verhältnis von Sprache, Denken und Bewusstsein.
- 3.2 Der Satz als Denkeinheit.
- 3.2.1 Identität des Denkens versus Pluralität der Sprachen
- 3.2.2 Sprachidee und Approximation an das Wissen.
- 3.3 Dialektik und Hermeneutik.
- 3.4 Kritik aus der modernen Linguistik
- 4. Sprache und Denken auf der Grundlage des Gefühls – ein anthropologisches Gesamtbild.
- 4.1 Bestimmung des unmittelbaren Selbstbewusstseins als Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit.
- 4.1.1 Entwicklungsstufen des Selbstbewusstseins im Bezug zu Sprache und Denken.
- 4.1.2 Neuverortung von Sprache und Denken a posteriori.
- 4.2 Gesamtinterpretation des Zusammenhangs von Sprache, Denken und Gefühl
- 5. Konsequenzen des Verhältnisses von Sprache, Denken und Gefühl.
- 5.1 Anthropologische Konsequenzen.
- 5.2 Offenbarung und die Frage: Wie kann man angemessen von Gott reden?
- 6. Konklusion - Schleiermachers anthropologisch begründete Sprachphilosophie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Gefühl bei Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Ziel ist es, die Sprachphilosophie Schleiermachers im Kontext seiner anthropologischen Gesamtbetrachtung zu analysieren und seine Sicht auf die Interaktion zwischen diesen drei Aspekten zu erforschen.
- Schleiermachers Konzept der Sprache als „nothwendige Function des Menschen“ und ihr Stellenwert im Prozess der Wissens- und Gemeinschaftsbildung
- Die Rolle des Gefühls als grundlegendes Element der menschlichen Ontologie und seine Bedeutung für das Verständnis von Sprache und Denken
- Die Beziehung zwischen Sprache, Denken und Bewusstsein und die Frage nach der Sprache als notwendiger oder hinreichender Bedingung für menschliche Repräsentationsmöglichkeiten
- Die systematische Verbindung zwischen Schleiermachers Dialektik und Hermeneutik im Kontext der Sprachphilosophie
- Die anthropologischen Konsequenzen der Beziehung zwischen Sprache, Denken und Gefühl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext und die Relevanz von Schleiermachers Überlegungen zu Sprache und Denken dar. Sie unterstreicht die Bedeutung der anthropologischen Perspektive für das Verständnis der Sprache und verortet das Thema in Schleiermachers wissenschaftlichem Gesamtsystem.
Kapitel 1 beleuchtet die Methode und die Verortung des Themas im Wissenschaftskosmos Schleiermachers. Es werden die grundlegenden wissenschaftlichen Prinzipien und die Terminologie erläutert, die für die Analyse von Sprache, Denken und Gefühl relevant sind.
Kapitel 2 widmet sich der Sprache als „allgemeines und gemeinsames Bezeichnungssystem“ und untersucht die Rolle der Sinneswahrnehmung, des Bewusstseins und der organisch-intellektuellen Duplizität im Prozess der sprachlichen Repräsentation. Es werden auch die Abgrenzung zur Tiersprache und die Beziehung zwischen Sprache und Denken beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die Verbindung zwischen Sprache und Denken in ihren verschiedenen Facetten, beleuchtet die Beziehung zwischen Sprache, Denken und Bewusstsein, analysiert den Satz als Denkeinheit und widmet sich den Themen der Identität des Denkens, der Pluralität der Sprachen, der Sprachidee, der Approximation an das Wissen sowie der Dialektik und Hermeneutik.
Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang von Sprache und Denken im Kontext des Gefühls. Es beleuchtet die Bestimmung des Selbstbewusstseins als Gefühl der Abhängigkeit und erforscht die Entwicklungsstufen des Selbstbewusstseins im Bezug zu Sprache und Denken sowie die Neuverortung von Sprache und Denken a posteriori.
Kapitel 5 erörtert die Konsequenzen des Verhältnisses zwischen Sprache, Denken und Gefühl, insbesondere die anthropologischen Konsequenzen und die Frage nach der angemessenen Rede von Gott.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich der Sprachphilosophie Schleiermachers, insbesondere der Beziehung zwischen Sprache, Denken und Gefühl. Zentrale Begriffe sind die menschliche Ontologie, die Sinneswahrnehmung, das Bewusstsein, die organisch-intellektuelle Duplizität, die Sprachidee, die Dialektik, die Hermeneutik, die Anthropologie, das Selbstbewusstsein, die Abhängigkeit und die Offenbarung.
- Quote paper
- Studienrätin Anita Glunz (Author), 2007, Der Zusammenhang von Sprache, Denken und Gefühl bei Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1453928