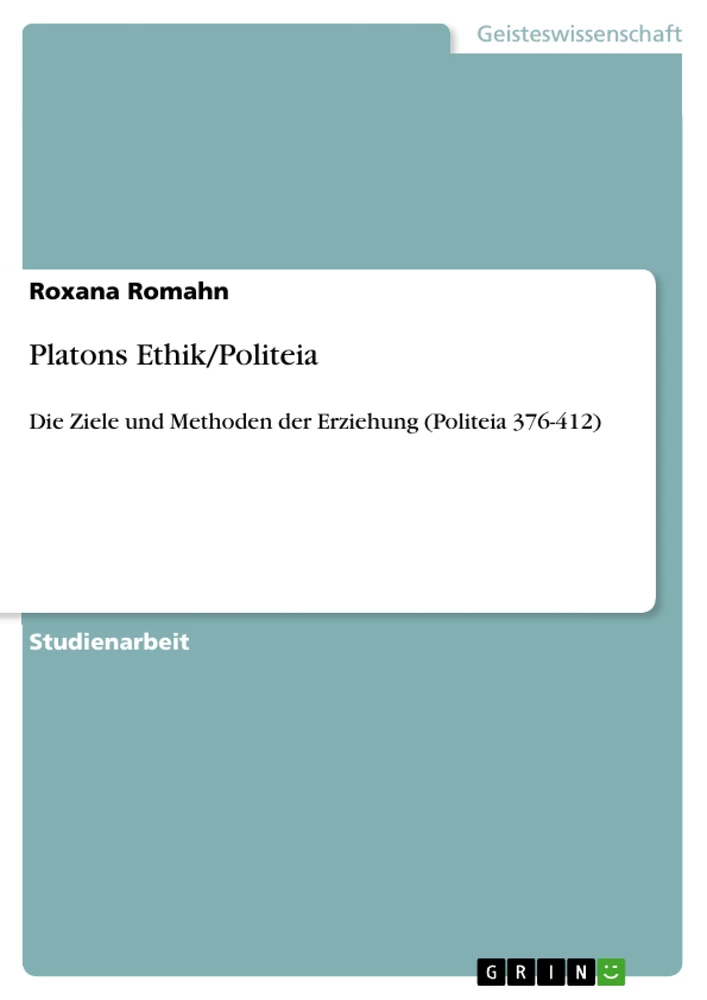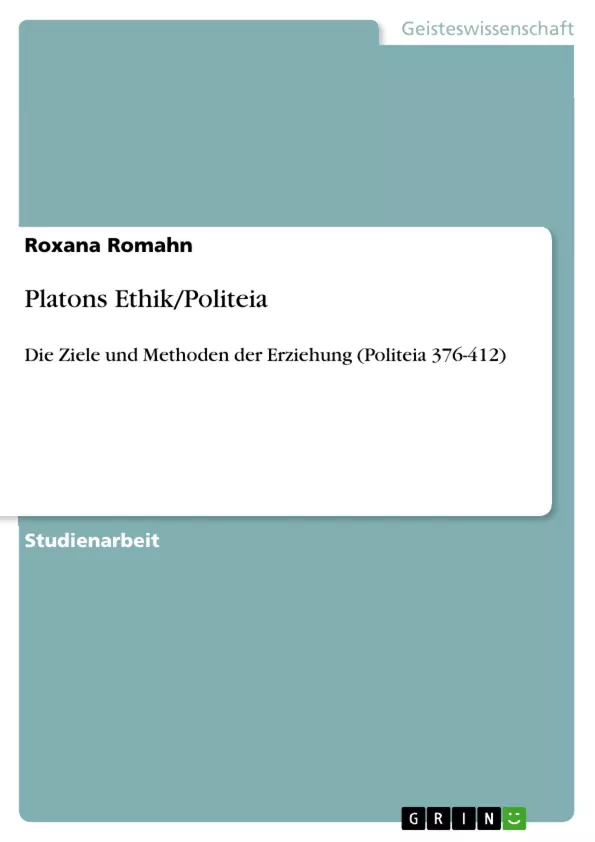„Also wollen wir kühnlich auch für den Menschen festsetzen, [...] (dass) einer seiner Natur nach nur gegen Angehörige und Bekannte sanftmütig sein soll [...] Komm also, und als wenn wir uns bei voller Muße etwas erzählten, laß uns die Erziehung dieser besprechen.“ (PLATON, Politeia, 376 c ff.)
Gemeint sind an dieser Stelle der Politeia die Wächter, die gleichzeitig als eine Art Herrscher der im Werk hypothetisch gegründeten „guten und gerechten Stadt“ dienen. Die Idee der „gerechten Stadt“ wird zuvor und auch nachfolgend dem zu behandelnden Abschnitt von Platon und einigen wahrscheinlich fiktiv von ihm verwendeten Figuren mit realen Vorbildern wie Sokrates entwickelt. Der Autor selbst tritt also als literarische Figur auf, die im Gespräch mit anderen philosophische Thesen entwickelte und diese dann diskutiert.
Diskutiert wird hierzu in dem Abschnitt von 376 a bis 412 e der Stephanus-Nomenklatur von 1578 vor allem die Methoden und Ziele der Erziehung von Jünglingen, die zu guten Wächtern für die besagte gerechte Stadt ausgebildet werden sollen. Worauf sich einige Fragen stellen.
Welcher Natur soll ein Wächter überhaupt sein? Gibt es natürliche Anlagen, die einen Jungen besonders zum Wächter prädestinieren? Wie soll man die Jünglinge überhaupt erziehen? Und mit welchen Zielen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Betrachtungen
- Die philosophische Natur
- Die musische Erziehung
- Märchen und Göttersagen
- Grundzüge der wahren Götterlehre
- Die Lüge
- Verbote für Bürger und Dichter
- Reden über Heroen und Menschen
- Die Vortragsweisen Erzählung und Darstellung
- Tonarten, Musikinstrumenten und Rhythmen
- Lust und wahre Liebe
- Sinn und Ziel der musischen Erziehung
- Die gymnastische Erziehung
- Lebensweise und Speisen
- Rechtsgelehrsamkeit und Heilkunde
- Sinn der gymnastischen Erziehung und Verhältnis zur musischen
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der von Platon in der Politeia dargestellten Erziehung von Wächtern in einer gerechten Stadt. Im Zentrum stehen die Methoden und Ziele dieser Ausbildung, wobei die Rolle der musischen und gymnastischen Erziehung besonders hervorgehoben wird.
- Die philosophische Natur des Wächters
- Die Bedeutung der musischen Erziehung für die Seelenbildung
- Die Rolle von Märchen und Göttersagen in der Erziehung
- Die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Rede
- Die Verbindung von gymnastischer und musischer Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Betrachtungen
Der Text beginnt mit der Einführung der Wächter als Herrscher der gerechten Stadt und stellt die Frage nach ihrer Natur und Ausbildung. Dabei wird die philosophische Natur als Grundlage für die Erziehung der Wächter betont.
Die philosophische Natur
Platon beschreibt die philosophische Natur des Wächters anhand eines Hundegleichnisses, das die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen „Freund“ und „Feind“ hervorhebt. Der lernbegierige Wächter soll demnach zwischen dem Bekannten und dem Fremden unterscheiden können.
Die musische Erziehung
Die musische Erziehung umfasst im antiken Sinne nicht nur Musik, sondern auch das laute Lesen von Texten, die durch Gesang und Instrumente musikalisch untermalt werden. Platon betont die prägende Kraft der musischen Erziehung für die Seele und die frühzeitige Einwirkung auf die Wertvorstellungen.
Märchen und Göttersagen
Platon plädiert für die Verwendung von „wahren“ Märchen und Göttersagen in der Erziehung, da sie die Grundlage für die Vorstellungswelt der Jünglinge bilden. Er betont die Notwendigkeit, zwischen wahren und falschen Reden zu unterscheiden und falsche Inhalte zu verwerfen.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die „Wächter“ in Platons Politeia?
Die Wächter fungieren als Herrscher und Beschützer der von Platon entworfenen „gerechten Stadt“.
Welche natürliche Anlage muss ein Wächter besitzen?
Ein Wächter soll eine „philosophische Natur“ besitzen, die Platon mit einem Hund vergleicht, der zwischen Bekannten (Freunden) und Unbekannten (Feinden) unterscheiden kann.
Was umfasst die „musische Erziehung“ bei Platon?
Sie umfasst nicht nur Musik, sondern auch Literatur, das Lesen von Texten sowie die Vermittlung von Werten durch Göttersagen und Märchen.
Warum kritisiert Platon bestimmte Märchen und Göttersagen?
Platon fordert, „falsche“ Inhalte und Lügen über Götter zu verbieten, da diese die Seelen der Jünglinge negativ prägen könnten.
Was ist das Ziel der gymnastischen Erziehung?
Die gymnastische Erziehung dient der körperlichen Ausbildung und steht in einem engen, ausgewogenen Verhältnis zur musischen Erziehung, um einen harmonischen Charakter zu bilden.
Wie sollen Wächter laut Platon leben?
Die Arbeit beleuchtet Platons Vorstellungen zu einer einfachen Lebensweise, speziellen Speisevorschriften und dem Verzicht auf unnötigen Luxus für die Wächterklasse.
- Quote paper
- Roxana Romahn (Author), 2008, Platons Ethik/Politeia , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145590