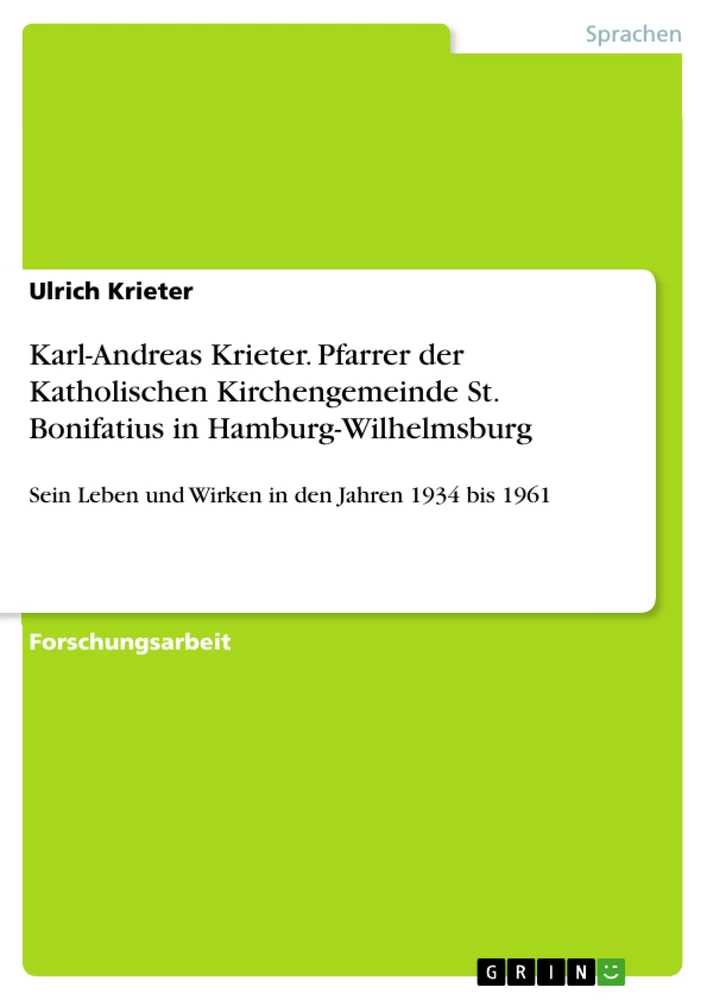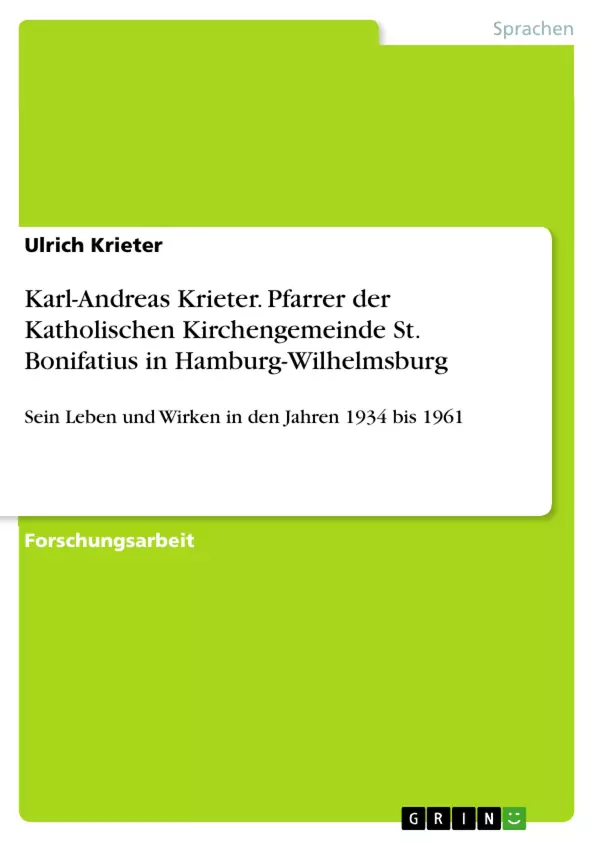Der katholische Pfarrer und Dechant, Karl-Andreas Krieter (1890-1963) galt vielen Menschen seiner Zeit als liebenswerte und bedeutende Persönlichkeit. Er wurde wegen seiner Verdienste um den Bau des Krankenhauses „Groß-Sand“ in Hamburg-Wilhelmsburg mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Eine Straße im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist nach ihm benannt. Der Bischof von Hildesheim ehrte Karl-Andreas Krieter mit dem Titel „Geistlicher Rat“.
Karl-Andreas Krieter wirkte von 1923 bis 1934 in Harburg-Wilstorf als Pastor der Kirchengemeinde St. Franz-Josef. Dieser Abschnitt seines Lebens wird hier beschrieben.
Vom Oktober 1934 bis zum August des Jahres 1961 war Karl-Andreas Krieter Pfarrer der St. Bonifatius-Gemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg. 1944 wurde er Dechant des Dekanates Lüneburg / Harburg. Während der 27 Jahre, die er als Pfarrer und Dechant in Wilhelmsburg tätig war, erlebte Karl-Andreas Krieter die Diktatur Adolf Hitlers, den Zweiten Weltkrieg und die Anfangsjahre der Bundesrepublik Deutschland.
Der hier vorliegende zweite Teil seiner Biografie gewährt beispielhaft Einblick in das kirchliche und weltliche Leben dieser drei Zeitabschnitte.
Im Jahre 1995 wurde das Erzbistum Hamburg gegründet. Ihm wurden alle katholischen Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg zugewiesen. Die Mehrheit dieser Kirchengemeinden gehörte bis dahin zum Bistum Osnabrück. Dagegen gehörten die Kirchengemeinden in Wilhelmsburg und Harburg zum Bistum Hildesheim. Dadurch ist die Geschichte der Hildesheimer Gemeinden in Hamburg verständlicherweise wenig bekannt.
Das vorliegende Werk schließt diese Wissenslücke. Zugleich mit diesem Detail der katholischen Kirchengeschichte des Stadtstaates und des Erzbistums Hamburg werden hier Details der Ortsgeschichte der Hamburger Stadtteile Wilhelmsburg und Harburg veröffentlicht, die noch nicht erforscht und beschrieben waren.
Die vorliegende Biografie des Karl-Andreas Krieter ist in besonderem Maße bemüht, die historischen Quellen selbst reden zu lassen. Hoffentlich regt dieses Quellenmaterial, das bislang im Verborgenen ruhte, zu weiteren Forschungen auf dem Gebiet der katholischen Kirchengeschichte Hamburgs an.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Pastor Krieter wird Pfarrer der Gemeinde St. Bonifatius in Harburg-Wilhelmsburg
- 1.1 Das Angebot des Bischofs
- 1.2 Die Zusage
- 1.3 Die Unterschriftensammlung des Kirchenvorstehers Born
- 1.4 Unangenehme Hinterlassenschaften
- 1.5 Die Geschichte und die soziale Struktur der Gemeinde St. Bonifatius
- 1.6 Die Amtseinführung
- 2. Pfarrer Krieter richtet sich in St. Bonifatius ein
- 2.1 Alltag im Pfarrhaus
- 2.2 Die Organisation der pastoralen Arbeit
- 2.3 Die weltlichen Mitarbeiter
- 3. Das erste Jahr im Amt des Pfarrers von St. Bonifatius
- 3.1 Nationalsozialistischer Geist in der katholischen Schule
- 3.2 Die Nutzung der „Höpenwiese“
- 3.3 Bauliche Mängel an der Bonifatiuskirche, am Kirchplatz und am Pfarrhaus
- 3.4 Advent und Weihnachten 1934
- 3.5 Die „Kindersegnung“ am Fest der unschuldigen Kinder
- 3.6 Anordnungen zum Gebet, zum Glockenläuten und zum Beflaggen der Bonifatiuskirche
- 3.7 Karitatives Wirken
- 3.8 Der erste Besuch des Bischofs Joseph-Godehard in Harburg-Wilhelmsburg
- 3.9 Sorgen um das Weiterleben der Bekenntnisschule
- 3.10 Nur „rein-religiöse“ Jugendarbeit ist noch erlaubt
- 3.11 Die „Wandernde Kirche“
- 3.12 NS-Lügengeschichten über einen Bischof und einen Generalvikar
- 3.13 Kirchliche Feiern in Harburg-Wilhelmsburg
- 3.14 Pfarrer Krieter, ein pragmatischer Seelsorger
- 3.15 Pfarrer Krieter macht sich beliebt
- 3.16 Die Sitzung des Kirchenvorstandes im Juli 1935
- 4. Die Kapläne der Jahre 1935 bis 1940
- 4.1 Der Abschied von Kaplan Konrad Dorenkamp
- 4.2 Kaplan Johannes Wosnitza
- 4.2.1 Finanzielle Verhandlungen mit dem Generalvikariat wegen des Kaplans Wosnitza
- 4.2.2 Kaplan Wosnitza zu Beginn seiner Zeit in St. Bonifatius
- 4.3 Joseph Krautscheidt, Kaplan für die „Wandernde Kirche“
- 4.4 Kaplan Antonius Holling
- 5. Jahre der Bedrängnis, 1936 bis 1939
- 5.1 Seelsorgerliche Anstrengungen
- 5.2 Die Bischöfe und die Rheinlandbesetzung
- 5.3 Beleidigt und verleumdet
- 5.4 Die Bischöfe bieten der NS-Regierung vergeblich ein Bündnis an
- 5.5 In die Sonderstellung gedrängt
- 5.6 Das „St. Willehadstift“ schafft Sorgen
- 5.7 Die Enzyklika „Mit brennender Sorge…“
- 5.8 Der Kampf gegen erneute Verleumdungen
- 5.9 Drohungen des Reichsstatthalters Kaufmann
- 5.10 Das Ende der katholischen Schulen in Wilhelmsburg und Harburg
- 5.11 Das kirchliche Leben geht dennoch weiter
- 5.11.1 Jubel in St. Franz-Josef
- 5.11.2 Bautätigkeiten in St. Bonifatius
- 5.12 Rückblick auf die „große Politik“ der Jahre 1936 bis 1939
- 6. Während des 2. Weltkrieges
- 6.1 Erste Auswirkungen des Krieges in St. Bonifatius
- 6.2 Priesterjubiläum im zweiten Kriegsmonat
- 6.3 Gebote, Verbote, Anordnungen und Bekanntgaben
- 6.4 Das Jahr 1940
- 6.4.1 Einschränkungen im Alltagsleben und Sorgen wegen neuer Kosten für die Kirchenkasse
- 6.4.2 Kaplan Holling wird versetzt
- 6.4.3 Pfarrer Friedrich Schmidts wird Nachfolger des Dechanten Carl Kopp
- 6.4.4 Die ersten Bomben fallen auf Hamburg
- 6.4.5 Primiz am Morgen nach dem Luftangriff
- 6.4.6 Kaplan Wosnitza wird versetzt
- 6.4.7 Die Weihe der Gemeinde St. Bonifatius an die Gottesmutter
- 6.4.8 Der Zorn des Dr. Offenstein
- 6.4.9 Rückblick auf das Jahr 1940
- 6.5 Das Jahr 1941
- 6.5.1 Die Luftangriffe gehen weiter
- 6.5.2 Die Kinderlandverschickung
- 6.5.3 Die seelsorgerliche Betreuung dienstverpflichteter Ausländer
- 6.5.4 Der Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom 26. 6. 1941
- 6.5.5 Der „Klostersturm“
- 6.5.6 „Euthanasie“; die dritte Predigt des Bischofs von Münster
- 6.5.7 Rettung aus der psychiatrischen Anstalt Lüneburg
- 6.5.8 Pater Jussen kommt, Kaplan Surkemper wird versetzt
- 6.5.9 Rückblick auf das Jahr 1941
- 6.6 Das Jahr 1942
- 6.6.1 Die Gemeinde „opfert“ Kirchenglocken
- 6.6.2 Gedanken und Trostworte zum Soldatentod
- 6.6.3 Wahrzeichen der Angst an der „Heimatfront“
- 6.6.4 Nachbesserungen an der Verdunkelungseinrichtung der Bonifatiuskirche
- 6.6.5 Folgen einer Denunziation
- 6.6.6 Seelische und körperliche Anforderungen bis an die Grenze der Belastbarkeit
- 6.6.7 Der sorgenerfüllte Dezember 1942
- 6.6.8 Freude am Engagement der Pfarrjugend
- 6.7 1943, das „Jahr des Schreckens“
- 6.7.1 Stalingrad und der Umgang mit der militärischen Niederlage bei Katholiken und Nationalsozialisten
- 6.7.2 Die Bomben- und Brandkatastrophe für Hamburg
- 6.7.3 „Bereitseinkönnen zum Sterben“ und das Gebet für den Frieden der Völker
- 6.7.4 Die Versetzung des Pfarrers Wüstefeld
- 6.7.5 Nachrichten von den Verwandten
- 6.7.6 Die letzten Monate des Jahres 1943
- 6.8 Das Jahr 1944
- 6.8.1 Das Kriegsgeschehen und die Folgen für den Gottesdienst
- 6.8.2 Unglückswochen für die Kirchengemeinde St. Bonifatius im Juni und August 1944
- 6.8.3 Pfarrer Krieter wird Dechant des Dekanates Lüneburg
- 6.8.4 Die Unglückswochen für die Kirchengemeinde St. Maria
- 6.9 In Erwartung des Kriegsendes
- 6.9.1 Erneutes Unglück für St. Bonifatius
- 6.9.2 Die Woche nach dem 31. 3. 1945
- 6.9.3 Während der letzten Tage des Krieges
- 7. Dechant Krieter in den ersten Nachkriegsjahren
- 7.1 Neue Personen in der Regierung und Verwaltung Hamburgs
- 7.2 Der Wiederaufbau des religiösen Lebens und karitative Anstrengungen der katholischen Gemeinden
- 7.3 Die Stellungnahme der Bischöfe zur Hitlerzeit und ihre „Grundsätze des religiösen Lebens nach Kriegsende“
- 7.4 Die Bonifatiuskirche wird restauriert
- 7.5 Keine Kontinuität auf den Kaplanstellen
- 7.6 Senator Velthuysen macht der Bonifatiusgemeinde ein Geschenk
- 7.7 Zwei handschriftliche Briefe von Bischof Joseph-Godehard
- 7.8 Die Wiedereinrichtung der katholischen Schulen in Wilhelmsburg und Harburg
- 7.9 Dechant Krieter bestellt Andreas Nolte zum Rektor der Bonifatiusschule
- 7.10 Die Gründung des Krankenhauses Groß-Sand
- 7.11 Dechant Krieter und die besonderen Nöte der ersten Nachkriegszeit
- 7.11.1 Die Entnazifizierung
- 7.11.2 Die Hunger- und Kältekatastrophe 1946 / 1947
- 7.11.3 Die Währungsreform
- 7.12 Die Verwandten während der ersten Nachkriegszeit
- 8. Jahre der Zufriedenheit und Kontinuität
- 8.1 Dechantentätigkeit
- 8.2 Die Kapläne Rademacher, Goedde und Hölsken
- 8.3 Verzicht auf die Privatsphäre und Kapitulation vor der Aufgabe, Pflegevater zu sein
- 8.4 Die Bauvorhaben der Fünfziger Jahre
- 8.4.1 Der Bau des neuen Gemeindehauses
- 8.4.2 Die Erweiterung des Krankenhauses
- 8.5 Freude über den Priesternachwuchs aus der Bonifatiusgemeinde
- 9. Schwere Prüfungen in den letzten Amtsjahren
- 9.1 Körperliche Beschwerden
- 9.2 Zwei „schwierige“ Kapläne
- 9.3 Der Tod des Rektors Nolte
- 10. Zustimmung zur Wiedereinrichtung des Sportvereins DJK-Wilhelmsburg
- 11. Silbernes Ortsjubiläum und unerwartete Ehrungen
- 12. Die Bitte um Versetzung in den Ruhestand
- 13. Ruhestand in Hilkerode
- 14. Tod, Bestattung und Nachrufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk beschreibt das Leben und Wirken von Pfarrer Karl-Andreas Krieter in der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius in Hamburg-Wilhelmsburg von 1934 bis 1961. Es beleuchtet seinen Alltag, seine pastoralen Aktivitäten und seine Herausforderungen während der NS-Zeit und der Nachkriegsjahre.
- Der Alltag eines Pfarrers während des Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Die Herausforderungen der Seelsorge unter dem NS-Regime
- Der Umgang mit den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen
- Der Wiederaufbau der Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg
- Das Wirken des Pfarrers in den Bereichen Bildung und Soziales
Zusammenfassung der Kapitel
1. Pastor Krieter wird Pfarrer der Gemeinde St. Bonifatius in Harburg-Wilhelmsburg: Dieses Kapitel beschreibt die Umstände, die zur Versetzung von Pastor Krieter nach Wilhelmsburg führten. Es schildert seine anfänglichen Bedenken und die positiven Aspekte des neuen Amtes, einschließlich der großen Gemeinde und der umfangreichen Ausstattung. Der Kapitel beschreibt auch die unangenehmen finanziellen Hinterlassenschaften seines Vorgängers und die komplizierte Geschichte und soziale Struktur der Gemeinde, insbesondere den polnischen Einfluss. Der Wechsel nach Wilhelmsburg wird als ein Schritt in eine größere, aber auch herausforderndere Aufgabe dargestellt.
2. Pfarrer Krieter richtet sich in St. Bonifatius ein: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Leben im Pfarrhaus, die Organisation des Haushalts durch Therese Krieter, und den Aufbau der pastoralen Arbeit. Es zeichnet ein detailliertes Bild des Pfarrhauses und der Beziehungen zwischen Pfarrer Krieter, seiner Schwester, und den Kaplänen. Die Beschreibung des täglichen Lebens und der Organisation der pastoralen Arbeit zeigt die pragmatische und menschenorientierte Art des Pfarrers.
3. Das erste Jahr im Amt des Pfarrers von St. Bonifatius: Dieses Kapitel schildert die ersten Erfahrungen des Pfarrers in seinem Amt, darunter der zunehmende Einfluss des Nationalsozialismus in der katholischen Schule, die Nutzung der Höpenwiese für die Jugend, und die notwendigen Bauarbeiten an Kirche und Pfarrhaus. Das Kapitel zeigt, wie Pfarrer Krieter mit den Herausforderungen des nationalsozialistischen Regimes umging, sowohl in der Schule als auch im Gemeindeleben.
4. Die Kapläne der Jahre 1935 bis 1940: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Porträts der Kapläne, die Pfarrer Krieter während seiner Amtszeit unterstützten. Es beschreibt ihre individuellen Persönlichkeiten, ihre Aufgaben in der Gemeinde, und die Herausforderungen, denen sie begegneten, insbesondere im Kontext des wachsenden Einflusses des Nationalsozialismus. Der Abschied von Kaplan Dorenkamp und die Ankunft von Kaplan Wosnitza werden ausführlich dargestellt.
5. Jahre der Bedrängnis, 1936 bis 1939: Dieses Kapitel beschreibt die zunehmende Bedrängnis der katholischen Kirche durch das NS-Regime. Es werden die seelsorgerlichen Anstrengungen der Geistlichen, die Reaktion auf die Rheinlandbesetzung, die Verleumdungskampagnen, der vergebliche Versuch eines Bündnisses mit Hitler, die zunehmende Isolierung der Kirche, und die endgültige Schließung der katholischen Schulen beschrieben. Die Kapitel schildert die wachsende Bedrohung der Kirche und das Bemühen der Geistlichen, die Gemeinde zu stärken und den Glauben zu bewahren.
6. Während des 2. Weltkrieges: Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Gemeinde St. Bonifatius. Es schildert die ersten Einschränkungen im Gemeindeleben, den Verlust der Kirchenglocken, die Sorgen um die Gefallenen, die Angst vor den Luftangriffen und den Umgang der Gemeinde damit. Die Kapitel dokumentiert die sich verschärfende Kriegslage und deren Auswirkungen auf das Gemeindeleben, die Anpassung an die Kriegsbedingungen und die stetige seelsorgerische Fürsorge.
7. Dechant Krieter in den ersten Nachkriegsjahren: Dieses Kapitel beschreibt den Wiederaufbau des religiösen Lebens in der Nachkriegszeit und die damit verbundenen Herausforderungen. Es werden die neuen politischen Akteure in Hamburg, die Entnazifizierungsmaßnahmen, die Hunger- und Kältekatastrophe, die Wiedereinrichtung der katholischen Schulen und die Gründung des Krankenhauses Groß-Sand dargestellt. Es zeigt den unermüdlichen Einsatz des Dechanten beim Wiederaufbau der Gemeinde und seiner sozialen Einrichtungen.
8. Jahre der Zufriedenheit und Kontinuität: Nach den schweren Jahren des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit erlebt die Gemeinde St. Bonifatius eine Periode der Stabilität und des Wiederaufbaus. Dieses Kapitel beschreibt die Kontinuität im Gemeindeleben, die Arbeit der Kapläne, die Bauvorhaben, die Gründung des Kolpingheimes und die Freude über den Priesternachwuchs. Es dokumentiert die positive Entwicklung der Gemeinde und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Dechant Krieter und seinen Mitarbeitern.
9. Schwere Prüfungen in den letzten Amtsjahren: In den letzten Jahren seiner Amtszeit muss Dechant Krieter mit gesundheitlichen Problemen, schwierigen Kaplänen und dem Tod seines engsten Mitarbeiters, Rektor Nolte, fertig werden. Das Kapitel schildert die Herausforderungen, die Dechant Krieter in seinen letzten Amtsjahren meistern muss, aber auch das Festhalten am Glauben und an der Fürsorge für seine Gemeinde.
10. Zustimmung zur Wiedereinrichtung des Sportvereins DJK-Wilhelmsburg: Dieses Kapitel beschreibt die Wiedergründung des katholischen Sportvereins DJK-Wilhelmsburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Es zeigt den Beitrag des Vereins zum Gemeindeleben und die Unterstützung durch Dechant Krieter.
11. Silbernes Ortsjubiläum und unerwartete Ehrungen: Dieses Kapitel schildert die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Dechant Krieters Amtszeit und die unerwarteten Ehrungen durch den Bischof und den Bundespräsidenten. Es unterstreicht die Anerkennung und Wertschätzung seines Wirkens.
12. Die Bitte um Versetzung in den Ruhestand: Dieses Kapitel beschreibt die Entscheidung von Dechant Krieter, in den Ruhestand zu treten, und die damit verbundenen Überlegungen zur Nachfolge. Es zeigt sein Engagement für die Gemeinde und seine Sorge um die zukünftige Führung.
13. Ruhestand in Hilkerode: Dieses Kapitel beschreibt den Ruhestand von Dechant Krieter in seinem Heimatdorf Hilkerode und seine anhaltende Fürsorge für die Gemeinde und seine Verwandten. Es schildert seine letzten Lebensjahre, geprägt von Krankheit und Ruhe, doch auch von der Freude über den Erfolg seiner Lebensarbeit.
14. Tod, Bestattung und Nachrufe: Dieses Kapitel beschreibt den Tod und die Beerdigung von Dechant Krieter und die Nachrufe, die seinem Wirken und seiner Persönlichkeit gerecht werden. Es unterstreicht das Vermächtnis, das er in seiner Gemeinde hinterlassen hat.
Schlüsselwörter
Pfarrer Karl-Andreas Krieter, St. Bonifatiusgemeinde Hamburg-Wilhelmsburg, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Seelsorge, Gemeindeaufbau, Caritas, Katholische Schule, Krankenhaus Groß-Sand, Entnazifizierung, Wiederaufbau, Soziales Engagement, Priesterberufung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Pfarrer Karl-Andreas Krieter in St. Bonifatius, Hamburg-Wilhelmsburg (1934-1961)"
Wer war Pfarrer Karl-Andreas Krieter?
Pfarrer Karl-Andreas Krieter war der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius in Hamburg-Wilhelmsburg von 1934 bis 1961. Dieses Werk dokumentiert sein Leben und Wirken in dieser Gemeinde während des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit.
Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Dokumentation?
Die Dokumentation umfasst den Zeitraum von 1934 bis 1961, also die gesamte Zeit von Pfarrer Krieters Tätigkeit in St. Bonifatius, von seiner Ankunft bis zu seinem Ruhestand.
Welche Themen werden in der Dokumentation behandelt?
Die Dokumentation behandelt den Alltag eines Pfarrers während des Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit, die Herausforderungen der Seelsorge unter dem NS-Regime, den Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, den Wiederaufbau der Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg sowie das Wirken des Pfarrers in den Bereichen Bildung und Soziales. Es wird detailliert auf die Kapläne, die Gemeindemitglieder und das Gemeindeleben eingegangen.
Wie ging Pfarrer Krieter mit dem Nationalsozialismus um?
Die Dokumentation zeigt, wie Pfarrer Krieter mit den Herausforderungen des nationalsozialistischen Regimes umging. Sie beschreibt seinen pragmatischen Umgang mit den zunehmenden Einschränkungen der Kirche und seinen Einsatz für die Gemeinde trotz der politischen Repressionen und Gefahren.
Welche Rolle spielte die Gemeinde St. Bonifatius während des Zweiten Weltkriegs?
Die Dokumentation beschreibt die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Gemeinde St. Bonifatius, einschließlich der Einschränkungen im Gemeindeleben, der Luftangriffe auf Hamburg, den Verlust von Kirchenglocken und die seelsorgerische Betreuung der Gemeindemitglieder in schwierigen Zeiten.
Wie war die Situation in der Nachkriegszeit?
Die Nachkriegszeit wird als Periode des Wiederaufbaus des religiösen Lebens und der sozialen Einrichtungen beschrieben, einschließlich der Herausforderungen der Entnazifizierung, der Hunger- und Kältekatastrophe und der Wiedereinrichtung der katholischen Schulen. Pfarrer Krieter spielte eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Gemeinde und ihrer sozialen Infrastruktur.
Welche Bedeutung hatte das Krankenhaus Groß-Sand?
Die Gründung des Krankenhauses Groß-Sand wird als ein wichtiger Beitrag von Dechant Krieter zur sozialen Fürsorge in der Nachkriegszeit hervorgehoben.
Welche Schlüsselpersonen werden in der Dokumentation erwähnt?
Neben Pfarrer Karl-Andreas Krieter werden seine Kapläne, Gemeindemitglieder, der Bischof Joseph-Godehard und weitere wichtige Persönlichkeiten aus dem kirchlichen und politischen Leben der Zeit erwähnt.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk gliedert sich in 14 Kapitel, die chronologisch das Leben und Wirken von Pfarrer Krieter in St. Bonifatius von 1934 bis 1961 beschreiben. Jedes Kapitel behandelt spezifische Ereignisse, Herausforderungen und Entwicklungen innerhalb dieser Zeit.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im HTML-Dokument unter der Überschrift "Zusammenfassung der Kapitel" enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Werkes beschreiben, sind: Pfarrer Karl-Andreas Krieter, St. Bonifatiusgemeinde Hamburg-Wilhelmsburg, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Seelsorge, Gemeindeaufbau, Caritas, Katholische Schule, Krankenhaus Groß-Sand, Entnazifizierung, Wiederaufbau, Soziales Engagement, Priesterberufung.
- Quote paper
- Ulrich Krieter (Author), 2010, Karl-Andreas Krieter. Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius in Hamburg-Wilhelmsburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145697